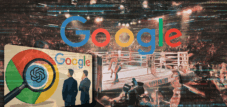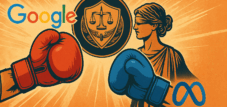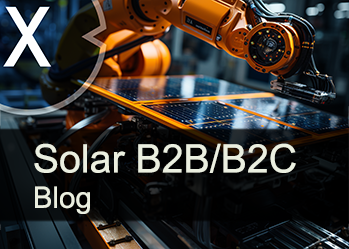Die EU-Kommission und Google: Eine Chronik des Kampfes gegen Wettbewerbsverzerrungen im Technologiesektor
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 21. März 2019 / Update vom: 23. April 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein
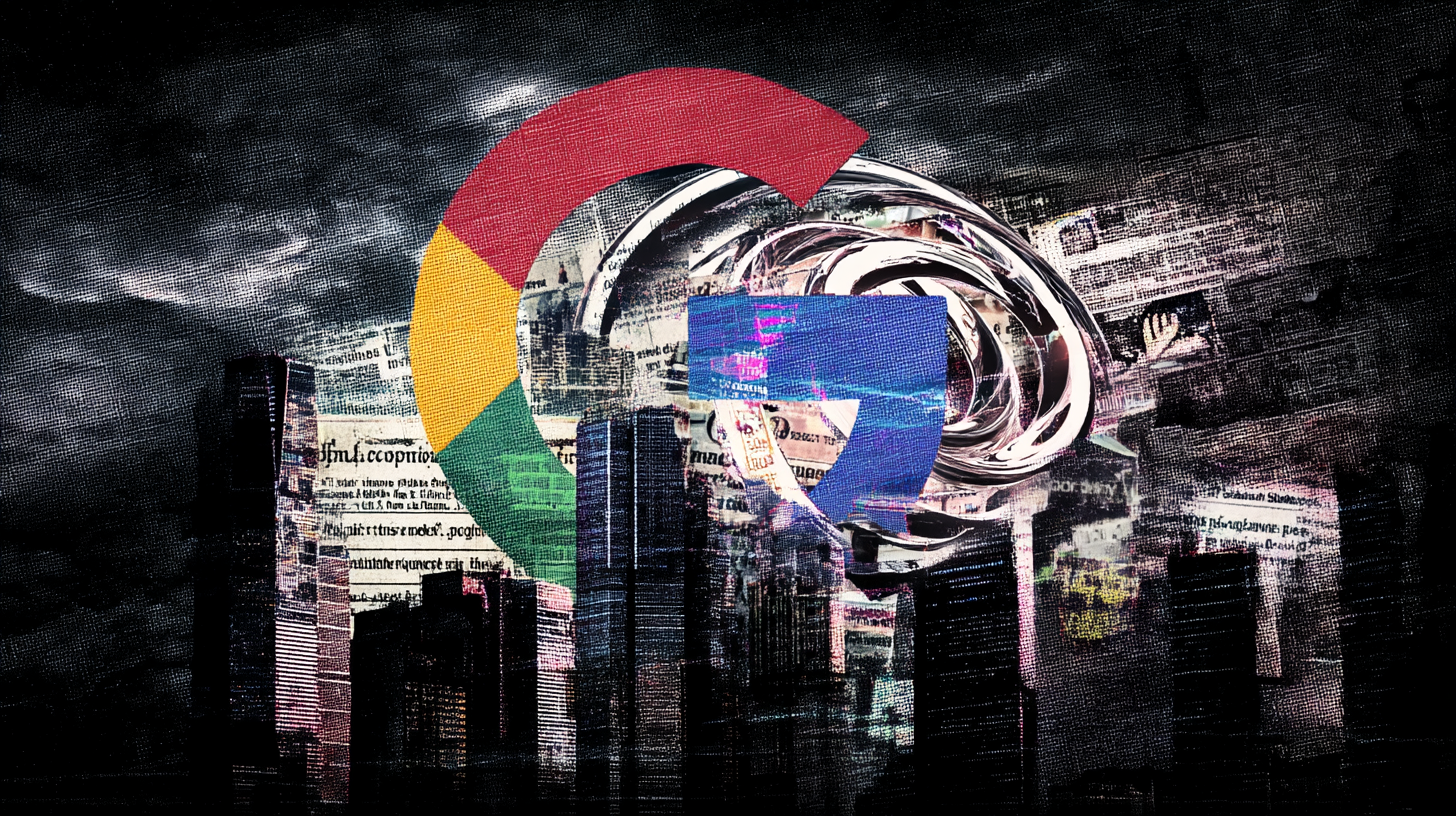
Die EU-Kommission und Google: Eine Chronik des Kampfes gegen Wettbewerbsverzerrungen im Technologiesektor – Bild: Xpert.Digital
EU vs. Google: Ein Kampf um die digitale Vorherrschaft – Die Chronik
Der Brüssel-Effekt: Wie der Google-Streit die globale Tech-Regulierung prägt
Die Europäische Union hat in den letzten Jahren einen entschiedenen Kampf gegen Wettbewerbsverzerrungen im Technologiesektor geführt, mit einem besonderen Fokus auf den Internetgiganten Google. Die Geschichte dieses Konflikts nahm kürzlich eine unerwartete Wendung, als das Gericht der Europäischen Union (EuG) eine milliardenschwere Geldbuße gegen den Suchmaschinenbetreiber aufhob. Dieser Rechtsstreit ist Teil einer umfassenderen Auseinandersetzung zwischen den europäischen Wettbewerbshütern und den großen Technologiekonzernen, die das digitale Zeitalter dominieren.
2019: Die AdSense-Strafe und die überraschende Wendung
Im März 2019 verhängte die Europäische Kommission eine Geldbuße in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gegen Google wegen missbräuchlicher Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Online-Suchanzeigen. Die damalige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärte, dass Google seine Dominanz in der Online-Suchanzeigenbranche durch wettbewerbswidrige vertragliche Beschränkungen auf Websites Dritter gefestigt und sich dadurch vor Wettbewerbsdruck geschützt habe. Konkret ging es um den Dienst AdSense for Search, der es Betreibern von Internetseiten ermöglicht, Google-Suchmasken in ihre Angebote einzubinden und dafür Gegenleistungen zu erbringen.
Die Kommission warf Google vor, seit 2006 mit Hilfe von Ausschließlichkeitsklauseln seine beherrschende Stellung im Bereich der Suchmaschinenwerbung zementiert zu haben. Bei genauerer Betrachtung dieser Klauseln stößt man auf drei besonders problematische Elemente: Die Exklusivitätsklausel, die Platzierungsklausel und die Vorabgenehmigungsklausel. Diese Vertragsbestandteile schränkten die Möglichkeiten der Websitebetreiber ein, Anzeigen konkurrierender Dienste einzublenden.
Die überraschende Wendung kam am 18. September 2024, als das Gericht der Europäischen Union diese Kartellstrafe aufhob. Die Luxemburger Richter erklärten, dass die EU-Kommission nicht hinreichend nachgewiesen habe, dass Google bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst “AdSense for Search” seine beherrschende Stellung missbraucht habe. Obwohl das Gericht die meisten Feststellungen der EU-Kommission bestätigte, verwies es darauf, dass Google verschiedene Ausschließlichkeitsklauseln verwendet habe und die Kommission nicht ausreichend geklärt habe, welche Klauseln für welche Zeiträume verwendet wurden und welche Märkte davon betroffen waren.
Diese Entscheidung bedeutet nicht das Ende des Falls. Die EU-Kommission steht nun vor der Wahl, die fraglichen Teile neu zu prüfen und dann erneut über die Verhängung einer Wettbewerbsstrafe zu entscheiden oder das EuG-Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzufechten. Für Google stellt dieses Urteil jedenfalls einen wichtigen Etappensieg dar, der nach der erst kürzlich erlittenen Niederlage im Google-Shopping-Fall besonders wiegt.
Die vorherigen Kartellverfahren gegen Google
Die AdSense-Strafe war keineswegs die erste Konfrontation zwischen Google und den europäischen Wettbewerbshütern. Sie stellte vielmehr die dritte große Kartellstrafe dar, die die EU-Kommission innerhalb von drei Jahren gegen den Technologieriesen verhängt hatte.
2017: Der Google-Shopping-Fall
Der erste bedeutende Fall betraf Googles Preisvergleichsdienst Google Shopping. Im Juni 2017 verhängte die Kommission eine Geldbuße von 2,42 Milliarden Euro gegen Google, weil das Unternehmen seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen bevorzugt hatte. Der Kern des Problems lag darin, dass Google seinen Algorithmus, der die Rangfolge von Suchergebnissen nach Relevanz festlegt, nicht für Google Shopping benutzte. Stattdessen wurden die Ergebnisse des eigenen Dienstes systematisch an die Spitze der Suchergebnisse gesetzt, während Konkurrenzangebote weiter unten erschienen.
Diese Praxis führte nach Ansicht der Kommission zu einer erheblichen Benachteiligung von Wettbewerbern und schränkte die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher ein. Google argumentierte zwar, dass die Bevorzugung des eigenen Dienstes Teil einer Strategie zur Verbesserung des Nutzererlebnisses sei, konnte die Kommission damit jedoch nicht überzeugen.
Besonders bemerkenswert ist, dass der Europäische Gerichtshof erst kürzlich, am 10. September 2024, die Entscheidung der Kommission in diesem Fall bestätigte. Die Richter unterstützten die Auffassung, dass Google seine Marktmacht missbraucht habe, indem auf der Seite für allgemeine Suchergebnisse die Resultate des eigenen Preisvergleichsdiensts gegenüber denen der Konkurrenz bevorzugt worden seien.
2018: Der Android-Fall
Der zweite große Fall drehte sich um Googles Mobilbetriebssystem Android, das auf etwa 85 Prozent aller mobilen Internetgeräte weltweit läuft. Im Juli 2018 verhängte die EU-Kommission eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google wegen illegaler Praktiken bei diesem Betriebssystem.
Die Kommission beanstandete dabei mehrere Aspekte von Googles Geschäftsmodell. Zunächst stellte Google sein Betriebssystem den Geräteherstellern zwar kostenlos zur Verfügung, knüpfte daran jedoch bestimmte Bedingungen. Besonders problematisch war die Verpflichtung, ganze Google-Programmpakete zu installieren, wenn Hersteller ihre Geräte mit bestimmten Google-Anwendungen, insbesondere dem Internetbrowser Chrome, ausstatten wollten.
Diese Praxis führte nach Ansicht der Kommission dazu, dass Google seine Marktmacht vergrößerte und sowohl die Auswahl der Kunden als auch den Wettbewerb einschränkte. Margrethe Vestager argumentierte, dass das Betriebssystem als Hilfsmittel gedient habe, um die gesamte Internetnutzung der Besitzer von Android-Geräten durch Googles Suchmaschine zu lenken und damit die eigene Dominanz zu zementieren.
Im Jahr 2022 reduzierte das Gericht der Europäischen Union die Strafe geringfügig auf 4,125 Milliarden Euro, bestätigte jedoch im Wesentlichen die Argumentation der Kommission. Google legte gegen diese Entscheidung Berufung ein, die derzeit noch beim Europäischen Gerichtshof anhängig ist.
Die Auswirkungen der Kartellstrafen auf Google
Die insgesamt acht Milliarden Euro an Geldbußen, die die EU-Kommission gegen Google verhängt hat, mögen auf den ersten Blick beeindruckend erscheinen. Für einen Konzern mit einem jährlichen Umsatz von über 280 Milliarden US-Dollar (Stand 2023) stellen sie jedoch keine existenzielle Bedrohung dar. Google konnte diese finanziellen Belastungen dank seines boomenden Online-Werbegeschäfts relativ schnell verkraften.
Dennoch haben die Kartellverfahren durchaus spürbare Auswirkungen auf Googles Geschäftsmodell gehabt. In allen drei Fällen musste das Unternehmen Änderungen an seinen Praktiken vornehmen. Im Fall von Google Shopping wurden Konkurrenzangebote sichtbarer in den Suchergebnissen platziert. Bei Android lockerte Google die Bedingungen für Gerätehersteller und erlaubte mehr Flexibilität bei der Installation von Anwendungen. Und auch im Fall von AdSense hatte Google bereits vor der endgültigen Entscheidung der Kommission im Jahr 2016 die umstrittenen Vertragsklauseln entfernt oder geändert.
Diese erzwungenen Anpassungen zeigen, dass die Kartellverfahren trotz der finanziellen Verkraftbarkeit der Strafen durchaus einen Einfluss auf die Geschäftspraktiken des Technologieriesen haben. Sie haben dazu beigetragen, den Wettbewerb in bestimmten Bereichen zu fördern und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher zu erweitern.
Die Rolle der EU-Kommission bei der Regulierung von Technologieunternehmen
Der Kampf der EU-Kommission gegen Wettbewerbsverzerrungen durch Google ist Teil einer breiteren Strategie zur Regulierung großer Technologieunternehmen. In Brüssel wird seit Jahren darum gerungen, wie man verhindern kann, dass wenige Konzerne die digitale Wirtschaft dominieren und den Wettbewerb behindern.
Eine zentrale Figur in diesem Kampf war Margrethe Vestager, die von 2014 bis 2019 als EU-Wettbewerbskommissarin und später als Exekutiv-Vizepräsidentin für ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist, fungierte. Unter ihrer Führung ging die Kommission nicht nur gegen Google, sondern auch gegen andere Technologieriesen wie Apple, Amazon und Facebook (jetzt Meta) vor. Der Fokus lag dabei auf drei Hauptbereichen: wettbewerbswidriges Verhalten, Steuerumgehung und Missbrauch der Privatsphäre der Nutzer.
Neben der Verhängung von Geldbußen hat die EU auch neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, um die Dominanz großer Online-Plattformen einzudämmen. Besonders hervorzuheben ist der Digital Markets Act (DMA), der im Jahr 2022 verabschiedet wurde und seit 2023 in Kraft ist. Dieses Gesetz zielt darauf ab, unfaire Geschäftspraktiken von sogenannten Gatekeepern – den größten und mächtigsten digitalen Plattformen – zu verhindern und den Wettbewerb im digitalen Sektor zu fördern.
Der DMA verbietet bestimmte Praktiken, die von der Kommission in den Kartellverfahren gegen Google und andere Unternehmen als problematisch identifiziert wurden. Dazu gehören unter anderem die Selbstbevorzugung eigener Dienste, die Nutzung von Daten von gewerblichen Nutzern für den eigenen Wettbewerb und die Verhinderung der Deinstallation vorinstallierter Anwendungen.
Die Kritik an der EU-Kartellpolitik
Die aggressive Kartellpolitik der EU gegenüber Technologieunternehmen hat jedoch auch Kritik hervorgerufen. Einige argumentieren, dass Europa innovationsfeindlich sei und durch übermäßige Regulierung den technologischen Fortschritt behindere. Andere sehen in den Maßnahmen gegen vorwiegend amerikanische Unternehmen einen versteckten Protektionismus.
Google selbst hat die Entscheidungen der Kommission wiederholt angefochten und argumentiert, dass seine Praktiken den Wettbewerb förderten, nicht behinderten. Nach der Verhängung der Android-Strafe erklärte ein Google-Sprecher, dass Android mehr Auswahl für alle geschaffen habe, nicht weniger. Aus Sicht des Unternehmens sind die kostenlosen Dienste und Produkte ein Vorteil für die Verbraucher, nicht ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
Befürworter der EU-Politik entgegnen jedoch, dass große Technologieunternehmen aufgrund ihrer enormen Marktmacht einer besonderen Verantwortung unterliegen. Sie argumentieren, dass Märkte nur dann effizient funktionieren können, wenn ein fairer Wettbewerb gewährleistet ist, und dass die Kommission durch ihre Eingriffe genau diesen fairen Wettbewerb schützt.
Die globalen Auswirkungen der EU-Kartellpolitik
Die Kartellentscheidungen der EU haben Auswirkungen weit über die Grenzen Europas hinaus. Da viele Technologieunternehmen global agieren, führen Änderungen an ihren Geschäftsmodellen in Europa oft zu weltweiten Anpassungen. Dies wird als “Brüssel-Effekt” bezeichnet – die Fähigkeit der EU, durch ihre Regulierungen globale Standards zu setzen.
Darüber hinaus haben die europäischen Maßnahmen auch Kartellbehörden in anderen Teilen der Welt inspiriert. In den Vereinigten Staaten, lange Zeit zurückhaltend bei der Regulierung von Technologieunternehmen, hat sich die Stimmung in den letzten Jahren gewandelt. Sowohl die Federal Trade Commission als auch das Justizministerium haben Untersuchungen gegen Google, Amazon, Apple und Facebook eingeleitet. Auch in Ländern wie Australien, Japan und Südkorea wurden ähnliche Initiativen gestartet.
Diese globale Konvergenz in der Kartellpolitik deutet darauf hin, dass die von der EU angestoßenen Debatten über die Marktmacht großer Technologieunternehmen zunehmend als berechtigte Anliegen angesehen werden, die über politische und geografische Grenzen hinweg relevant sind.
Die Zukunft der Auseinandersetzung zwischen Google und der EU
Die Entscheidung des EuG, die AdSense-Strafe aufzuheben, markiert einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen Auseinandersetzung zwischen Google und der EU, aber sie bedeutet keineswegs das Ende des Konflikts. Wie Sarah Blazek, Partnerin der Kanzlei Noerr, anmerkt, stellt das Gericht klar, dass auch im Falle von Big Tech keine eigenen Maßstäbe anzulegen sind. Die Kommission muss alle relevanten Umstände berücksichtigen und handwerklich sauber arbeiten.
Dennoch ist zu erwarten, dass die Kommission an ihrem Konfrontationskurs gegen die großen Technologieunternehmen festhalten wird. Der Digital Markets Act bietet ihr dafür neue Instrumente, die über das traditionelle Kartellrecht hinausgehen und präventiv gegen potenzielle Wettbewerbsverzerrungen vorgehen.
Für Google und andere Technologieunternehmen bedeutet dies, dass sie sich weiterhin mit einer strengen regulatorischen Aufsicht in Europa auseinandersetzen müssen. Sie werden ihre Geschäftsmodelle möglicherweise noch stärker anpassen müssen, um den europäischen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Herausforderung für die EU besteht darin, einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der einerseits den fairen Wettbewerb und die Rechte der Verbraucher schützt, andererseits aber auch Raum für Innovation und Wachstum lässt. Die Entscheidungen in den Google-Fällen zeigen, dass dies ein schwieriger Balanceakt ist, der ständiger Überprüfung und Anpassung bedarf.
Die breitere Bedeutung des Konflikts für die digitale Wirtschaft
Die Auseinandersetzung zwischen Google und der EU-Kommission wirft grundlegende Fragen über die Natur der digitalen Wirtschaft und die angemessene Rolle der Regulierung in diesem Bereich auf. Digitale Märkte weisen besondere Eigenschaften auf, die sie von traditionellen Märkten unterscheiden, wie etwa Netzwerkeffekte, die zur Konzentration von Marktmacht führen können, oder die zentrale Rolle von Daten als Wettbewerbsfaktor.
Diese Besonderheiten stellen die herkömmlichen Instrumente des Kartellrechts vor Herausforderungen. Die EU hat darauf mit einer Kombination aus traditionellen Kartellverfahren und neuen regulatorischen Ansätzen wie dem Digital Markets Act reagiert. Der Fall Google zeigt jedoch, dass auch dieser Ansatz nicht ohne Schwierigkeiten ist und dass die Gerichte eine wichtige Rolle als Korrektiv spielen.
Für Unternehmen, insbesondere Start-ups und mittelständische Betriebe, die im digitalen Bereich tätig sind, schafft die Regulierung von Gatekeepern wie Google potenziell neue Chancen. Wenn die dominanten Plattformen daran gehindert werden, ihre Marktmacht zu missbrauchen, könnte dies zu einem offeneren und dynamischeren digitalen Ökosystem führen.
Der Kampf um fairen Wettbewerb in der digitalen Wirtschaft Europas
Die Geschichte der EU-Kartellverfahren gegen Google spiegelt den größeren Konflikt zwischen der wachsenden Marktmacht globaler Technologieunternehmen und dem Bestreben der Regulierungsbehörden wider, einen fairen Wettbewerb und den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten. Die jüngste Entscheidung des EuG im AdSense-Fall zeigt, dass dieser Konflikt komplex ist und keine einfachen Lösungen bietet.
Die 1,49 Milliarden Euro Strafe, die zunächst verhängt und später aufgehoben wurde, ist Teil eines größeren Musters von Auseinandersetzungen, die auch die Fälle Google Shopping und Android umfassen. Zusammen haben diese Fälle nicht nur zu erheblichen finanziellen Strafen geführt, sondern auch zu Änderungen in Googles Geschäftspraktiken und zur Entwicklung neuer regulatorischer Rahmen wie dem Digital Markets Act.
Während die EU-Kommission ihre Bemühungen fortsetzt, die Marktmacht großer Technologieunternehmen einzudämmen, müssen diese Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen und neue Wege finden, um im Einklang mit den europäischen Regeln zu operieren. Gleichzeitig müssen die Regulierungsbehörden darauf achten, dass ihre Maßnahmen nicht die Innovation hemmen oder unbeabsichtigt die Verbraucher schädigen.
Die Entscheidungen der europäischen Gerichte in diesen Fällen tragen dazu bei, ein Gleichgewicht zu finden und sicherzustellen, dass die Regulierung auf einer soliden rechtlichen Grundlage steht. Sie erinnern uns daran, dass der Schutz des Wettbewerbs ein fortlaufender Prozess ist, der ständiger Anpassung und Überprüfung bedarf, insbesondere in einer sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.