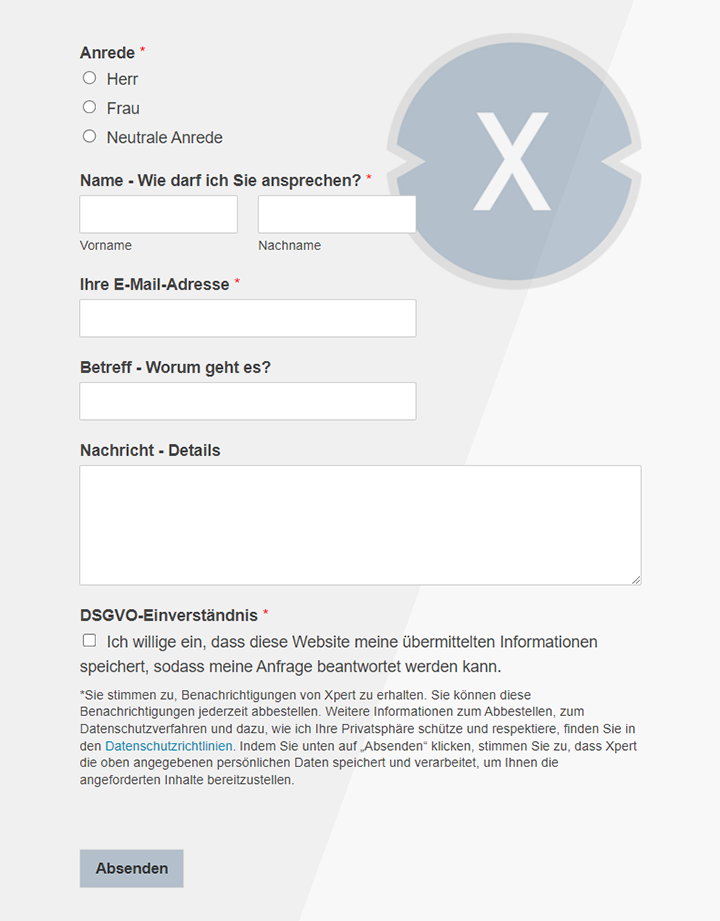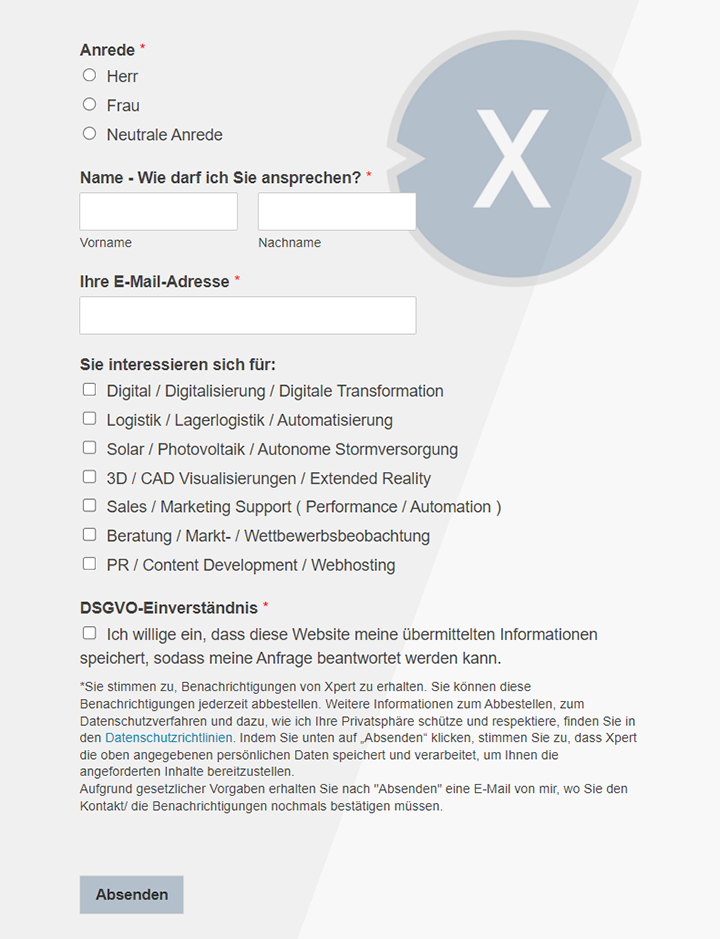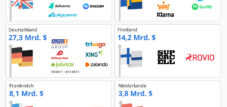Europas Weg zur technologischen Souveränität durch KI-basierte Automatisierung: Eine Analyse der KIRO 2024-Empfehlungen
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 25. Februar 2025 / Update vom: 25. Februar 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Europas Weg zur technologischen Souveränität durch KI-basierte Automatisierung: Eine Analyse der KIRO 2024-Empfehlungen – Bild: Xpert.Digital
KIRO-Strategie: Europas Weg zur Führungsrolle in KI und Robotik
KIRO-Strategie: Europas Weg zur Führungsrolle in KI und Robotik
Die im Juni 2024 publizierten Empfehlungen der KIRO (Künstliche Intelligenz und Robotik) markieren einen Wendepunkt in der europäischen Technologiepolitik. Hervorgegangen aus einer hochrangigen Konferenz unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), formulieren diese Empfehlungen einen umfassenden Rahmen, der darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz und Robotik nachhaltig zu sichern. Das 127-seitige Strategiepapier ist mehr als nur eine Sammlung von Vorschlägen; es ist eine detaillierte Roadmap, die industriepolitische Initiativen mit regulatorischen Innovationen verknüpft. Das übergeordnete Ziel ist ambitioniert, aber essenziell: Bis zum Jahr 2030 soll die technologische Kluft zu den führenden Nationen in diesem Bereich, allen voran China und den Vereinigten Staaten, signifikant verringert werden.
Strategische Pfeiler der KIRO 2024-Empfehlungen
Die KIRO-Empfehlungen sind in verschiedene strategische Handlungsfelder unterteilt, die ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken sollen. Diese Handlungsfelder bilden das Fundament für eine kohärente und effektive europäische KI- und Robotikstrategie.
1. Aufbau eines paneuropäischen Netzwerks von KI- und Robotik-Clustern
Ein zentraler Vorschlag der KIRO 2024 ist die Schaffung von sieben industrieübergreifenden Exzellenzclustern bis zum Jahr 2026. Diese Cluster sind als technologische Knotenpunkte konzipiert, die eine Brücke zwischen Mittel- und Osteuropa schlagen sollen. Ihre Rolle geht jedoch weit über eine reine Vernetzungsfunktion hinaus. Sie sollen zu dynamischen Innovationszentren werden, die:
Forschungsinfrastrukturen konzentrieren und gemeinsam nutzen
Der Plan sieht den Aufbau von insgesamt 20 KI-Testzentren vor. Diese Testzentren sollen keine isolierten Labore sein, sondern realitätsnahe Produktionsumgebungen abbilden. Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sollen hier die Möglichkeit erhalten, KI- und Robotik-Technologien unter realen Bedingungen zu erproben, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Diese Testzentren sollen mit modernster Hard- und Software ausgestattet werden und Expertenwissen bündeln, um Unternehmen bei der Implementierung und Optimierung von KI-Lösungen zu unterstützen. Die Konzentration von Ressourcen und Expertise in diesen Zentren soll Synergieeffekte freisetzen und den Wissenstransfer beschleunigen.
KMU-Integration aktiv fördern
Ein entscheidender Aspekt der Clusterstrategie ist die gezielte Einbindung von KMU. Die Empfehlungen sehen ein “Plug-and-Play”-Modell für KI-Module in bestehende Automatisierungslösungen vor. Dieses Modell soll es KMU erleichtern, KI-Technologien in ihre bestehenden Produktionsprozesse zu integrieren, ohne komplexe und kostspielige Neuentwicklungen durchführen zu müssen. Durch standardisierte Schnittstellen und modulare Architekturen sollen KI-Lösungen zugänglicher und anpassbarer werden. Zusätzlich zu technischen Lösungen sind auch Beratungs- und Unterstützungsangebote für KMU geplant, um sie bei der Identifizierung von Anwendungsfällen, der Auswahl geeigneter Technologien und der Schulung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.
Europäische Standards setzen und vorantreiben
Die KIRO-Empfehlungen betonen die Notwendigkeit, europäische Standards für KI-gestützte Robotiksysteme zu entwickeln. Bis zum dritten Quartal 2025 soll ein europäisches Gütesiegel etabliert werden, das Qualität, Sicherheit und ethische Aspekte von KI-Robotik-Produkten und -Systemen zertifiziert. Dieses Gütesiegel soll nicht nur als Qualitätsmerkmal für europäische Produkte dienen, sondern auch als Grundlage für eine harmonisierte europäische Regulierung in diesem Bereich. Die Entwicklung von Standards ist entscheidend, um Interoperabilität zu gewährleisten, Marktzugangsbarrieren abzubauen und das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen in KI-Technologien zu stärken. Die europäische Standardisierung soll auch dazu beitragen, globale Standards mitzugestalten und europäische Werte und Normen in der Entwicklung und Anwendung von KI- und Robotik-Technologien weltweit zu verankern.
Ein konkretes Beispiel für eine bereits existierende Initiative, die in diese Richtung weist, ist das im Jahr 2024 gestartete “RoX”-Ökosystem (Robotics X.0). Dieses Netzwerk verbindet bereits über 300 Industriepartner und 47 Forschungseinrichtungen und demonstriert das Potenzial von branchenübergreifender Zusammenarbeit und Wissensaustausch im Bereich der Robotik und Automatisierung. RoX dient als Blaupause und Inspiration für den Aufbau der geplanten KIRO-Cluster.
2. Beschleunigung des Technologietransfers von der Forschung in die Anwendung
Die KIRO-Empfehlungen analysieren die Geschwindigkeit des Technologietransfers in Europa und stellen fest, dass es durchschnittlich 5,2 Jahre dauert, bis KI- und Robotik-Innovationen in Europa Marktreife erlangen. Im Vergleich dazu dauert dieser Prozess in China nur 2,8 Jahre. Diese Diskrepanz gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Um den Technologietransfer zu beschleunigen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
Reform des Patentrechts zugunsten von KI-Innovationen
Die Empfehlungen fordern die Einführung eines “Fast-Track”-Patentsystems speziell für KI-basierte Automatisierungslösungen. Dieses beschleunigte Verfahren soll es Innovatoren ermöglichen, ihre Erfindungen schneller zu schützen und somit den Innovationszyklus zu verkürzen. Die Komplexität von KI-Patenten erfordert zudem spezialisierte Expertise in den Patentämtern. Daher wird vorgeschlagen, spezielle KI-Expertenteams innerhalb der Patentämter zu etablieren, die über das notwendige Fachwissen verfügen, um KI-Patentanmeldungen effizient und sachgerecht zu prüfen. Eine Reform des Patentrechts soll auch Anreize für Open-Source-Innovationen schaffen und die Verbreitung von KI-Technologien fördern, ohne den Schutz geistigen Eigentums zu vernachlässigen.
Steuerliche Anreize für Forschungskooperationen
Um die Zusammenarbeit zwischen KMU und Forschungseinrichtungen zu intensivieren, wird eine Forschungsprämie von 150 % für KMU-Kooperationen vorgeschlagen. Diese steuerliche Förderung soll es für KMU attraktiver machen, in Forschung und Entwicklung im Bereich KI und Robotik zu investieren und von der Expertise der Forschungseinrichtungen zu profitieren. Die Forschungsprämie soll nicht nur direkte Forschungskosten abdecken, sondern auch indirekte Kosten wie Personalkosten und Investitionen in Forschungsinfrastruktur berücksichtigen. Die Förderung soll unbürokratisch und einfach zugänglich sein, um KMU nicht mit administrativen Hürden zu belasten. Langfristig soll diese Maßnahme zu einer stärkeren Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft führen und den Innovationsstandort Europa stärken.
Venture Capital-Offensive für KI und Robotik
Der Zugang zu Risikokapital ist für Start-ups und innovative Unternehmen im Bereich KI und Robotik von entscheidender Bedeutung. Die KIRO-Empfehlungen setzen das Ziel, bis zum Jahr 2027 privates Risikokapital in Höhe von 20 Milliarden Euro zu mobilisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine staatliche Absicherung von Risikokapitalfonds vorgeschlagen. Diese staatliche Garantie soll das Risiko für private Investoren reduzieren und sie ermutigen, in KI- und Robotik-Start-ups zu investieren. Die Venture Capital-Offensive soll sich nicht nur auf Frühphasenfinanzierung konzentrieren, sondern auch Wachstumsfinanzierung für Unternehmen in späteren Entwicklungsstadien umfassen. Zusätzlich zu finanziellen Anreizen sind auch Maßnahmen zur Verbesserung des Investitionsklimas in Europa geplant, wie z.B. die Vereinfachung von Unternehmensgründungen und die Reduzierung bürokratischer Hürden für Investoren.
Ein positives Beispiel für erfolgreichen Technologietransfer ist das deutsche Transferzentrum ZEN-MRI. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat ZEN-MRI bereits 17 KI- und Robotik-Start-ups erfolgreich zur Marktreife geführt. Dieses Zentrum dient als Vorbild für weitere Initiativen und zeigt, wie gezielte Unterstützung und Expertise den Weg von der Forschung zur kommerziellen Anwendung ebnen können.
Synergien mit dem EU AI Act und bestehenden Initiativen
Die KIRO 2024-Empfehlungen sind eng mit dem risikobasierten Ansatz der EU-KI-Verordnung (Art. 5-9 KI-VO) verzahnt. Sie greifen diesen Ansatz auf und erweitern ihn um spezifische Kriterien für den Produktionssektor. Für Industrieroboter der Risikoklasse III wird beispielsweise eine verpflichtende “KI-Audit-Pflicht” alle 24 Monate gefordert. Diese Audits sollen nicht nur die technische Sicherheit der Systeme überprüfen, sondern auch ethische Aspekte berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf autonome Entscheidungsalgorithmen. Die KIRO-Empfehlungen tragen somit dazu bei, die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen von KI-Technologien in der Produktion zu adressieren und sicherzustellen, dass der Einsatz von KI verantwortungsvoll und im Einklang mit europäischen Werten erfolgt.
Gleichzeitig integrieren die Empfehlungen zentrale Elemente des VDMA-Aktionsplans Robotik. Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) hat bereits eine umfassende Strategie für die Robotik in Deutschland entwickelt. Die KIRO-Empfehlungen nehmen diese Strategie auf und erweitern sie auf europäischer Ebene. Konkrete Ziele, die aus dem VDMA-Aktionsplan übernommen und in den KIRO-Empfehlungen bekräftigt werden, sind:
Erhöhung der Roboterdichte
Das Ziel ist eine Steigerung der Roboterdichte von 219 auf 350 Roboter pro 10.000 Beschäftigte in der Fertigungsindustrie bis zum Jahr 2030. Die Roboterdichte gilt als wichtiger Indikator für den Automatisierungsgrad und die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Durch die Erhöhung der Roboterdichte soll die Produktivität gesteigert, die Produktionskosten gesenkt und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die KIRO-Empfehlungen sehen verschiedene Maßnahmen vor, um dieses Ziel zu erreichen, darunter Investitionsförderung, Technologieberatung und Qualifizierungsmaßnahmen.
Reduktion der Energiekosten in der Produktion
Die Empfehlungen schlagen die Subventionierung von KI-optimierten Produktionsanlagen auf 0,08 €/kWh vor. Energieeffizienz ist ein zentrales Thema für die europäische Industrie, sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen. KI-Technologien bieten erhebliche Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz in Produktionsprozessen. Durch intelligente Steuerung und Optimierung können Energieverbräuche reduziert und Ressourcen geschont werden. Die Subventionierung von KI-optimierten Anlagen soll Anreize für Unternehmen schaffen, in energieeffiziente Technologien zu investieren und somit einen Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaziele zu leisten.
Verdopplung der öffentlichen Forschungsmittel
Die KIRO-Empfehlungen fordern eine Verdopplung der öffentlichen Mittel für die Forschung im Bereich KI und Robotik auf 500 Millionen Euro pro Jahr ab dem Jahr 2026. Eine starke Forschungsbasis ist die Grundlage für technologische Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die Erhöhung der Forschungsmittel soll es ermöglichen, grundlegende und angewandte Forschung im Bereich KI und Robotik voranzutreiben, neue Technologien zu entwickeln und hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden. Die Forschungsförderung soll sowohl öffentliche Forschungseinrichtungen als auch private Unternehmen umfassen und sich auf strategische Schwerpunktthemen konzentrieren, die für die europäische Industrie von besonderer Bedeutung sind.
Technologische Schwerpunkte und Anwendungsfälle
Die KIRO-Empfehlungen identifizieren spezifische technologische Schwerpunkte und Anwendungsfälle, die für die zukünftige Entwicklung der KI-basierten Automatisierung in Europa von zentraler Bedeutung sind.
1. Autonome KI-Agenten in der Produktion
Selbstlernende Robotersteuerungen werden als Schlüsseltechnologie für die Industrie der Zukunft identifiziert. Die Empfehlungen sehen gezielte Fördermaßnahmen in folgenden Bereichen vor:
Generative KI für Bewegungsplanung
Der Einsatz von Large Language Models (LLMs) zur Echtzeit-Anpassung von Roboterpfaden soll gefördert werden. Generative KI-Modelle haben das Potenzial, die Programmierung von Robotern zu revolutionieren. Anstatt Roboterbewegungen mühsam manuell zu programmieren, können generative KI-Modelle Roboterpfade in Echtzeit generieren und an sich ändernde Umgebungsbedingungen anpassen. Dies ermöglicht flexiblere und effizientere Produktionsprozesse, insbesondere in Umgebungen mit hoher Variabilität und geringen Losgrößen.
Multi-Agenten-Systeme
Die Vernetzung von mindestens 5 Robotern mit dezentraler Entscheidungslogik wird als Zielmarke definiert. In komplexen Produktionsumgebungen ist die Zusammenarbeit von mehreren Robotern oft erforderlich. Multi-Agenten-Systeme ermöglichen es Robotern, autonom miteinander zu kommunizieren, Aufgaben zu koordinieren und Entscheidungen dezentral zu treffen. Dies führt zu robusteren und flexibleren Produktionssystemen, die sich dynamisch an veränderte Anforderungen anpassen können. Die KIRO-Empfehlungen sehen die Förderung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich vor, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Multi-Agenten-Systemen in der Produktion zu verbessern.
Embodied AI
Das Hardware-Software-Co-Design für energieeffiziente KI-Chips in Robotikcontrollern wird als wichtiger Innovationsbereich hervorgehoben. KI-Anwendungen in der Robotik erfordern erhebliche Rechenleistung. Herkömmliche Computerarchitekturen sind oft ineffizient und energiehungrig für Echtzeitanwendungen in der Robotik. Embodied AI verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Hardware und Software von Anfang an gemeinsam entwickelt werden, um energieeffiziente und leistungsstarke KI-Chips für Robotikcontroller zu schaffen. Dies ist besonders wichtig für mobile Roboter und Anwendungen in ressourcenbeschränkten Umgebungen.
Ein Pilotprojekt bei KUKA, einem führenden Roboterhersteller, hat bereits gezeigt, dass durch KI-generierte Programmcodes Taktzeitverkürzungen von bis zu 37 % erreicht werden können. Dieses Beispiel verdeutlicht das enorme Potenzial von autonomen KI-Agenten zur Steigerung der Effizienz und Flexibilität in der Produktion.
2. Mensch-Maschine-Kollaboration 4.0
Für assistive Robotik in der Pflege und Montage werden spezifische Maßnahmen zur Förderung der Mensch-Maschine-Kollaboration 4.0 vorgeschlagen:
Emotionale KI-Interfaces
Die Integration von Affective Computing in 30 % aller Serviceroboter bis zum Jahr 2027 wird angestrebt. Serviceroboter, die in direkter Interaktion mit Menschen arbeiten, müssen in der Lage sein, menschliche Emotionen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Affective Computing befasst sich mit der Entwicklung von KI-Systemen, die Emotionen erkennen, interpretieren und ausdrücken können. Die Integration von emotionaler KI in Serviceroboter soll die Akzeptanz und das Vertrauen der Menschen in diese Technologien erhöhen und die Mensch-Maschine-Interaktion intuitiver und angenehmer gestalten.
Adaptive Sicherheitssysteme
ML-basierte Kollisionsvermeidung mit einer Reaktionszeit von <50 ms wird als technologische Anforderung definiert. In der Mensch-Roboter-Kollaboration ist Sicherheit von höchster Priorität. Adaptive Sicherheitssysteme, die auf maschinellem Lernen basieren, können die Umgebung in Echtzeit analysieren und das Verhalten des Roboters dynamisch anpassen, um Kollisionen zu vermeiden. Eine Reaktionszeit von weniger als 50 Millisekunden ist entscheidend, um die Sicherheit in dynamischen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten, in denen sich Menschen und Roboter den Arbeitsraum teilen.
Skill-Transfer-Plattformen
AR-gestütztes Training von Robotern durch Facharbeiter soll gefördert werden. Die Programmierung und Bedienung von Robotern erfordert spezialisiertes Fachwissen. AR-gestützte Trainingsplattformen können Facharbeiter befähigen, Roboter intuitiv und effizient zu trainieren, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen. Durch Augmented Reality (AR) werden virtuelle Elemente in die reale Welt eingeblendet, um den Lernprozess zu unterstützen und komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen. Skill-Transfer-Plattformen tragen dazu bei, den Fachkräftemangel im Bereich Robotik zu begegnen und die Akzeptanz von Robotern in der Arbeitswelt zu erhöhen.
Das BMBF-geförderte Projekt “RA3” hat bereits demonstriert, dass durch den Einsatz von Skill-Transfer-Plattformen eine Reduktion der Einlernzeiten von Robotern um bis zu 63 % möglich ist. Dieses Ergebnis unterstreicht das Potenzial von Mensch-Maschine-Kollaboration 4.0 zur Steigerung der Effizienz und Flexibilität in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Ökonomische und bildungspolitische Implikationen
Die KIRO-Empfehlungen haben weitreichende ökonomische und bildungspolitische Implikationen, die über den reinen Technologiebereich hinausgehen.
1. Arbeitsmarkttransformation und Qualifizierung
Die Empfehlungen prognostizieren einen Nettozuwachs von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2030, der jedoch eng mit umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen verbunden ist. Um die Arbeitsmarkttransformation erfolgreich zu gestalten, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
KI-Zertifizierungspflicht für technische Berufe
Für 75 % der technischen Berufe soll bis zum Jahr 2028 eine KI-Zertifizierungspflicht eingeführt werden. Die rasante Verbreitung von KI-Technologien erfordert neue Kompetenzen und Qualifikationen in vielen Berufsfeldern. Eine KI-Zertifizierungspflicht soll sicherstellen, dass Fachkräfte über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um mit KI-Systemen umzugehen und die Potenziale von KI-Technologien in ihren jeweiligen Berufsfeldern zu nutzen. Die Zertifizierung soll modulartig aufgebaut sein und verschiedene Kompetenzniveaus abdecken, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Berufe gerecht zu werden.
Modulare Weiterbildung mit Micro-Degrees
Die Einführung von 40 “Micro-Degrees” in KI und Robotik an Berufsschulen wird angestrebt. Modulare Weiterbildungsprogramme mit Micro-Degrees ermöglichen es, sich flexibel und bedarfsgerecht in spezifischen Bereichen von KI und Robotik weiterzubilden. Diese kurzen, fokussierten Kurse sind ideal für Berufstätige, die ihre Kompetenzen schnell und effizient erweitern möchten, ohne ein langwieriges Studium absolvieren zu müssen. Die Micro-Degrees sollen in enger Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die vermittelten Inhalte den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen.
Ethische KI-Zertifizierung für Ingenieurstudiengänge
Verpflichtende Curricula zur ethischen KI-Zertifizierung für Ingenieurstudiengänge ab dem Wintersemester 2025/26 sind geplant. Ingenieure spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Implementierung von KI-Technologien. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass sie nicht nur über technische Kompetenzen verfügen, sondern auch über ein ausgeprägtes ethisches Bewusstsein und die Fähigkeit, die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit zu reflektieren. Verpflichtende Curricula zur ethischen KI-Zertifizierung sollen sicherstellen, dass zukünftige Ingenieure in der Lage sind, KI-Technologien verantwortungsvoll und im Einklang mit ethischen Prinzipien zu entwickeln und einzusetzen.
2. Industrielle Wertschöpfungsketten und Produktivität
Modellrechnungen zeigen, dass die Umsetzung der KIRO-Empfehlungen bis zum Jahr 2030 erhebliche positive Effekte auf die industrielle Wertschöpfung in Europa haben könnte:
Produktivitätssteigerung in der Automobilindustrie
Eine Produktivitätssteigerung von +14 % in der Automobilindustrie durch KI-optimierte Logistikroboter wird erwartet. Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Europa, der stark von Automatisierung und Robotik geprägt ist. KI-optimierte Logistikroboter haben das Potenzial, die Effizienz und Flexibilität der Produktionsprozesse in der Automobilindustrie erheblich zu verbessern. Durch intelligente Steuerung und Optimierung können Materialflüsse optimiert, Durchlaufzeiten verkürzt und Lagerkosten gesenkt werden.
Erhöhung der Energieeffizienz in der Fertigung
Eine Reduktion des Stromverbrauchs um 23 % bei KI-gesteuerten Montageanlagen wird prognostiziert. Energieeffizienz ist ein zentrales Thema für die Fertigungsindustrie. KI-gesteuerte Montageanlagen können den Energieverbrauch optimieren, indem sie Produktionsprozesse intelligenter steuern und unnötige Energieverluste vermeiden. Dies trägt nicht nur zur Senkung der Betriebskosten bei, sondern auch zur Reduzierung der Umweltbelastung durch die Industrie.
Ressourceneinsparung durch prädiktive KI-Steuerungen
Eine Reduktion des Materialverlusts um 18 % durch prädiktive KI-Steuerungen wird erwartet. Prädiktive KI-Steuerungen können Produktionsprozesse in Echtzeit überwachen und Anomalien oder potenzielle Fehler frühzeitig erkennen. Dadurch können Materialverluste reduziert, die Produktqualität verbessert und Ausschussquoten gesenkt werden. Ressourceneinsparung ist nicht nur aus ökonomischer Sicht relevant, sondern auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Herausforderungen und kritische Erfolgsfaktoren
Trotz des ambitionierten Ziels, Europas Marktanteil bei Industrierobotern von 32 % auf 45 % bis zum Jahr 2030 zu steigern, identifizieren die KIRO-Empfehlungen vier zentrale Herausforderungen, die für den Erfolg der Strategie entscheidend sind:
1. Regulatorische Fragmentierung
Unterschiedliche KI-Zertifizierungsverfahren in 14 EU-Mitgliedstaaten erschweren den Marktzugang und die Skalierung von KI-Lösungen. Eine harmonisierte europäische Regulierung im Bereich KI und Robotik ist unerlässlich, um einen Binnenmarkt für KI-Produkte und -Dienstleistungen zu schaffen und Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen zu vermeiden. Die KIRO-Empfehlungen fordern eine verstärkte Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und Implementierung von KI-Standards und -Zertifizierungsverfahren.
2. Datenverfügbarkeit
Nur 38 % der produzierenden KMU nutzen industrialisierte Datenpools. Daten sind der Treibstoff für KI-Systeme. Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten ist entscheidend für die Entwicklung und Anwendung leistungsfähiger KI-Lösungen. Die KIRO-Empfehlungen betonen die Notwendigkeit, den Zugang zu Daten für KMU zu verbessern und die Nutzung von Datenpools zu fördern. Dies erfordert Maßnahmen zur Schaffung von Dateninfrastrukturen, zur Standardisierung von Datenschnittstellen und zur Förderung des Datenaustauschs zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.
3. Cybersicherheit
57 % der KI-Robotiksysteme verfügen nicht über ein Echtzeit-Monitoring für Angriffserkennung. Cybersecurity ist ein zunehmend wichtiges Thema im Bereich der industriellen Automatisierung. KI-Robotiksysteme sind potenzielle Ziele für Cyberangriffe, die zu Produktionsausfällen, Datendiebstahl oder Sabotage führen können. Die KIRO-Empfehlungen fordern die Stärkung der Cybersecurity in KI-Robotiksystemen und die Entwicklung von Echtzeit-Monitoring-Systemen zur Angriffserkennung. Dies erfordert Investitionen in Cybersecurity-Technologien, die Entwicklung von Sicherheitsstandards und die Sensibilisierung von Unternehmen für das Thema Cybersecurity.
4. Akzeptanzlücke
42 % der Beschäftigten sind skeptisch gegenüber KI-Entscheidungsautonomie. Die Akzeptanz von KI-Technologien in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft insgesamt ist entscheidend für den Erfolg der KIRO-Strategie. Skeptische Einstellungen und Vorbehalte gegenüber KI-Entscheidungsautonomie können die Implementierung und den Einsatz von KI-Systemen behindern. Die KIRO-Empfehlungen betonen die Notwendigkeit, die Akzeptanz von KI-Technologien durch transparente Kommunikation, partizipative Entwicklungsprozesse und die Berücksichtigung ethischer Aspekte zu fördern. Dies erfordert einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit, die Einbindung von Arbeitnehmervertretern und die Entwicklung von KI-Systemen, die den Bedürfnissen und Werten der Menschen entsprechen.
Als Lösungsansätze für diese Herausforderungen werden unter anderem vorgeschlagen:
Europäisches Robotics GPAI (General Purpose AI)
Eine Open-Source-Plattform für KMU soll den Zugang zu KI-Technologien erleichtern und die Entwicklung eigener KI-Lösungen ermöglichen. Die Plattform soll standardisierte KI-Module, Tools und Ressourcen bereitstellen, die KMU nutzen können, um KI-Anwendungen in ihren Produktionsprozessen zu implementieren. Die Open-Source-Natur der Plattform soll Innovation und Zusammenarbeit fördern und die Abhängigkeit von proprietären Technologien reduzieren.
KIRO-Sicherheitszertifikat
Eine kombinierte Prüfung von Functional Safety und Cyber-Resilienz soll ein umfassendes Sicherheitsniveau für KI-Robotiksysteme gewährleisten. Das Zertifikat soll sicherstellen, dass KI-Robotiksysteme sowohl funktional sicher sind als auch gegen Cyberangriffe geschützt sind. Die kombinierte Prüfung soll Synergieeffekte nutzen und die Effizienz der Zertifizierungsprozesse steigern. Das KIRO-Sicherheitszertifikat soll als europäischer Standard etabliert werden und das Vertrauen der Unternehmen und der Öffentlichkeit in die Sicherheit von KI-Robotiksystemen stärken.
Partizipative Entwicklung
Verpflichtende Bürgerbeteiligung bei öffentlich geförderten KI-Projekten soll die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen und sicherstellen, dass KI-Technologien im Einklang mit den Werten und Bedürfnissen der Bürger entwickelt werden. Die Bürgerbeteiligung soll in verschiedenen Phasen der Projektentwicklung erfolgen, von der Konzeption bis zur Implementierung. Durch die Einbindung der Bürger sollen Transparenz und Vertrauen geschaffen und sichergestellt werden, dass KI-Technologien zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt werden.
Implementierungsroadmap und Monitoring
Die Umsetzung der 94 Handlungsempfehlungen der KIRO 2024 folgt einem dreistufigen Plan, der einen klaren Zeitrahmen und messbare Meilensteine definiert:
Phase 1 (2025-2026)
- Einrichtung der EU-KIRO-Agentur in Brüssel mit 250 Mitarbeitern. Die Agentur soll als zentrale Koordinierungsstelle für die Umsetzung der KIRO-Empfehlungen dienen und die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten, der Industrie und der Forschung fördern. Die Agentur soll über ein Budget von 47 Millionen Euro verfügen, um erste Initiativen und Projekte zu finanzieren.
- Start des “AI-for-Robotics”-Exzellenzclusters mit einem Budget von 47 Millionen Euro. Das Cluster soll als Leuchtturmprojekt für die Clusterstrategie der KIRO-Empfehlungen dienen und die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Bereich KI und Robotik intensivieren. Das Cluster soll sich auf strategische Schwerpunktthemen konzentrieren und innovative Lösungen für die Herausforderungen der KI-basierten Automatisierung entwickeln.
- Pilotierung des KIRO-Gütesiegels in 300 Unternehmen. Die Pilotphase soll dazu dienen, das Gütesiegel in der Praxis zu testen, Feedback von Unternehmen einzuholen und das Zertifizierungsverfahren zu optimieren. Die Pilotierung soll sicherstellen, dass das Gütesiegel relevant, praktikabel und wirksam ist und von Unternehmen und Verbrauchern akzeptiert wird.
Phase 2 (2027-2028)
- Flächendeckende Einführung adaptiver KI-Curricula an Berufsschulen in der gesamten EU. Die Curricula sollen sicherstellen, dass zukünftige Fachkräfte über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um mit KI-Technologien umzugehen und die Potenziale der KI-basierten Automatisierung zu nutzen. Die flächendeckende Einführung soll dazu beitragen, den Fachkräftemangel im Bereich KI und Robotik zu be.gegnen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie im Bereich KI und Robotik zu stärken.
- Ein Marktanteil von 50 % für europäische Hersteller bei Servicerobotern soll erreicht werden. Der Markt für Serviceroboter wächst rasant und bietet erhebliche Chancen für europäische Unternehmen. Die KIRO-Empfehlungen zielen darauf ab, die europäischen Hersteller in diesem Wachstumsmarkt zu positionieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Konkurrenten zu stärken. Dies erfordert gezielte Fördermaßnahmen für Forschung und Entwicklung, Unterstützung bei der Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die Schaffung eines günstigen regulatorischen Umfelds für Serviceroboter. Die Fokussierung auf ethische Aspekte und Mensch-Maschine-Kollaboration soll dabei ein Alleinstellungsmerkmal europäischer Serviceroboter werden.
- Ein Durchbruch bei neuromorphen KI-Chips für Echtzeitsteuerungen wird erwartet. Neuromorphe Chips, die nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns arbeiten, versprechen eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und Rechenleistung im Vergleich zu herkömmlichen Computerarchitekturen. Für Echtzeitanwendungen in der Robotik, insbesondere in autonomen Systemen und in der Mensch-Maschine-Kollaboration, sind energieeffiziente und reaktionsschnelle KI-Chips von entscheidender Bedeutung. Die KIRO-Empfehlungen sehen die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich neuromorpher Chips vor, um einen technologischen Vorsprung für europäische Unternehmen in diesem zukunftsträchtigen Bereich zu sichern. Dieser Durchbruch soll die Grundlage für eine neue Generation von intelligenten und energieeffizienten Robotiksystemen legen.
Phase 3 (2029-2030)
- Die vollständige Implementierung des europäischen Robotics Data Spaces ist das erklärte Ziel. Der European Robotics Data Space soll eine sichere und vertrauenswürdige Plattform für den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Daten im Bereich Robotik schaffen. Dieser Datenraum soll es Unternehmen, Forschungseinrichtungen und anderen Akteuren ermöglichen, Daten effizient und datenschutzkonform auszutauschen, um Innovationen zu beschleunigen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Robotikindustrie zu stärken. Die Implementierung des Datenraums erfordert die Entwicklung gemeinsamer Standards, Protokolle und Governance-Modelle, um Interoperabilität und Datensicherheit zu gewährleisten.
- Eine Kostensenkung von 35 % bei KI-Robotiksystemen durch Skaleneffekte wird angestrebt. Mit zunehmender Verbreitung und Akzeptanz von KI-Robotiksystemen sollen Skaleneffekte realisiert werden, die zu einer deutlichen Senkung der Produktionskosten führen. Diese Kostensenkung soll KI-Robotiksysteme für ein breiteres Spektrum von Unternehmen, insbesondere KMU, zugänglich machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern. Die KIRO-Empfehlungen sehen Maßnahmen zur Förderung der Marktdurchdringung von KI-Robotiksystemen und zur Unterstützung von Unternehmen bei der Implementierung und Nutzung dieser Technologien vor.
- Die Etablierung Europas als Leitmarkt für ethische KI-Zertifizierung ist ein zentrales strategisches Ziel. Europa soll sich als Vorreiter für ethische und verantwortungsvolle KI-Entwicklung und -Anwendung positionieren. Die KIRO-Empfehlungen sehen die Weiterentwicklung und internationale Anerkennung des KIRO-Gütesiegels für ethische KI-Robotiksysteme vor. Dieses Gütesiegel soll nicht nur als Qualitätsmerkmal für europäische Produkte dienen, sondern auch als Grundlage für globale Standards und Normen im Bereich ethische KI. Die Etablierung Europas als Leitmarkt für ethische KI-Zertifizierung soll das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen in KI-Technologien stärken und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im globalen Markt differenzieren.
Monitoring und Fortschrittskontrolle
Ein unabhängiges Monitoring-Konsortium unter der Leitung des Fraunhofer IPA (Institut für Produktionstechnik und Automatisierung) ist mit der jährlichen Fortschrittskontrolle der Umsetzung der KIRO-Empfehlungen beauftragt. Dieses Konsortium wird regelmäßig Berichte erstellen, die den Fortschritt der Implementierung bewerten, Herausforderungen identifizieren und gegebenenfalls Anpassungen der Strategie empfehlen. Der erste Fortschrittsbericht wird im März 2026 erwartet und soll einen umfassenden Überblick über den Stand der Umsetzung der KIRO-Empfehlungen geben. Das Monitoring-Konsortium wird eng mit der EU-KIRO-Agentur, den EU-Mitgliedstaaten, der Industrie und der Forschung zusammenarbeiten, um eine transparente und objektive Bewertung des Fortschritts zu gewährleisten. Die jährlichen Fortschrittsberichte sollen als Grundlage für die Weiterentwicklung der KIRO-Strategie dienen und sicherstellen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden.
KIRO 2024 als Katalysator für Europas technologische Souveränität
Die konsequente und zügige Umsetzung der KIRO 2024-Empfehlungen birgt das Potenzial, den europäischen Anteil am globalen Markt für KI und Robotik von derzeit 19 % auf beeindruckende 31 % bis zum Jahr 2030 zu steigern. Dieser ambitionierte Aufstieg ist jedoch kein Selbstläufer, sondern erfordert eine konzertierte Kraftanstrengung aller beteiligten Akteure. Entscheidend für den Erfolg wird die Fähigkeit sein, die Synergien zwischen dem EU AI Act, der Robotikoffensive des VDMA und den KIRO-Vorgaben optimal zu nutzen und in eine kohärente europäische Strategie zu integrieren.
Initiativen wie das Robotics Institute Germany (RIG) und die geplante KIRO-Zertifizierungsagentur sind erste vielversprechende Schritte in diese Richtung. Sie schaffen institutionelle Strukturen, die es ermöglichen, Europas traditionelle Stärken in der Grundlagenforschung mit der praxisorientierten Expertise der europäischen Industrie zu verbinden. Diese Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz und industrieller Anwendungsnähe ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil Europas, der durch die KIRO-Empfehlungen weiter gestärkt werden soll.
Es wird sich zeigen, ob es Europa gelingt, aus den formulierten Empfehlungen eine tatsächlich kohärente und wirkungsvolle europäische KI- und Robotikstrategie zu formen. Diese Strategie muss nicht nur Innovationskraft und wirtschaftliches Wachstum generieren, sondern gleichzeitig auch die gesellschaftliche Akzeptanz von KI-Technologien sichern und ethische Standards in den Mittelpunkt stellen. Die KIRO 2024-Empfehlungen bieten einen vielversprechenden Fahrplan für diesen Weg. Ob Europa diesen Weg erfolgreich beschreiten wird, hängt von der Entschlossenheit und dem Engagement aller Beteiligten ab, die formulierten Ziele zu verfolgen und die notwendigen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Die technologische Souveränität Europas im Bereich KI und Robotik steht auf dem Spiel – und die KIRO 2024-Empfehlungen könnten sich als der entscheidende Katalysator erweisen, um diese Souveränität zu erreichen und langfristig zu sichern. Der Erfolg der KIRO-Initiative wird nicht nur Europas wirtschaftliche Zukunft prägen, sondern auch die globale Landschaft der Technologieentwicklung und -anwendung nachhaltig beeinflussen.
Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein
Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.
Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.
Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.
Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus