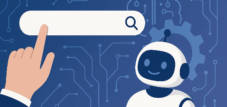Das Ende des “kostenlosen” Internets? Italiens Steuerplan schockt US-Tech-Konzerne – Kommt die EU-weite Datenbesteuerung?
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 29. Juli 2025 / Update vom: 29. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Das Ende des “kostenlosen” Internets? Italiens Steuerplan schockt US-Tech-Konzerne – Kommt die EU-weite Datenbesteuerung? – Bild: Xpert.Digital
Milliarden-Forderung: Warum Italien Umsatzsteuer auf Daten von Meta & Co. verlangt
Droht der Dominoeffekt? Italiens Vorstoß könnte die EU-weite Datenbesteuerung auslösen – Die juristischen Grundlagen des italienischen Vorstoßes
Was ist der Kern des neuen italienischen Ansatzes zur Umsatzbesteuerung digitaler Dienste?
Der Kern des italienischen Ansatzes besteht darin, die Bereitstellung personenbezogener Daten durch Nutzer an Online-Plattformen nicht als unentgeltlichen Vorgang, sondern als eine umsatzsteuerrechtlich relevante Gegenleistung zu qualifizieren. Die italienischen Finanzbehörden argumentieren, dass Nutzer für den Zugang zu scheinbar kostenlosen Diensten wie sozialen Netzwerken mit einem wirtschaftlich verwertbaren Gut bezahlen: ihren persönlichen Daten. Diese Daten werden von den Plattformen systematisch monetarisiert, vor allem durch den Verkauf gezielter Werbung.
Diese Neubewertung führt zur rechtlichen Einstufung der Beziehung zwischen Nutzer und Plattform als „tauschähnlicher Umsatz“. Nach europäischem und nationalem Umsatzsteuerrecht liegt ein solcher Umsatz vor, wenn eine Leistung nicht gegen Geld, sondern gegen eine andere Sach- oder Dienstleistung erbracht wird. Entscheidend ist, dass die Gegenleistung nicht monetär sein muss; es genügt, dass ihr ein wirtschaftlicher Wert beigemessen werden kann. In diesem Konstrukt erbringt die Plattform eine Dienstleistung (Gewährung des Zugangs und der Nutzungsmöglichkeit), während der Nutzer im Gegenzug eine eigene Leistung erbringt, die als „Duldungsleistung“ konzipiert wird. Der Nutzer duldet aktiv die Erhebung, Verarbeitung und kommerzielle Verwertung seiner Daten, was als die erforderliche Gegenleistung für den Erhalt der Plattformdienste angesehen wird.
Durch diese juristische Reklassifizierung wird das gängige Geschäftsmodell „Daten gegen Dienst“ aus dem Bereich der Nicht-Steuerbarkeit herausgelöst und in den Anwendungsbereich der allgemeinen Mehrwertsteuervorschriften überführt. Damit wird ein Vorgang, der bisher als kostenlos galt, zu einem steuerbaren wirtschaftlichen Austausch, der der regulären Umsatzsteuer unterliegt.
Auf welche fundamentalen Prinzipien des EU-Mehrwertsteuerrechts stützt sich Italien?
Der italienische Vorstoß basiert auf fundamentalen und lang etablierten Prinzipien des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems der Europäischen Union. Das zentrale Konzept ist der „Leistungsaustausch“, der die Grundvoraussetzung für die Steuerbarkeit eines Umsatzes darstellt. Ein steuerbarer Leistungsaustausch liegt vor, wenn eine Leistung gegen eine Gegenleistung (Entgelt) erbracht wird und zwischen beiden ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
Ein entscheidendes Prinzip, auf das sich Italien stützt, ist, dass die Gegenleistung nicht zwingend in Geld bestehen muss. Ein Tausch oder ein tauschähnlicher Umsatz, bei dem eine Dienstleistung mit einer anderen Dienstleistung oder einer Sachleistung vergütet wird, ist umsatzsteuerrechtlich einem Kauf gegen Geld gleichgestellt, solange der Wert der Gegenleistung in Geld ausgedrückt werden kann.
Für die Bemessung der Steuer ist dabei nicht ein objektiver Marktwert, sondern der „subjektive Wert“ maßgeblich. Das ist der Wert, den der Leistungsempfänger der erhaltenen Gegenleistung tatsächlich beimisst und den er bereit wäre, dafür aufzuwenden. Im Kontext des Datentauschs wäre dies der Wert, den die Plattform den von den Nutzern erhaltenen Daten beimisst, um im Gegenzug ihre Dienste bereitzustellen.
Schließlich ist für das Vorliegen eines Leistungsaustauschs unerheblich, ob zwischen Leistung und Gegenleistung ein ausgewogenes Wertverhältnis besteht. Selbst wenn die ausgetauschten Leistungen objektiv nicht gleichwertig sind, ändert dies nichts am Vorliegen eines steuerbaren Umsatzes. Diese Grundsätze bilden das Fundament der italienischen Argumentation, die darauf abzielt, die Bereitstellung von Nutzerdaten als vollwertige, steuerbare Gegenleistung zu etablieren.
Welche spezifischen Artikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG sind entscheidend und was besagen sie?
Die italienische Argumentation stützt sich auf mehrere Kernartikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG (MwStSystRL), die das Fundament des gemeinsamen europäischen Umsatzsteuersystems bildet.
Der wohl wichtigste Artikel ist Artikel 73 MwStSystRL. Er definiert die Bemessungsgrundlage für Lieferungen und Dienstleistungen. Demnach umfasst die Steuerbemessungsgrundlage alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der Leistende für diese Umsätze vom Leistungsempfänger oder einem Dritten erhält oder erhalten soll. Bei Tauschgeschäften, bei denen die Gegenleistung nicht in Geld besteht, impliziert dieser Artikel, dass der Wert der erhaltenen Leistung als Bemessungsgrundlage für die erbrachte Leistung dient. Italiens Position ist, dass der wirtschaftliche Wert der Nutzerdaten die Bemessungsgrundlage für die von der Plattform erbrachte Dienstleistung (den Zugang) darstellt.
Eng damit verbunden ist Artikel 72 MwStSystRL, der den allgemeinen Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer festlegt. Er definiert, wer als „Steuerpflichtiger“ gilt und stellt klar, dass Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher „gegen Entgelt“ bewirkt, der Steuer unterliegen. Die Definition des Begriffs „gegen Entgelt“ ist hierbei zentral, und Italien legt ihn so aus, dass er auch nicht-monetäre Gegenleistungen wie die Bereitstellung von Daten umfasst.
Schließlich spielt auch Artikel 80 MwStSystRL eine Rolle, wenn auch eine umstrittene. Dieser Artikel gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, bei Umsätzen zwischen „verbundenen Personen“ (z. B. innerhalb eines Konzerns) einzugreifen und als Bemessungsgrundlage den „Normalwert“ (Marktwert) anzusetzen, um Steuerhinterziehung oder -vermeidung zu verhindern. Obwohl die EU-Kommission in einem Arbeitspapier argumentiert, dass die Beziehung zwischen einer Plattform und ihren Nutzern keine solche „besondere Verbindung“ darstellt, könnte Italien diesen Artikel als rechtliche Absicherung anführen, um sicherzustellen, dass der Wert der Daten nicht willkürlich zu niedrig angesetzt wird und eine marktnahe Bewertung erfolgt.
Wie wird der für eine Besteuerung erforderliche „unmittelbare Zusammenhang“ zwischen Datenbereitstellung und Dienstleistung argumentiert?
Der „unmittelbare Zusammenhang“ ist ein zentrales Kriterium für das Vorliegen eines steuerbaren Leistungsaustauschs. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) muss ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger bestehen, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden. Die vom Leistenden empfangene Vergütung muss der tatsächliche Gegenwert für die dem Empfänger erbrachte Dienstleistung sein.
Italien argumentiert, dass dieser unmittelbare Zusammenhang im Modell „Daten gegen Dienstleistung“ eindeutig gegeben ist. Das Rechtsverhältnis wird durch die Nutzungsbedingungen (Terms of Service) begründet, denen jeder Nutzer bei der Erstellung eines Kontos zustimmen muss. Ohne diese Zustimmung wird kein Zugang zur Plattform gewährt.
Die Gegenseitigkeit und Verknüpfung der Leistungen ergibt sich aus der klaren Konditionalität: Die Plattform erbringt ihre Dienstleistung (Zugang zum Netzwerk, Nutzung der Funktionen) nur unter der Bedingung, dass der Nutzer die Gegenleistung erbringt, nämlich die Bereitstellung seiner personenbezogenen Daten und die Einwilligung in deren kommerzielle Verwertung. Es handelt sich um ein untrennbares Koppelgeschäft: keine Daten, kein Dienst. Diese zwingende Verknüpfung stellt nach italienischer Auffassung den erforderlichen unmittelbaren Zusammenhang her und macht die Datenbereitstellung zur kausalen und direkten Gegenleistung für den Plattformzugang.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des EuGH, insbesondere das Urteil in der Rechtssache Baštová (C-432/15)?
Die Rechtsprechung des EuGH, insbesondere das Urteil in der Rechtssache Baštová, spielt eine ambivalente Rolle und wird von beiden Seiten des Streits als zentrales Argument herangezogen. In diesem Fall ging es um eine Pferdebesitzerin, die ihre Pferde an Rennen teilnehmen ließ, ohne dafür ein Startgeld zu zahlen. Sie konnte jedoch Preisgelder gewinnen, wenn ihre Pferde erfolgreich platziert wurden.
Der EuGH entschied, dass die bloße Teilnahme am Rennen keine Dienstleistung gegen Entgelt darstellt, da der Erhalt einer Gegenleistung – des Preisgeldes – ungewiss war. Das Gericht stellte fest, dass die „Ungewissheit einer Zahlung geeignet ist, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der dem Leistungsempfänger erbrachten Dienstleistung und der gegebenenfalls erhaltenen Zahlung aufzuheben“. Diese Ungewissheit verhinderte das Vorliegen eines steuerbaren Leistungsaustauschs.
Für die italienischen Behörden ist dieses Urteil ein Abgrenzungsargument. Sie werden betonen, dass die Bereitstellung von Daten durch den Nutzer – im Gegensatz zum Gewinn eines Preisgeldes – keine ungewisse, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Nutzung der Plattform ist. Die Gegenleistung (Daten) wird mit Sicherheit erbracht, nicht nur möglicherweise.
Für die Technologiekonzerne ist das Baštová-Urteil hingegen das zentrale Gegenargument. Sie werden die Logik des EuGH auf die Wertseite der Transaktion übertragen und argumentieren, dass der wirtschaftliche Wert der von einem einzelnen Nutzer bereitgestellten Daten höchst ungewiss und variabel ist und daher keine taugliche Bemessungsgrundlage bilden kann.
Welche Gegenargumente gibt es aus juristischer Sicht, insbesondere im Hinblick auf die Ungewissheit der Gegenleistung?
Aus juristischer Sicht gibt es mehrere starke Gegenargumente, die sich vor allem auf die Unsicherheit der Gegenleistung und die Struktur des Austauschs stützen.
Das Hauptargument leitet sich, wie erwähnt, aus der EuGH-Entscheidung Baštová ab. Die beklagten Plattformen werden argumentieren, dass, selbst wenn die Bereitstellung von Daten eine Bedingung ist, der Wert dieser Daten für die Plattform völlig ungewiss ist. Ein inaktiver Nutzer, der nur ein Profil anlegt, aber keine weiteren Informationen teilt oder interagiert, liefert Daten von vernachlässigbarem Wert. Ein hochaktiver Nutzer, der seine Interessen, Kaufabsichten und sein soziales Netzwerk offenlegt, liefert hingegen Daten von erheblichem Wert. Diese extreme Heterogenität und Unvorhersehbarkeit des Werts der Gegenleistung könnte, so die Argumentation, den für die Besteuerung erforderlichen unmittelbaren Zusammenhang ebenso durchbrechen wie die Ungewissheit der Zahlung im Fall Baštová.
Ein weiteres Argument ist die fehlende Spezifität des Austauschs. Bei einem typischen Tauschgeschäft wird eine klar definierte Leistung gegen eine andere klar definierte Gegenleistung getauscht. Im Fall der Online-Plattformen stellt der Nutzer einen kontinuierlichen, unbestimmten Strom von Daten variabler Qualität und Quantität zur Verfügung und erhält dafür einen ebenso undifferenzierten, dauerhaften Zugang. Es gibt keinen transaktionalen Charakter, bei dem eine „Einheit Daten“ gegen eine „Einheit Dienstleistung“ getauscht wird. Diese diffuse Struktur widerspricht der klassischen Vorstellung eines Leistungsaustauschs.
Schließlich ist die Frage der Unternehmereigenschaft des Nutzers höchst problematisch. Damit ein steuerbarer Leistungsaustausch zwischen zwei Parteien stattfinden kann, müssen beide grundsätzlich als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts handeln. Private Nutzer, die soziale Medien für persönliche Zwecke nutzen, erfüllen in der Regel nicht die Kriterien einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen. Die Annahme, Millionen von Privatpersonen würden durch die Nutzung von Facebook zu umsatzsteuerlichen Unternehmern, die eine Dienstleistung an die Plattform erbringen, erscheint rechtlich wie praktisch schwer haltbar.
Die strategische Raffinesse des italienischen Vorgehens liegt darin, die Debatte bewusst nicht als Schaffung einer neuen „Digitalsteuer“ zu rahmen, sondern als korrekte Anwendung bestehenden, harmonisierten EU-Rechts. Indem die Transaktion als gewöhnlicher „tauschähnlicher Umsatz“ klassifiziert wird, verlagert sich die Auseinandersetzung auf das vertraute Terrain der Mehrwertsteuerrichtlinie und der dazugehörigen EuGH-Rechtsprechung. Dies dient zwei Zielen: Erstens verleiht es dem Argument eine solide juristische Grundlage innerhalb des etablierten EU-Rechtsrahmens. Zweitens soll es präventiv den Vorwurf der USA entkräften, es handle sich um eine diskriminierende, unilaterale Sondersteuer gegen amerikanische Konzerne – ein Vorwurf, der regelmäßig gegen nationale Digitalsteuern erhoben wird. Die Auseinandersetzung wird so zu einer Frage der Rechtsauslegung, nicht der umstrittenen Schaffung neuer Politik.
Der Kern des juristischen Konflikts wird sich um die Auslegung der „Ungewissheit“ aus dem Baštová-Urteil drehen. Italien wird auf die Gewissheit der Handlung (der Datenbereitstellung) pochen. Die Plattformen werden auf die Ungewissheit des Wertes dieser Handlung abstellen. Dies stellt eine neuartige Rechtsfrage dar. Anders als im Pferderennen-Fall, wo die Handlung (Teilnahme) gewiss, die Belohnung aber ungewiss war, sind hier sowohl die Handlung des Nutzers (Datenbereitstellung) als auch die Belohnung (Plattformzugang) dem Grunde nach gewiss. Die Ungewissheit liegt allein im ökonomischen Wert der Nutzerleistung. Der EuGH wird entscheiden müssen, ob diese „Ungewissheit des Wertes“ rechtlich der „Ungewissheit der Zahlung“ gleichzusetzen ist und somit den für die Besteuerung erforderlichen direkten Zusammenhang durchbricht. Dies ist der ungelöste juristische Angelpunkt des gesamten Verfahrens.
Die ökonomische und praktische Dimension der Datenbewertung
Wie versucht Italien, den Wert von Nutzerdaten als Bemessungsgrundlage konkret zu bestimmen?
Da für personenbezogene Daten kein offener Markt mit leicht feststellbaren Preisen existiert, greift Italien auf drei indirekte Methoden zurück, um den wirtschaftlichen Wert der Daten als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer zu ermitteln:
Vergleich mit Abonnementmodellen
Die naheliegendste Methode ist der Vergleich mit den Preisen, die Plattformen für werbefreie Alternativen verlangen. Meta bietet in Europa beispielsweise ein „Pay-or-Okay“-Modell an. Ursprünglich kostete dieses Abonnement 9,99 € pro Monat für die Web-Version und 12,99 € für mobile Geräte. Nach einer Preissenkung liegen die Kosten bei 5,99 € bzw. 7,99 €. Der Preis für die Werbefreiheit wird hier als direkter Proxy für den Wert der Daten angesehen, die ein Nutzer im „kostenlosen“ Modell zur Verfügung stellt.
Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU)
Eine zweite Methode basiert auf den von den Konzernen selbst in ihren Geschäftsberichten ausgewiesenen Kennzahlen. Der Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU) gibt an, wie viel Umsatz ein Unternehmen durchschnittlich pro aktivem Nutzer in einem bestimmten Zeitraum erzielt. Für Meta lag dieser Wert in Europa für das Gesamtjahr 2023 bei 75,57 US-Dollar. Diese Kennzahl verknüpft den Gesamtumsatz direkt mit der Nutzerbasis und bietet so eine unternehmensinterne Bewertung jedes Nutzers. Auch für andere Plattformen wie LinkedIn lässt sich aus dem globalen Umsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und der Nutzerzahl von über einer Milliarde ein grober ARPU-Wert ableiten.
Werbemarktpreise (CPM)
Die dritte Methode orientiert sich an den Preisen des digitalen Werbemarktes. Werbetreibende zahlen für gezielte Anzeigen an die Plattformen einen Preis pro tausend Impressionen, den sogenannten Cost Per Mille (CPM). Dieser Preis spiegelt wider, was der Markt bereit ist, für den Zugang zu spezifischen Nutzerprofilen zu zahlen. Durch die Analyse und Extrapolation dieser CPM-Preise lässt sich ein Wert für die zugrunde liegenden Datenprofile ableiten, die diese gezielte Werbung erst ermöglichen.
Welche fundamentalen Probleme erschweren eine objektive und einheitliche Bewertung von Nutzerdaten?
Die Bewertung von Nutzerdaten für steuerliche Zwecke ist mit erheblichen praktischen und konzeptionellen Problemen behaftet, die eine objektive und einheitliche Bemessungsgrundlage erschweren.
Ein zentrales Problem ist die stark heterogene und oft mangelhafte Datenqualität. Die von Nutzern bereitgestellten Informationen sind häufig unvollständig, fehlerhaft oder veraltet. Es existieren doppelte Datensätze für dieselbe Person, Profile mit falschen Angaben und eine unbekannte Anzahl an Bot-Konten, die zwar Daten generieren, aber keine realen Konsumenten darstellen und somit keinen wirtschaftlichen Wert für Werbetreibende haben. Diese Qualitätsmängel machen eine pauschale Bewertung aller Nutzerprofile problematisch.
Hinzu kommt der dynamische und subjektive Wert von Daten. Der Wert eines Nutzerprofils ist nicht statisch, sondern ändert sich ständig in Abhängigkeit vom aktuellen Verhalten. Ein Nutzer, der durch seine Suchanfragen und Interaktionen eine unmittelbare Kaufabsicht für ein teures Produkt signalisiert, ist für einen Werbetreibenden temporär um ein Vielfaches wertvoller als ein passiver oder inaktiver Nutzer. Es gibt keine standardisierte Bewertungsmatrix, die diese dynamischen Wertschwankungen erfassen könnte.
Schließlich fehlt ein transparenter Marktpreis. Anders als bei Gütern oder standardisierten Dienstleistungen gibt es keinen etablierten Markt, auf dem individuelle Nutzerdatenprofile gehandelt werden und sich ein objektiver „Verkehrswert“ bilden könnte. Alle von Italien vorgeschlagenen Bewertungsmethoden sind daher lediglich indirekte Proxys, die den wahren Wert der im Einzelfall ausgetauschten Leistung nur annähernd abbilden können.
Wie hoch sind die bisherigen Steuernachforderungen an große Technologiekonzerne in Italien?
Die bisherigen Steuernachforderungen an große Technologiekonzerne in Italien sind erheblich und belaufen sich insgesamt auf über eine Milliarde Euro. Diese Nachforderungen betreffen mehrere international tätige Plattformbetreiber und erstrecken sich über verschiedene Besteuerungszeiträume, wobei aufgrund von Verjährungsfristen teilweise ältere Jahre geprüft wurden. So wurden Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) für den Zeitraum von 2015 bis 2021 Umsatzsteuer-Nachforderungen in Höhe von 887,6 Millionen Euro auferlegt, LinkedIn (Microsoft) für den gleichen Zeitraum mit 140 Millionen Euro und X (ehemals Twitter) für die Jahre 2017 bis 2021 mit 12,5 Millionen Euro.
Wie könnte eine solche Besteuerung technisch und administrativ umgesetzt werden?
Die technische und administrative Umsetzung einer solchen Steuer wäre komplex, aber Italien verfügt über eine fortschrittliche digitale Infrastruktur, die als Grundlage dienen könnte.
Ein zentrales Instrument wäre das „Sistema di Interscambio“ (SdI), Italiens System für den elektronischen Rechnungsaustausch. Seit 2019 müssen alle inländischen B2B- und B2C-Rechnungen in einem standardisierten XML-Format in Echtzeit über diese zentrale Plattform der Finanzbehörde laufen. Dieses bereits etablierte und umfassende System könnte erweitert werden, um auch die Deklaration von Tauschgeschäften, bei denen Daten als Gegenleistung dienen, abzuwickeln. Die Plattformen müssten den aggregierten Wert der von italienischen Nutzern „erhaltenen“ Daten periodisch (z. B. quartalsweise) über das SdI melden und die darauf entfallende Umsatzsteuer abführen.
Für die Erfassung grenzüberschreitender Transaktionen könnte das EU-weite „Zentrales elektronisches System für Zahlungsinformationen“ (CESOP) als konzeptionelles Vorbild dienen. CESOP wurde eingeführt, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erfassen und so den Mehrwertsteuerbetrug im E-Commerce zu bekämpfen. Obwohl es auf monetäre Zahlungen ausgelegt ist, zeigt es, dass die EU in der Lage ist, Systeme zur Verfolgung grenzüberschreitender wirtschaftlicher Vorgänge zu schaffen. Ein ähnlicher Mechanismus könnte entwickelt werden, um den Wert von grenzüberschreitenden Datenflüssen zu erfassen und den jeweiligen Mitgliedstaaten zuzuordnen.
Die Umsetzung würde auf einem Selbstveranlagungsprinzip beruhen: Die Plattformen müssten den Wert der Daten deklarieren, der dann von den Finanzbehörden geprüft und auditiert werden könnte.
Das Problem der Bewertungsmethoden bleibt bestehen. Alle von Italien vorgeschlagenen Ansätze sind fehlerbehaftete Proxys, die nicht den tatsächlichen Wert der spezifischen Gegenleistung messen. Der Preis eines Abonnements bemisst den Wert einer werbefreien Erfahrung, nicht den Wert der Daten für die Werbung. Der ARPU ist ein grober Durchschnittswert, der hoch- und niederschwellig wertvolle Nutzer vermischt und nicht den „subjektiven Wert“ einer einzelnen Transaktion abbildet. Der CPM ist ein Preis für den Zugang zu einer Zielgruppe, nicht der Kaufpreis für die zugrunde liegenden Daten selbst. Diese fundamentale Diskrepanz zwischen dem, was bewertet wird (der Proxy), und dem, was rechtlich bewertet werden muss (die konkrete Gegenleistung im Tauschgeschäft), ist der schwächste Punkt in der ökonomischen Argumentation und wird ein Hauptangriffspunkt in den juristischen Auseinandersetzungen sein.
Gleichzeitig ist die technische Machbarkeit ein zweischneidiges Schwert. Die Existenz fortschrittlicher Systeme wie dem SdI stärkt Italiens Position erheblich. In der Vergangenheit wäre eine solche Steuer möglicherweise als administrativ undurchführbar abgetan worden. Nun kann Italien auf eine robuste Echtzeit-Berichtsinfrastruktur verweisen und argumentieren, dass die Umsetzung ein gelöstes Problem ist. Dies verlagert die Debatte von praktischen Hürden zurück zu den juristischen Grundprinzipien. Diese technische Umsetzbarkeit wirft jedoch auch erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken auf, da sie eine massive Verarbeitung von Transaktionsdaten über Datentransaktionen durch den Staat implizieren würde.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Wie die Umsatzsteuer das Geschäftsmodell kostenloser Online-Dienste verändert
Kollision mit dem Datenschutzrecht
Inwiefern steht die steuerliche Monetarisierung von Daten im Konflikt mit den Grundsätzen der DSGVO?
Die steuerliche Behandlung von personenbezogenen Daten als wirtschaftliche Gegenleistung steht in einem fundamentalen Spannungsverhältnis zu den Kernprinzipien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Der offensichtlichste Konflikt besteht mit dem Grundsatz der „Datenminimierung“ (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO). Dieser verlangt von den Verantwortlichen, die Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Verarbeitungszweck notwendige Maß zu beschränken. Ein Steuersystem, das Daten als wertvolles, steuerpflichtiges Gut betrachtet, schafft einen systemischen Anreiz, der diesem Prinzip zuwiderläuft. Das fiskalische Interesse des Staates läge darin, den deklarierten Wert der Daten zu maximieren, was tendenziell eine umfangreichere Datenerhebung und -verwertung begünstigt. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Datenschutzbehörden, genau diese Datensammlung zu minimieren.
Ebenso berührt wird der Grundsatz der „Zweckbindung“. Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden, dürfen nicht ohne Weiteres für andere Zwecke verarbeitet werden. Die Besteuerung von Daten aufgrund ihres Werbepotenzials für die Werbeindustrie zementiert und legitimiert steuerrechtlich einen Verarbeitungszweck – die kommerzielle Monetarisierung –, der von Datenschützern ohnehin kritisch gesehen wird.
Auf einer philosophischen Ebene kollidiert der Ansatz mit der europäischen Auffassung von Datenschutz als Grundrecht. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat wiederholt betont, dass personenbezogene Daten kein handelbares Gut („tradeable commodity“) sind, sondern Ausfluss der Menschenwürde und des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Besteuerung von Daten wie eine Ware oder Dienstleistung birgt die Gefahr, sie rechtlich als solche zu verdinglichen, was der gesamten Schutzphilosophie der DSGVO widerspricht.
Wie bewerten europäische Datenschutzbehörden wie der EDPB das „Pay-or-Okay“-Modell, das als Referenz für die Datenbewertung dient?
Das „Pay-or-Okay“-Modell, bei dem Nutzer die Wahl haben, entweder mit ihren Daten (durch Einwilligung in verhaltensbasierte Werbung) oder mit Geld zu bezahlen, wird von europäischen Datenschutzbehörden, allen voran dem EDPB, äußerst kritisch bewertet, insbesondere wenn es von großen Online-Plattformen eingesetzt wird.
In einer vielbeachteten Stellungnahme hat der EDPB klargestellt, dass ein solches Modell in den meisten Fällen keine rechtsgültige Einwilligung im Sinne der DSGVO herbeiführen kann. Das zentrale Problem ist die mangelnde Freiwilligkeit der Einwilligung. Wenn Nutzer vor eine binäre Wahl gestellt werden – entweder einer umfassenden Datenverarbeitung zuzustimmen oder eine Gebühr zu entrichten –, kann von einer echten Wahlfreiheit oft nicht die Rede sein.
Dies gilt insbesondere bei großen Plattformen, bei denen ein erhebliches Machtungleichgewicht zwischen dem Anbieter und dem Nutzer besteht. Nutzer könnten sich gezwungen fühlen, der Datenverarbeitung zuzustimmen, um nicht von wichtigen sozialen oder beruflichen Netzwerken ausgeschlossen zu werden oder den Zugang zu Inhalten und Verbindungen zu verlieren. Eine solche Situation wird als „Nachteil“ (detriment) gewertet, der eine freie Einwilligung ausschließt.
Aus diesem Grund fordert der EDPB, dass große Online-Plattformen eine dritte, „äquivalente Alternative“ anbieten sollten, die kostenlos ist und ohne verhaltensbasierte Werbung auskommt (z. B. nur mit kontextbezogener Werbung). Nur so könne eine echte Wahlfreiheit für die Nutzer gewährleistet werden. Persönliche Daten, so der EDPB, dürfen nicht zu einem Merkmal werden, für dessen Schutz man bezahlen muss.
Stellt die Besteuerung von Daten eine Legitimierung einer Praxis dar, die datenschutzrechtlich umstritten ist?
Ja, die Einführung einer Umsatzsteuer auf den Tausch von Daten gegen Dienstleistungen kann als eine staatliche Legitimierung einer datenschutzrechtlich hoch umstrittenen Praxis verstanden werden. Indem der Staat diesen Vorgang in sein Steuersystem integriert und ihn als Quelle für öffentliche Einnahmen definiert, wird er selbst zu einem direkten Nutznießer der Datenmonetarisierung.
Dies schafft einen potenziellen Interessenkonflikt innerhalb der staatlichen Institutionen. Auf der einen Seite steht das Finanzministerium (in Italien die Agenzia delle Entrate), dessen Interesse es ist, die Steuereinnahmen zu maximieren. Dies setzt voraus, dass der Wert der Daten als hoch und deren Tausch als legitimer wirtschaftlicher Vorgang anerkannt wird. Auf der anderen Seite steht die nationale Datenschutzbehörde (der Garante per la protezione dei dati personali), deren gesetzlicher Auftrag es ist, die Grundrechte der Bürger zu schützen, was oft eine Einschränkung der Datenerhebung und -verwertung erfordert.
Diese Konstellation könnte die Position der Datenschutzregulierungsbehörden schwächen. Es wird für sie politisch und argumentativ schwieriger, eine Praxis zu kritisieren oder zu verbieten, die inzwischen zu einem anerkannten und budgetierten Bestandteil der Staatseinnahmen geworden ist. Die Besteuerung verleiht dem Modell „Daten gegen Dienstleistung“ eine offizielle wirtschaftliche und fiskalische Anerkennung, die im Widerspruch zur datenschutzrechtlichen Bewertung als potenziell grundrechtsverletzend steht.
Italiens Vorstoß provoziert somit eine Art regulatorischen Binnenkonflikt zwischen der Steuerlogik und der Datenschutzlogik. Die Steuerbehörde agiert auf Basis der ökonomischen Realität, dass Daten einen Wert haben und gehandelt werden. Die Datenschutzbehörde agiert auf Basis des rechtlichen Prinzips, dass Daten ein zu schützendes Grundrecht sind. Dieser innerstaatliche Widerspruch spiegelt die fundamentalen, ungelösten Fragen der digitalen Ökonomie wider.
Die kritische Stellungnahme des EDPB zum „Pay-or-Okay“-Modell wird dabei zu einer juristischen Waffe für die Technologiekonzerne. Wenn die höchste europäische Datenschutzinstanz argumentiert, dass die unter diesem Modell eingeholte Einwilligung wahrscheinlich ungültig und erzwungen ist, können die Plattformen im Steuerverfahren argumentieren, dass der daraus abgeleitete Abonnementpreis kein legitimer, frei vereinbarter Marktwert sein kann. Sie können ihn als künstlich überhöhten Preis darstellen, der nur dazu dient, die Nutzer zur Einwilligung zu drängen. Dies würde eine der zentralen Bewertungsmethoden Italiens direkt angreifen – nicht auf steuerrechtlicher, sondern auf datenschutzrechtlicher Grundlage, was ein schlagkräftiges, interdisziplinäres Rechtsargument darstellt.
Auswirkungen auf Wirtschaft, Märkte und Unternehmen
Welche direkten Konsequenzen drohen den Werbebudgets von Unternehmen?
Die Einführung einer Umsatzsteuer auf den Tausch von Daten gegen Dienstleistungen hätte unmittelbare und signifikante Konsequenzen für die Werbebudgets von Unternehmen, die auf digitalen Plattformen werben.
Die grundlegende Mechanik der Umsatzsteuer als indirekte Konsumsteuer legt nahe, dass die Plattformen die anfallende Steuerlast nicht selbst tragen, sondern an ihre Kunden – die Werbetreibenden – weitergeben werden. Dieser Prozess, bekannt als „Tax Pass-Through“, wird zu einer direkten Erhöhung der Werbekosten führen.
Konkret bedeutet dies einen Anstieg der Preise für zentrale Werbekennzahlen wie die Kosten pro Tausend Impressionen (CPM), also den Preis für tausend Anzeigenimpressionen, und die Kosten pro Klick (CPC), den Preis für einen einzelnen Klick auf eine Anzeige. Da diese Kennzahlen die Basis der meisten digitalen Werbekampagnen bilden, verteuert sich die Schaltung von Werbung auf den betroffenen Plattformen unmittelbar.
Diese Kostensteigerung hat weitreichende Auswirkungen auf andere wichtige Schlüsselkennzahlen (KPIs) des Marketings. Bei gleichbleibendem Werbebudget führt ein höherer CPC oder CPM zwangsläufig zu einer schlechteren Rendite auf Werbeausgaben (ROAS), da mit jedem investierten Euro weniger Umsatz generiert wird. Gleichzeitig steigen die Kosten pro Akquisition (CPA), also die Kosten für die Gewinnung eines neuen Kunden, da mehr Geld aufgewendet werden muss, um die gleiche Anzahl an Konversionen zu erzielen. Die Effizienz der Marketingausgaben sinkt somit direkt.
Wie zwingt dieser Ansatz Unternehmen, ihre Marketingstrategien in Richtung Erstanbieterdaten zu verändern?
Der italienische Vorstoß wirkt als starker Katalysator für einen strategischen Wandel im Marketing, der bereits im Gange ist: die Abkehr von der Abhängigkeit von Drittanbieterdaten hin zur Priorisierung von Erstanbieterdaten.
Durch die Besteuerung wird die Nutzung von Daten, die über große Plattformen wie Meta oder Google bezogen werden, nicht nur teurer, sondern auch rechtlich unsicherer. Dies schafft einen starken wirtschaftlichen Anreiz für Unternehmen, ihre Abhängigkeit von diesen externen Datenquellen zu reduzieren.
Stattdessen werden Unternehmen gezwungen, verstärkt in den Aufbau eigener Datenstrategien zu investieren. Der Fokus verschiebt sich auf Erstanbieterdaten – also Daten, die ein Unternehmen direkt von seinen eigenen Kunden über seine eigenen Kanäle (Website, App, CRM-System) mit deren expliziter Zustimmung sammelt. Ebenso gewinnen Zero-Party Data an Bedeutung, bei denen Kunden Informationen bewusst und proaktiv mit einem Unternehmen teilen, beispielsweise in Umfragen oder bei der Konfiguration von Präferenzen.
Die Vorteile dieser strategischen Neuausrichtung sind vielfältig: Unternehmen erlangen eine höhere Datengenauigkeit, behalten die volle Kontrolle über die Verwendung der Daten, können personalisiertere Kundenerlebnisse schaffen und stellen die direkte Einhaltung von Datenschutzvorschriften wie der DSGVO sicher. Die Steuer wirkt somit als Beschleuniger für den Aufbau direkter, transparenter und vertrauensvollerer Kundenbeziehungen.
Verändert sich dadurch das Geschäftsmodell „kostenloser“ Online-Dienste fundamental?
Ja, eine konsequente Besteuerung des Datentauschs würde das Geschäftsmodell der „kostenlosen“ Online-Dienste fundamental verändern. Das werbefinanzierte Modell, das auf dem impliziten Tausch von Daten gegen Zugang beruht, wird durch die Steuer teurer und rechtlich komplexer.
Die Plattformen werden einen starken Anreiz haben, klarere und explizit monetarisierte Beziehungen zu ihren Nutzern zu schaffen, um eine eindeutige Bemessungsgrundlage für die Steuer zu etablieren und langwierige Rechtsstreitigkeiten über die Bewertung von Daten zu vermeiden.
Dies wird voraussichtlich zu einer stärkeren Verbreitung von gestaffelten Zugangsmodellen (Tiered Models) führen. Das klassische, werbefinanzierte Modell könnte als Basis-Tier bestehen bleiben, wäre aber für die Plattformen mit höheren Betriebskosten (durch die abzuführende Umsatzsteuer) verbunden. Daneben wird sich das bereits von Meta eingeführte Bezahl-Abonnement für eine werbefreie Nutzung als Premium-Tier etablieren. Denkbar sind auch weitere hybride Modelle, die unterschiedliche Grade an Datenfreigabe und Bezahlung kombinieren. Das Zeitalter der vermeintlich kostenlosen, intransparenten Datennutzung würde damit einem Zeitalter der expliziten und bepreisten Wahlmöglichkeiten weichen.
Welche Reaktionen sind von den Finanzmärkten zu erwarten?
Die Finanzmärkte reagieren sensibel auf regulatorische Unsicherheiten, insbesondere wenn sie das Kerngeschäft globaler Technologiekonzerne betreffen. Der italienische Vorstoß stellt ein klassisches „regulatorisches Risiko“ dar – ein branchenspezifisches, unsystematisches Risiko, das die Aktienkurse und Bewertungen der betroffenen Unternehmen direkt beeinflusst.
Analysten und Investoren werden diese Unsicherheit in ihre Bewertungsmodelle einpreisen, was zu erhöhter Volatilität der Aktienkurse führen kann, bis eine endgültige rechtliche Klärung erfolgt ist. Die potenziellen finanziellen Auswirkungen sind erheblich, wie verschiedene Szenarien für die Meta-Aktie verdeutlichen: So wird beispielsweise mit einer 45-prozentigen Wahrscheinlichkeit gerechnet, dass Italien aufgibt, was zu einem Kursanstieg von drei bis vier Prozent führen könnte. Ein Rechtsstreit ohne EU-weite Folgen wird mit 30 Prozent Wahrscheinlichkeit erwartet und hätte eine neutrale Wirkung auf den Kurs. Sollte Italien gewinnen, ohne dass die Entscheidung EU-weit Wirkung zeigt, wird mit einem Rückgang von acht bis zehn Prozent gerechnet. Eine Ausdehnung der Umsatzsteuer auf ganz Europa, die mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent eingeschätzt wird, würde einen Kursverlust von zwölf bis fünfzehn Prozent nach sich ziehen.
Diese Einschätzungen verdeutlichen das wahrgenommene Risiko für Investoren und übersetzen eine komplexe rechtliche und politische Frage in klare finanzielle Auswirkungen. Ein negativer Ausgang, insbesondere eine EU-weite Ausdehnung, würde zu erheblichen Kursverlusten führen, da die Steuerlast die zukünftigen Erträge schmälert und die Geschäftsmodelle infrage stellt.
Die italienische Umsatzsteuer dient dabei nicht nur als Instrument zur Einnahmeerzielung, sondern wirkt auch als aktive marktgestaltende Kraft. Während das Hauptziel darin besteht, Steuereinnahmen zu generieren, führt die Steuer zu einer bedeutenden Verschiebung im digitalen Werbemarkt, indem sie die Kosten für die Nutzung von Drittanbieter-Plattformdaten erhöht. Dadurch entsteht ein starker kommerzieller Anreiz für Unternehmen, in ihre eigene Erstanbieterdaten-Infrastruktur zu investieren. Dies könnte unbeabsichtigt Unternehmen mit direkten Kundenbeziehungen, wie E-Commerce-Anbietern oder Abonnementdiensten, begünstigen, während Unternehmen, die auf Plattformwerbung angewiesen sind, benachteiligt werden. Somit fungiert die Steuer als Katalysator für eine umfassendere Umstrukturierung der digitalen Wirtschaft.
Paradoxerweise könnte diese Regulierung letztendlich die Marktposition ebenjener Unternehmen stärken, die sie ins Visier nimmt. Während die Steuer Kosten verursacht, verfügen große Plattformen wie Meta und Google über die finanziellen und personellen Ressourcen, um sich anzupassen, die rechtliche Komplexität zu bewältigen und konforme Systeme aufzubauen. Kleinere Wettbewerber oder neue Marktteilnehmer könnten die Compliance-Kosten und die rechtliche Unsicherheit als prohibitive Markteintrittsbarriere empfinden. Da zudem der Wert von Erstanbieterdaten steigt, werden die riesigen, proprietären Datensätze der größten Plattformen noch wertvoller und schwerer zu replizieren, was ihren Wettbewerbsvorteil im Laufe der Zeit sogar noch vergrößern könnte.
Unsere Empfehlung: 🌍 Grenzenlose Reichweite 🔗 Vernetzt 🌐 Vielsprachig 💪 Verkaufsstark: 💡 Authentisch mit Strategie 🚀 Innovation trifft 🧠 Intuition
In einer Zeit, in der die digitale Präsenz eines Unternehmens über seinen Erfolg entscheidet, stellt sich die Herausforderung, wie diese Präsenz authentisch, individuell und weitreichend gestaltet werden kann. Xpert.Digital bietet eine innovative Lösung an, die sich als Schnittpunkt zwischen einem Industrie-Hub, einem Blog und einem Markenbotschafter positioniert. Dabei vereint es die Vorteile von Kommunikations- und Vertriebskanälen in einer einzigen Plattform und ermöglicht eine Veröffentlichung in 18 verschiedenen Sprachen. Die Kooperation mit Partnerportalen und die Möglichkeit, Beiträge bei Google News und einem Presseverteiler mit etwa 8.000 Journalisten und Lesern zu veröffentlichen, maximieren die Reichweite und Sichtbarkeit der Inhalte. Dies stellt einen wesentlichen Faktor im externen Sales & Marketing (SMarketing) dar.
Mehr dazu hier:
Auswirkungen der Umsatzsteuer auf Gratis-Geschäftsmodelle im Internet
Der europäische und internationale Kontext
Warum hat die EU-Mehrwertsteuerkommission den italienischen Ansatz vorerst zurückgewiesen?
Die Mehrwertsteuerkommission der EU, ein beratendes Gremium, hat in einem unverbindlichen Arbeitspapier (Working Paper 1107) eine vorläufige und kritische Haltung zum italienischen Ansatz eingenommen. Die Zurückweisung basierte auf zwei zentralen Bedenken.
Erstens zweifelte die Kommission an der Möglichkeit, den Marktwert von personenbezogenen Daten objektiv und einheitlich zu bestimmen. Die Schwierigkeit einer verlässlichen Bewertung wurde als erhebliches praktisches Hindernis für eine faire und rechtssichere Besteuerung angesehen.
Zweitens stellte die Kommission das Vorliegen eines ausreichend direkten Leistungsbezugs in Frage. Sie argumentierte, dass Nutzer nicht verpflichtet seien, eine konsistente Menge oder Qualität an Daten zu liefern, und im Gegenzug auch keine klar bepreisten, abgegrenzten Dienstleistungen erhielten. Diese mangelnde Spezifität im Austauschverhältnis schwäche die Argumentation für einen unmittelbaren Zusammenhang im Sinne des Mehrwertsteuerrechts.
Diese Haltung spiegelt die generelle Vorsicht der EU-Institutionen wider, die eine harmonisierte, auf Konsens basierende Lösung für die Besteuerung der Digitalwirtschaft bevorzugen, anstatt unilaterale Vorstöße einzelner Mitgliedstaaten zu unterstützen.
Wie unterscheidet sich Italiens Umsatzsteuer-Ansatz von den Digitalsteuern (DST) in anderen EU-Ländern wie Frankreich, Österreich und Spanien?
Der italienische Ansatz unterscheidet sich fundamental von den Digitalsteuern (DSTs), die in Ländern wie Frankreich, Österreich und Spanien eingeführt wurden, und dieser Unterschied ist von hoher strategischer Bedeutung.
Die zentrale Differenz liegt in der Art der Steuer und ihrer rechtlichen Grundlage. Digitalsteuern (DSTs) sind in der Regel neue, eigenständige Steuern, die als direkter Steuersatz auf die Bruttoumsätze aus bestimmten digitalen Aktivitäten (z. B. Online-Werbung, Verkauf von Nutzerdaten) erhoben werden. Sie sind Sondersteuern, die außerhalb des harmonisierten Mehrwertsteuersystems stehen.
Italiens Vorstoß ist hingegen keine neue Steuer, sondern die Anwendung der bestehenden, EU-weit harmonisierten Mehrwertsteuer auf eine bisher nicht als steuerbar angesehene Transaktion. Es handelt sich um eine indirekte Verbrauchssteuer, die auf den Wert der Gegenleistung in einem Tauschgeschäft erhoben wird.
Diese unterschiedliche rechtliche Einordnung ist entscheidend. Digitalsteuern (DSTs) werden international oft als diskriminierende Maßnahmen kritisiert, die gezielt auf große (meist US-amerikanische) Technologiekonzerne abzielen. Italiens Umsatzsteuer-Ansatz ist juristisch schwerer anzugreifen, da er sich auf die universellen und neutralen Prinzipien des gemeinsamen EU-Mehrwertsteuersystems beruft. Der Streit dreht sich hier nicht um die Einführung einer Sondersteuer, sondern um die korrekte Auslegung eines seit Jahrzehnten bestehenden Gesetzes.
Besteht die Gefahr eines Dominoeffekts in anderen EU-Mitgliedstaaten?
Ja, die Gefahr eines Dominoeffekts ist erheblich und hängt maßgeblich vom Ausgang des italienischen Rechtsstreits ab. Derzeit beobachten andere Mitgliedstaaten das Verfahren genau, verhalten sich aber abwartend. Länder wie Frankreich, Spanien und Österreich haben zwar bereits eigene Digitalsteuern eingeführt, bleiben aber vorerst bei diesem Modell.
Deutschland zeigt sich aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit und der Sorge vor US-amerikanischen Gegenmaßnahmen besonders zurückhaltend.
Sollte Italien jedoch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Erfolg haben und dessen Auslegung der Mehrwertsteuerrichtlinie bestätigt werden, würde dies einen Präzedenzfall für die gesamte EU schaffen. Ein solcher juristisch abgesicherter Weg zur Besteuerung der Digitalwirtschaft wäre für andere Mitgliedstaaten äußerst attraktiv. Er verspricht erhebliche Steuereinnahmen und ist politisch und rechtlich weitaus weniger angreifbar als die bisherigen nationalen Digitalsteuern. Ein positives EuGH-Urteil würde daher mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Welle von Gesetzesanpassungen oder Neuauslegungen in anderen EU-Ländern auslösen, die das italienische Modell übernehmen.
Welches Potenzial hätte eine EU-weite Übernahme für den EU-Haushalt und die Schaffung neuer Eigenmittel?
Eine EU-weite Übernahme des italienischen Modells hätte ein enormes fiskalisches Potenzial und könnte die Finanzierungsstruktur der Europäischen Union dauerhaft verändern. Steuerexperten schätzen, dass auf EU-Ebene durch eine solche Regelung jährliche Mehrwertsteuereinnahmen von 25 bis 35 Milliarden Euro generiert werden könnten.
Im Vergleich zum EU-Haushalt 2025, der Verpflichtungen in Höhe von 199,4 Milliarden Euro vorsieht, würde dies einen Anteil von 12,5 bis 17,6 Prozent am Budget ausmachen. Diese Einnahmen wären so erheblich, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des EU-Haushalts leisten könnten und als neue Eigenmittel der EU etabliert werden könnten. Der EU-Haushalt wird derzeit hauptsächlich durch Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert, die auf deren Bruttonationaleinkommen basieren und politisch oft umstritten sind. Eine neue, echte Eigenmittelquelle aus einer EU-weiten Mehrwertsteuer auf Datentransaktionen könnte die Abhängigkeit von den BNE-Beiträgen verringern. Der bisherige Mehrwertsteuer-Eigenmittel-Mechanismus macht etwa 12 Prozent des EU-Budgets aus, ist aber faktisch ebenfalls ein Beitrag der Mitgliedstaaten. Eine direkte Erhebung der Mehrwertsteuer auf Datentransaktionen könnte diesen Mechanismus ersetzen oder ergänzen und damit die finanzielle Autonomie der EU stärken, ein langjähriges Ziel der europäischen Integration.
Wie reagieren die USA auf diesen Vorstoß und welche Handelskonflikte drohen?
Die Vereinigten Staaten reagieren auf europäische Versuche, die Digitalwirtschaft zu besteuern, traditionell ablehnend und mit der Androhung von handelspolitischen Gegenmaßnahmen. Der US-Handelsbeauftragte (USTR) hat wiederholt argumentiert, dass solche Steuern diskriminierende Maßnahmen seien, die unverhältnismäßig stark auf erfolgreiche US-Technologieunternehmen abzielen.
Auf Basis von Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 hat der USTR Untersuchungen gegen nationale Digitalsteuern eingeleitet und mit Vergeltungszöllen von bis zu 100% auf europäische Exportgüter wie französischen Wein, Käse oder Handtaschen gedroht. Diese Drohungen haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Einführung oder Erhebung von Digitalsteuern ausgesetzt wurde.
Obwohl der italienische Umsatzsteuer-Ansatz bewusst so konzipiert ist, dass er rechtlich weniger angreifbar ist als eine explizite Digitalsteuer, ist eine negative Reaktion der USA wahrscheinlich. Da die betroffenen Plattformen überwiegend aus den USA stammen, wird Washington den Vorstoß genau prüfen. Sollte sich herausstellen, dass die Steuer de facto fast ausschließlich US-Unternehmen trifft und europäische Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen verschont bleiben, könnten die USA dies ebenfalls als diskriminierend werten und handelspolitische Maßnahmen ergreifen. Die Vermeidung eines offenen Handelskonflikts hängt also entscheidend davon ab, ob Italien und potenziell die EU nachweisen können, dass die Regelung fair, neutral und universell angewendet wird.
Die Wahl des Umsatzsteuer-Ansatzes ist eine kalkulierte geopolitische Strategie. Die bisherigen Digitalsteuern scheiterten oft am mangelnden EU-Konsens und der wirksamen Drohung von US-Vergeltungszöllen. Indem Italien seine Steuer im etablierten EU-Mehrwertsteuerrahmen verankert, versucht es, eine juristische Festung zu errichten. Es fordert die USA heraus, nicht eine unilaterale „italienische Digitalsteuer“ anzugreifen, sondern die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems der EU. Sollte der Fall vor den EuGH gehen und dieser zugunsten Italiens entscheiden, würde ein EU-weiter Rechtspräzedenzfall geschaffen. Dies würde es für die USA weitaus schwieriger machen, gegen einzelne Länder vorzugehen, ohne den Anschein zu erwecken, die Kernrechtsordnung der EU anzugreifen.
Sollte dieser Ansatz Erfolg haben, könnte eine Daten-Umsatzsteuer zu einem wichtigen und politisch akzeptablen Weg zu mehr fiskalischer Integration in der EU werden. Die EU sucht seit langem nach neuen Eigenmitteln, um die Abhängigkeit von direkten nationalen Beiträgen zu verringern, die eine ständige Quelle politischer Spannungen sind. Die Besteuerung der grenzüberschreitenden Digitalwirtschaft, bei der die Wertschöpfung diffus ist, gilt als idealer Kandidat für eine Abgabe auf EU-Ebene. Sie würde vor allem Nicht-EU-Unternehmen besteuern und eine erhebliche Einnahmequelle schaffen, was die finanzielle Autonomie der EU voranbringen würde.
Das juristische Nachspiel
Mit welchen Argumenten wehren sich die betroffenen Konzerne wie Meta, LinkedIn und X juristisch?
Die betroffenen Technologiekonzerne haben Klagen bei den italienischen Steuergerichten eingereicht und stützen ihre Verteidigung auf eine Reihe von fundamentalen juristischen und praktischen Argumenten. Ihre Verteidigungsstrategie zielt darauf ab, die Grundpfeiler der italienischen Argumentation zu erschüttern:
- Fehlender unmittelbarer Zusammenhang: Das Kernargument der Konzerne ist, dass der für eine Besteuerung erforderliche direkte Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung fehlt. Sie berufen sich dabei auf die EuGH-Rechtsprechung, insbesondere das Baštová-Urteil, und argumentieren, dass die extreme Unsicherheit und Variabilität im Wert der von den Nutzern bereitgestellten Daten diesen Zusammenhang durchbricht.
- Mangelnde objektive Bewertbarkeit: Eng damit verbunden ist das Argument, dass die Bemessungsgrundlage nicht mit der für eine Besteuerung erforderlichen Rechtssicherheit bestimmt werden kann. Die Konzerne kritisieren die von Italien vorgeschlagenen Bewertungsmethoden (Abo-Preise, ARPU, CPM) als ungeeignete und fehlerhafte Proxys, die nicht den tatsächlichen subjektiven Wert der im Einzelfall erbrachten Gegenleistung widerspiegeln.
- Kein vertraglicher Leistungsaustausch: Die Unternehmen bestreiten, dass die Nutzungsbedingungen einen Vertrag über einen tauschähnlichen Umsatz im Sinne des Umsatzsteuerrechts darstellen. Sie argumentieren, dass die Nutzer keine unternehmerische Leistung erbringen, sondern die Plattformen lediglich im privaten Rahmen nutzen.
- Konflikt mit der DSGVO: Ein weiteres starkes Argument ist der Widerspruch zur Datenschutz-Grundverordnung. Die Konzerne werden geltend machen, dass die steuerliche Monetarisierung von Daten den Grundrechten auf Datenschutz und den Prinzipien der Datenminimierung und Zweckbindung widerspricht. Sie werden die kritische Haltung des EDPB zum „Pay-or-Okay“-Modell nutzen, um die Legitimität der darauf basierenden Bewertungsmethoden zu untergraben.
- Falscher Ort der Leistung: Schließlich werden die Unternehmen argumentieren, dass die Umsatzsteuer, selbst wenn sie anfiele, nicht in Italien geschuldet wäre. Nach EU-Recht ist der Ort der Dienstleistung entscheidend. Die Konzerne werden geltend machen, dass die relevanten steuerbaren Leistungen, wie der Verkauf von Werbedienstleistungen oder die zentrale Datenverarbeitung, in anderen EU-Mitgliedstaaten stattfinden, in denen ihre europäischen Hauptsitze oder Rechenzentren angesiedelt sind (z. B. Irland).
Wie ist der Ablauf eines Steuerstreitverfahrens in Italien und wann ist mit einer endgültigen Entscheidung zu rechnen?
Das italienische Steuerstreitverfahren ist mehrstufig und kann sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Es gibt grundsätzlich drei Instanzen, die durchlaufen werden müssen, bevor ein Urteil rechtskräftig wird.
- Erste Instanz: Das Verfahren beginnt vor dem zuständigen erstinstanzlichen Steuergericht, das früher „Provinzial-Steuerkommission“ hieß und nun „Gericht für Steuerrecht erster Instanz“ (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) genannt wird.
- Zweite Instanz: Gegen das Urteil der ersten Instanz kann Berufung beim zweitinstanzlichen Steuergericht, dem ehemaligen „Regionalen Steuerkommission“ (heute Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado), eingelegt werden. Dieses Gericht prüft den Fall sowohl in sachlicher als auch in rechtlicher Hinsicht vollständig neu.
- Dritte Instanz: Die letzte Instanz ist der Kassationsgerichtshof (Corte di Cassazione) in Rom. Dieser prüft das Urteil der zweiten Instanz nur noch auf Rechtsfehler, nicht mehr auf Tatsachenfragen.
Ein besonderes Merkmal des italienischen Steuerprozesses ist die starke Betonung von Dokumentenbeweisen, während Zeugenaussagen in der Regel nicht zulässig sind.
Angesichts der Komplexität des Falles, der fundamentalen Rechtsfragen und des hohen Streitwerts ist es so gut wie sicher, dass der Rechtsweg vollständig ausgeschöpft wird. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass das italienische Gericht oder der Kassationsgerichtshof den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorlegen wird. Der EuGH muss dann die strittigen Fragen zur Auslegung der Mehrwertsteuerrichtlinie klären. Allein dieses Verfahren kann ein bis zwei Jahre dauern. Unter Berücksichtigung aller Instanzen und der wahrscheinlichen EuGH-Beteiligung ist mit einer endgültigen, rechtskräftigen Entscheidung in diesem Fall nicht vor dem Jahr 2028 zu rechnen.
Was sind die zentralen Lehren für Marketer und Steuerverantwortliche schon heute?
Unabhängig vom endgültigen Ausgang des Verfahrens zwingt der italienische Vorstoß Unternehmen bereits heute, ihre Strategien zu überdenken. Für Marketing- und Steuerverantwortliche ergeben sich daraus mehrere zentrale Lehren:
- Erstanbieterdaten priorisieren: Der Trend weg von der Abhängigkeit von Drittanbieterdaten großer Plattformen wird durch solche regulatorischen Maßnahmen massiv beschleunigt. Die Investition in eigene Kanäle zur Sammlung von Erstanbieter- und Zero-Party-Daten ist keine Option mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit, um Kosten zu senken, rechtliche Risiken zu minimieren und direkte, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Budgets auf Unsicherheit ausrichten: Marketingverantwortliche müssen die Möglichkeit steigender Werbekosten in ihre Budgetplanung einbeziehen. Die Preise für digitale Werbung auf großen Plattformen könnten durch die Weitergabe von Steuerlasten spürbar anziehen, was die Effizienz von Kampagnen beeinträchtigt.
- Transparenz als Geschäftsmodell verstehen: Die Debatte rückt den Wert von Daten ins Zentrum. Unternehmen, die transparent kommunizieren, welchen Wert sie im Austausch für Daten bieten, und den Nutzern eine echte Wahl lassen, werden langfristig das Vertrauen der Kunden gewinnen.
- Kanäle diversifizieren: Eine zu starke Abhängigkeit von einzelnen, dominanten Werbeplattformen birgt erhebliche Risiken. Marketer sollten ihre Strategien diversifizieren und alternative Kanäle wie Influencer-Marketing, Content-Marketing, den Aufbau eigener Communities oder die Förderung lokaler Social-Media-Alternativen prüfen.
Ist Italiens Vorstoß ein zukunftsweisendes Modell oder ein juristisches Wagnis mit ungewissem Ausgang?
Der italienische Vorstoß, die Bereitstellung von Nutzerdaten als umsatzsteuerpflichtige Gegenleistung zu behandeln, ist beides: ein potenziell zukunftsweisendes Modell für die Besteuerung der Digitalwirtschaft und ein juristisches Wagnis mit höchst ungewissem Ausgang.
Es ist ein wegweisender Versuch, ein Steuersystem des 20. Jahrhunderts, das auf greifbaren Gütern und klar definierten Dienstleistungen basiert, an die Wertschöpfungslogik des 21. Jahrhunderts anzupassen. Der Ansatz ist intellektuell elegant, da er keine neuen Sondersteuern erfindet, sondern versucht, die diffuse Wertschöpfung im Daten-Ökosystem in den bestehenden, harmonisierten Rechtsrahmen der europäischen Mehrwertsteuer zu integrieren. Damit adressiert Italien eine der drängendsten Fragen der internationalen Steuerpolitik.
Gleichzeitig ist der Erfolg des Vorstoßes alles andere als garantiert. Er hängt von einer für Italien günstigen und gleichzeitig bahnbrechenden Auslegung des Umsatzsteuerrechts durch den Europäischen Gerichtshof ab. Die Hürden sind hoch: die unsichere Bewertbarkeit von Daten, die unklare Unternehmereigenschaft von Privatnutzern und der starke Gegenwind von Datenschutzbehörden und den mächtigsten Technologiekonzernen der Welt.
Unabhängig davon, wie die Gerichte letztlich entscheiden, hat Italien bereits einen wichtigen Erfolg erzielt: Es hat eine kritische Debatte auf die europäische Agenda gesetzt und die Grundannahme des „kostenlosen“ Internets in Frage gestellt. Unternehmen, Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit sind nun gezwungen, sich mit der fundamentalen Frage auseinanderzusetzen: Wenn Daten das neue Öl sind, wer erhebt dann die Steuern darauf? Italiens Antwort mag gewagt sein, aber sie hat das Schweigen gebrochen.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.