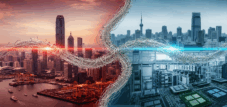Warlords, Gold und Hunger: Wer vom wirtschaftlichen Tod des Sudan wirklich profitiert
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 3. November 2025 / Update vom: 3. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Warlords, Gold und Hunger: Wer vom wirtschaftlichen Tod des Sudan wirklich profitiert – Kreativbild: Xpert.Digital
200 % Inflation, halbe Wirtschaft vernichtet: Sudans brutale Realität hinter den Zahlen
Vom Hoffnungsträger zum “Failed State”: Die tragische Geschichte von Sudans wirtschaftlichem Kollaps
Die Vorstellung, dass sudanesische Unternehmen inmitten der aktuellen Zerstörung eine Expansion auf den europäischen Markt anstreben könnten, trifft auf eine unerbittliche und tragische Realität. Jede Diskussion über Markteintrittsstrategien, Geschäftspartnerschaften oder die “Eroberung” deutscher Märkte ist nicht nur verfrüht, sondern eine fundamentale Verkennung der katastrophalen Lage in einem Land, dessen wirtschaftliche und soziale Strukturen systematisch pulverisiert wurden. Der Sudan ist kein schwieriger Markt – er ist unter den gegenwärtigen Umständen praktisch kein Markt mehr.
Der seit April 2023 wütende Bürgerkrieg zwischen den Sudanesischen Streitkräften (SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) hat einen volkswirtschaftlichen Totalzusammenbruch ausgelöst. Die Zahlen malen ein dystopisches Bild: Das Bruttoinlandsprodukt ist um 42 % eingebrochen, die Inflationsrate explodierte auf 200 %, und 5,2 Millionen Arbeitsplätze – die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse – wurden vernichtet. Was einst das wirtschaftliche Herz des Landes war, die Hauptstadt Khartum, liegt nach fast zwei Jahren unerbittlicher Kämpfe in Trümmern.
Doch hinter diesen abstrakten Daten verbirgt sich eine humanitäre Tragödie von globalem Ausmaß. Mit über 30 Millionen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, und 12,9 Millionen Vertriebenen erlebt der Sudan die größte Flüchtlingskrise der Welt. In weiten Teilen des Landes herrscht eine akute Hungersnot. Die Wirtschaft wurde nicht nur geschwächt, sondern in eine Kriegsökonomie transformiert, in der Warlords durch die Plünderung von Ressourcen wie Gold ihre Kriegsmaschinerie finanzieren und jedes zivile Unternehmertum im Keim ersticken.
Dieser Artikel ist daher keine Anleitung für einen unmöglichen Markteintritt. Er ist vielmehr eine schonungslose Analyse des wirtschaftlichen Kollapses, der die strukturellen Gründe beleuchtet, warum der Sudan als Geschäftspartner faktisch nicht mehr existiert. Er untersucht, wie eine vielversprechende Zukunft verspielt wurde, wie die Kriegsökonomie funktioniert und warum jede Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung von einem Ende des Konflikts und einem jahrzehntelangen, mühsamen Wiederaufbau abhängt.
Von der Substanz zur Spekulation: Warum die sudanesische Wirtschaftsrealität keine europäische Expansion erlaubt
Die Frage nach Expansionsmöglichkeiten sudanesischer Firmen auf dem deutschen und europäischen Markt stößt auf eine unbequeme Wahrheit: Im Sudan gibt es derzeit keine substanzielle privatwirtschaftliche Grundlage mehr, die eine internationale Geschäftsausweitung rechtfertigen oder ermöglichen würde. Der seit April 2023 tobende Bürgerkrieg zwischen den Sudanesischen Streitkräften und den paramilitärischen Rapid Support Forces hat nicht nur das Land physisch verwüstet, sondern auch jegliche unternehmerische Infrastruktur pulverisiert. Die wirtschaftliche Situation ist nicht nur schwierig – sie ist katastrophal in einem Ausmaß, das jede Diskussion über Markteintrittsstrategien in Europa zur Absurdität werden lässt.
Die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Das sudanesische Bruttoinlandsprodukt ist von 56,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf geschätzte 32,4 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 eingebrochen – ein kumulierter Verlust von 42 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Die Inflationsrate erreichte 2024 astronomische 200 Prozent, während gleichzeitig 5,2 Millionen Arbeitsplätze vernichtet wurden – die Hälfte der gesamten Erwerbsbevölkerung. Dies ist kein Abschwung, sondern ein volkswirtschaftlicher Totalzusammenbruch. Mehr als 30 Millionen Menschen – über 60 Prozent der Bevölkerung – benötigen humanitäre Hilfe, 12,9 Millionen sind auf der Flucht, und in mindestens 14 Regionen herrscht akute Hungersnot.
Unter diesen Umständen von “sudanesischen Branchen und Firmen” zu sprechen, die “sich geschäftlich in Europa ausweiten” könnten, verkennt die Realität fundamental. Es gibt praktisch keine funktionierenden sudanesischen Unternehmen mehr, die über das bloße Überleben hinaus operieren könnten. Die industrielle Produktion ist um 70 Prozent eingebrochen, die landwirtschaftliche Wertschöpfung um 49 Prozent. Selbst die wenigen Großkonzerne, die vor dem Krieg existierten – wie die DAL Group – haben ihre Operationen eingestellt oder verlagert. Die Bankeninfrastruktur ist kollabiert, Handelswege sind unterbrochen, und die Hauptstadt Khartoum, einst das wirtschaftliche Herz des Landes, liegt in Trümmern.
Diese Analyse untersucht daher nicht die Chancen einer illusorischen sudanesischen Expansion nach Europa, sondern vielmehr die strukturellen Gründe, warum der Sudan unter gegenwärtigen Bedingungen als Wirtschaftspartner faktisch nicht existiert – und welche fundamentalen Transformationen notwendig wären, um überhaupt jemals wieder an internationale Geschäftsbeziehungen denken zu können.
Vom Hoffnungsträger zum Kriegsgebiet: Die wirtschaftliche Zerstörung eines Landes
Die Tragödie des Sudan liegt nicht nur in der gegenwärtigen Katastrophe, sondern auch in der verpassten Chance. Noch im Jahr 2019, nach dem Sturz des Diktators Omar al-Bashir, keimte internationale Hoffnung auf. Deutschland organisierte im Juni 2020 eine Sudan-Partnerschaftskonferenz, bei der internationale Partner insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des Transformationsprozesses zusagten. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank gewährten Sudan 2021 Schuldenerleichterungen im Rahmen der HIPC-Initiative, die eine Reduzierung der Auslandsverschuldung von 56,6 Milliarden auf etwa 6 Milliarden US-Dollar vorsahen. Es schien, als könnte der Sudan nach Jahrzehnten der Isolation zu einem stabilen Partner werden.
Diese Hoffnungen wurden durch den Militärputsch vom Oktober 2021 zunichte gemacht, als General Abdel Fattah al-Burhan die Macht an sich riss und die zivile Übergangsregierung entmachtete. Internationale Hilfsgelder wurden eingefroren, entwicklungspolitische Programme ausgesetzt. Doch der eigentliche Abgrund tat sich im April 2023 auf, als der Machtkampf zwischen al-Burhans Armee und den von General Mohamed Hamdan Dagalo geführten Rapid Support Forces in einen Bürgerkrieg mündete.
Die wirtschaftlichen Folgen waren verheerend und beispiellos in ihrer Geschwindigkeit. Die Industrieproduktion konzentrierte sich traditionell im Großraum Khartoum – genau dort, wo die heftigsten Kämpfe tobten. Fabriken wurden geplündert, Maschinen zerstört oder gestohlen, Produktionsstätten bombardiert. Die Schlacht um Khartoum dauerte fast zwei Jahre und gilt als eine der längsten und blutigsten Schlachten in einer afrikanischen Hauptstadt überhaupt, mit über 61.000 Toten allein in der Hauptstadtregion. Erst im März 2025 gelang es der Armee, die RSF weitgehend aus Khartoum zu vertreiben, doch die Stadt war zu diesem Zeitpunkt bereits eine zerstörte Hülle ihrer selbst.
Die Landwirtschaft, die vor dem Krieg etwa 35 Prozent zum BIP beitrug und 80 Prozent der Arbeitskräfte beschäftigte, erlitt gleichfalls dramatische Einbußen. Die Getreideproduktion sank 2024 um 46 Prozent unter das Niveau von 2023 und um 40 Prozent unter den Fünfjahresdurchschnitt. Viele Bauern konnten ihre Felder nicht bestellen, weil sie geflohen waren oder weil die Gebiete zu Schlachtfeldern geworden waren. Die Preise für Grundnahrungsmittel explodierten – Reis, Bohnen und Zucker wurden in manchen Regionen unbezahlbar, während Fleischpreise sich mehr als verdoppelten.
Der Goldsektor, der etwa 70 Prozent der Exporteinnahmen generierte, wurde faktisch kriminalisiert. Beide Kriegsparteien – sowohl die Armee als auch die RSF – übernahmen die Kontrolle über Goldminen und nutzen die Einnahmen zur Finanzierung ihrer Kriegsführung. Schätzungsweise 80 bis 85 Prozent des sudanesischen Goldes werden illegal ins Ausland geschmuggelt, vor allem in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die offiziellen Goldexporte von 750,8 Millionen US-Dollar in die VAE im ersten Halbjahr 2025 spiegeln nur einen Bruchteil des tatsächlichen Handelsvolumens wider. Diese Kriegsökonomie verhindert jede geordnete wirtschaftliche Entwicklung und macht den Sudan zu einem failed state, in dem organisierte Kriminalität und Warlord-Strukturen die Oberhand gewonnen haben.
Das historisch gewachsene deutsch-sudanesische Wirtschaftsverhältnis war bereits vor dem Krieg marginal. Das bilaterale Handelsvolumen betrug 2021 gerade einmal 128 Millionen Euro. Sudans traditionelle Exporte nach Deutschland – Baumwolle, Gummi Arabicum, Sesam – machten nur einen winzigen Bruchteil des deutschen Importvolumens aus. Umgekehrt importierte Sudan hauptsächlich Maschinen, Anlagen und Fertigprodukte aus Deutschland. Seit Ausbruch des Krieges ist dieser ohnehin bescheidene Handel nahezu zum Erliegen gekommen, wobei UK-Statistiken zeigen, dass selbst der britische Handel mit Sudan – auf niedrigem Niveau – nur noch humanitäre Güter umfasst.
Die historische Entwicklung zeigt somit ein Muster verpasster Chancen: Der Sudan besaß nach der Unabhängigkeit 1956 durchaus wirtschaftliches Potenzial, verspielte dieses aber durch jahrzehntelange Bürgerkriege, Misswirtschaft und internationale Sanktionen. Die kurze Hoffnungsphase 2019-2021 wurde brutal durch erneute Militärherrschaft und Krieg beendet. Die aktuelle Situation stellt einen historischen Tiefpunkt dar, von dem eine Erholung – selbst im optimistischsten Szenario – Jahrzehnte dauern wird.
Die Anatomie eines Zusammenbruchs: Kriegsökonomie und ihre Profiteure
Der sudanesische Wirtschaftskollaps folgt spezifischen Mechanismen, die weit über gewöhnliche Rezessionen hinausgehen. Im Zentrum steht die Transformation von einer – wenn auch fragilen – Marktwirtschaft hin zu einer Kriegsökonomie, die von zwei militärischen Akteuren kontrolliert wird, deren einziges ökonomisches Ziel die Finanzierung ihrer Kriegsmaschinerie ist.
Die Rapid Support Forces unter General Dagalo haben sich vor allem die lukrativen Goldminen in Darfur und Nord-Kordofan gesichert. Diese paramilitärische Miliz, die ursprünglich aus den berüchtigten Janjaweed-Reitern hervorging, kontrolliert große Teile der westlichen Goldabbaugebiete. Schätzungen zufolge wurden allein 2024 Gold im Wert von 860 Millionen US-Dollar aus RSF-kontrollierten Minen in Darfur gefördert. Der Großteil davon wird illegal in die Vereinigten Arabischen Emirate geschmuggelt, die im Gegenzug Waffen und Munition liefern – ein perfektes Beispiel für den Ressourcenfluch, der bewaffnete Konflikte perpetuiert.
Die Sudanesischen Streitkräfte wiederum kontrollieren strategische Infrastruktur, Häfen und staatliche Unternehmen – soweit diese noch funktionieren. Port Sudan am Roten Meer, der wichtigste Seehafen des Landes, dient als Umschlagplatz für Öl- und Goldexporte sowie für Waffenimporte. Beide Kriegsparteien haben kein Interesse an einer funktionierenden Zivilwirtschaft; diese würde ihre Kontrolle über Ressourcen und Einnahmeströme nur gefährden.
Für die verbliebene Zivilbevölkerung und die wenigen noch aktiven Unternehmer bedeutet diese Kriegsökonomie de facto Enteignung. Internationale Organisationen berichten von systematischer Plünderung durch beide Seiten, von Schutzgelderpressung, willkürlichen Verhaftungen und der Beschlagnahmung von Waren und Produktionsmitteln. Kleine und mittlere Unternehmen, die das Rückgrat jeder funktionierenden Wirtschaft bilden, können unter diesen Bedingungen nicht operieren. Die Dal Group, einer der größten privaten Konzerne Sudans mit Aktivitäten in Lebensmittelproduktion und anderen Sektoren, hat seine Produktion entweder eingestellt oder an sicherere Standorte verlagert.
Die makroökonomischen Indikatoren spiegeln diesen institutionellen Zusammenbruch wider. Die Inflationsrate von 200 Prozent im Jahr 2024 resultiert aus einer Kombination aus Gelddrucken zur Kriegsfinanzierung, Importunterbrechungen und dem Kollaps der Sudanesischen Pfund. Der offizielle Wechselkurs ist bedeutungslos; auf dem Schwarzmarkt werden weitaus schlechtere Kurse geboten. Dies macht jede Kalkulation für im- oder exportorientierte Geschäfte unmöglich. Die Währung ist kein Wertaufbewahrungsmittel mehr, sondern nur noch ein rasch verfallender Tauschmittel.
Die Arbeitslosigkeit hat mit dem Verlust von 5,2 Millionen Arbeitsplätzen – etwa der Hälfte aller formellen Beschäftigungsverhältnisse – ein katastrophales Ausmaß erreicht. Besonders dramatisch ist die Situation im Dienstleistungssektor und in der Industrie, die in und um Khartoum konzentriert waren. Viele der Beschäftigten sind geflohen oder haben keine Arbeitsstätte mehr, zu der sie zurückkehren könnten. Die informelle Wirtschaft, die schon vor dem Krieg über die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmachte, ist ebenfalls weitgehend zum Erliegen gekommen, da die Mobilität eingeschränkt ist und Märkte nicht mehr funktionieren.
Das Bankensystem – Voraussetzung für jede moderne Wirtschaftstätigkeit – ist faktisch kollabiert. Geldautomaten funktionieren nicht, internationale Überweisungen sind nahezu unmöglich, Kreditvergabe findet nicht statt. Selbst einfache Geschäftstransaktionen müssen bar abgewickelt werden, was bei der grassierenden Hyperinflation und Unsicherheit kaum praktikabel ist. Internationale Sanktionen, die ein Waffenembargo, Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten umfassen, erschweren zudem jegliche grenzüberschreitende Geschäfte.
Die Handelsbilanz zeigt die strukturelle Verwerfung: Im ersten Halbjahr 2025 exportierte Sudan hauptsächlich Gold (750,8 Mio. USD in die VAE), lebende Tiere (159,1 Mio. USD nach Saudi-Arabien) und Sesam (52,6 Mio. USD nach Ägypten). Die Importe bestanden vor allem aus Maschinen aus China (656,5 Mio. USD), Lebensmitteln aus Ägypten (470,7 Mio. USD) und Chemikalien aus Indien (303,6 Mio. USD). Dies zeigt, dass Sudan selbst im Kriegszustand Rohstoffe exportiert und Fertigprodukte importiert – ein koloniales Handelsmuster, das keine Grundlage für industrielle Entwicklung oder hochwertige Exporte bietet.
Die Akteure im System sind klar definiert: Militärs und Milizen kontrollieren die einträglichen Sektoren wie Gold und Öl; internationale Schmugglernetzwerke sorgen für den illegalen Export; Nachbarstaaten – insbesondere die VAE, Ägypten und Saudi-Arabien – profitieren als Abnehmer billiger Rohstoffe und Lieferanten teurer Waffen. Die Zivilgesellschaft und Unternehmer sind in dieser Gleichung Opfer, nicht Akteure. Von einer unternehmerischen Mittelschicht, die internationale Märkte erobern könnte, kann keine Rede sein.
Trümmerlandschaft statt Geschäftsumfeld: Der Status quo im November 2025
Im November 2025 präsentiert sich die wirtschaftliche Lage Sudans als humanitäre und ökonomische Katastrophe von historischem Ausmaß. Das Land erlebt die größte Vertreibungskrise weltweit und eine der schwersten Hungerskatastrophen der jüngeren Geschichte.
Die wichtigsten quantitativen Indikatoren zeichnen ein düsteres Bild: Das BIP wird für 2025 auf 32,4 Milliarden US-Dollar geschätzt – 42 Prozent unter dem Niveau von 2022 vor dem Krieg. Die Inflationsrate bewegt sich zwischen 118 und 200 Prozent, was Ersparnisse vernichtet und jede Preiskalkulation unmöglich macht. Das Pro-Kopf-Einkommen ist von 1.147 US-Dollar (2022) auf geschätzte 624 US-Dollar (2025) gefallen. Damit gehört Sudan zu den ärmsten Ländern der Welt.
Die humanitäre Dimension überschreitet alle Vorstellungskraft: 30,4 Millionen Menschen – mehr als die Hälfte der geschätzten Gesamtbevölkerung von 50 Millionen – benötigen humanitäre Hilfe. Dies ist die größte humanitäre Krise weltweit. 12,9 Millionen Menschen sind auf der Flucht, davon 8,9 Millionen Binnenvertriebene und 4 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländern. Ägypten hat die meisten Sudanesen aufgenommen (schätzungsweise 1,2 Millionen), gefolgt von Tschad (1 Million), Südsudan (1 Million) und anderen Anrainerstaaten.
Die Ernährungssituation ist katastrophal: 24,6 Millionen Menschen leiden unter akuter Ernährungsunsicherheit, 637.000 Menschen – die höchste Zahl weltweit – befinden sich in katastrophalen Hungersnöten. In der Zamzam-Camp in Nord-Darfur wurde im August 2024 offiziell eine Hungersnot festgestellt – die erste ihrer Art seit Jahren. Mindestens 14 weitere Regionen sind akut von Hungersnot bedroht. Über ein Drittel der Kinder leidet unter akuter Mangelernährung, wobei die Rate in vielen Gebieten über der 20-Prozent-Schwelle liegt, die eine Hungersnot definiert.
Die Infrastruktur ist in weiten Teilen des Landes zerstört. In Khartoum, der wirtschaftlichen und politischen Hauptstadt mit einst über 6 Millionen Einwohnern, sind ganze Stadtviertel in Schutt und Asche. Wohnhäuser wurden bombardiert, Krankenhäuser geplündert, Schulen in Militärstützpunkte umgewandelt. 31 Prozent der urbanen Haushalte wurden zur Umsiedlung gezwungen. Das Straßennetz ist durch Kampfhandlungen beschädigt, Brücken sind zerstört oder militärisch gesperrt. Der Flughafen Khartoum wurde erst Ende März 2025 von der Armee zurückerobert, ist aber nicht operationsfähig.
Die Strom- und Wasserversorgung funktioniert in den meisten urbanen Zentren nicht mehr zuverlässig. Dies beeinträchtigt nicht nur das tägliche Leben, sondern macht auch jede industrielle Produktion unmöglich. Krankenhäuser müssen mit Notstromaggregaten arbeiten, wenn überhaupt. Das Gesundheitssystem ist kollabiert: Von den Gesundheitseinrichtungen sind viele geschlossen, geplündert oder zerstört. Medikamente sind Mangelware. Seit 2024 wüten Cholera- und Masern-Epidemien; bis April 2025 wurden fast 60.000 Cholera-Fälle mit über 1.640 Todesfällen registriert.
Die Bildungsinfrastruktur liegt ebenfalls in Trümmern. Schulen und Universitäten sind seit Beginn des Krieges geschlossen oder wurden als Notunterkünfte für Vertriebene zweckentfremdet. Eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen erhält keine Bildung mehr. Dies wird langfristige Folgen für die Humankapitalentwicklung haben und jede wirtschaftliche Erholung erschweren.
Für Unternehmen bedeutet dieser Status quo: Es gibt kein funktionierendes Geschäftsumfeld. Es gibt keine Rechtssicherheit, keine vertrauenswürdigen Institutionen, keine Vertragserfüllung. Selbst in den weniger vom Krieg betroffenen Regionen wie dem Roten-Meer-Staat, wo Port Sudan liegt, ist normaler Geschäftsbetrieb unmöglich. Die Hafenstadt ist zwar unter Armeekontrolle und hat viele Flüchtlinge aus Khartoum aufgenommen, leidet aber unter Überbevölkerung, Inflation und ständiger Unsicherheit. Selbst hier sind die Lebenshaltungskosten explodiert – ein Kilogramm Fleisch kostet 26.000 Sudanesische Pfund (43 US-Dollar), etwa das Doppelte des Vorkriegspreises.
Die drängendsten Herausforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Erstens, die unmittelbare Sicherung des Überlebens von Millionen Menschen, die von Hunger, Krankheiten und Gewalt bedroht sind. Zweitens, die Beendigung der Kampfhandlungen und ein tragfähiger Waffenstillstand – wofür es derzeit keine Anzeichen gibt. Drittens, die schrittweise Wiederherstellung grundlegender staatlicher Funktionen und Infrastruktur. Viertens, die langfristige wirtschaftliche Transformation, die eine Abkehr von der Kriegsökonomie und Rohstoffabhängigkeit hin zu diversifizierter, produktiver Wirtschaftsaktivität bedeuten würde. Zwischen der aktuellen Situation und diesem Fernziel klafft ein Abgrund, den kein noch so ambitioniertes Marketingkonzept überbrücken kann.
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Gummi Arabicum bis Gold – weshalb Sudan am europäischen Markt scheitert
Das Trugbild der Expansion: Warum sudanesische Firmen nicht nach Europa kommen können
Eine nüchterne Betrachtung der Frage, welche sudanesischen Branchen und Firmen eine geschäftliche Ausweitung nach Deutschland und Europa anstreben könnten, führt zu einer klaren Antwort: Es gibt keine. Die Vorstellung, dass sudanesische Unternehmen in der aktuellen Situation Deutschland als “Ausgangsbasis zur Eroberung des deutschen wie europäischen Marktes” nutzen könnten, entbehrt jeder faktischen Grundlage. Weder existieren funktionsfähige sudanesische Firmen mit Exportkapazitäten, noch wären diese in der Lage, die komplexen regulatorischen, logistischen und kapitaltechnischen Anforderungen für einen Markteintritt in Europa zu erfüllen.
Betrachten wir die theoretisch interessantesten Sektoren. Gummi Arabicum wäre traditionell ein Exportprodukt mit Potenzial. Sudan produziert etwa 70 bis 80 Prozent des weltweiten Gummi Arabicums, das in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet wird. Doch die Produktion ist seit Kriegsbeginn massiv eingebrochen und wird von Kriegsparteien kontrolliert. Die Lieferketten sind unterbrochen, Qualitätskontrollen existieren nicht mehr, und die Verarbeitung findet – wenn überhaupt – unter primitivsten Bedingungen statt. Ein Eintritt in den hochregulierten europäischen Lebensmittelmarkt, der strenge Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit verlangt, ist schlicht unmöglich.
Ähnlich verhält es sich mit Sesam, wo Sudan historisch einer der größten Exporteure war und 40 Prozent der afrikanischen Produktion stellte. Doch die Sesamanbaugebiete liegen in Kriegsregionen, die Ernte ist drastisch zurückgegangen, und die wenigen Exporte gehen nach China, Japan und in Nachbarländer, nicht nach Europa. Die Wertschöpfung beschränkt sich auf Rohstoffexporte; es gibt keine Verarbeitung, keine Markenbildung, keine Produktdifferenzierung. Ein sudanesisches Unternehmen, das in Europa Sesamprodukte vermarkten wollte, müsste gegen etablierte Anbieter aus Indien, Myanmar und Lateinamerika konkurrieren – eine aussichtslose Aufgabe für einen kriegsgebeutelten Produzenten ohne Kapital, Technologie und Marktzugang.
Der Goldsektor ist der einzige, der noch erhebliche Exportvolumina generiert, aber dies geschieht illegal und kriegsfinanzierend. Sudanesische Goldhändler, die nach Europa exportieren wollten, würden sofort mit internationalen Sanktionen und Geldwäsche-Vorschriften konfrontiert. Der Kimberley-Prozess und vergleichbare Zertifizierungsmechanismen für Konfliktmineralien würden jeden Handel verhindern. Selbst wenn es gelingen würde, “sauberes” Gold zu exportieren, wäre die Konkurrenz durch etablierte Goldraffineure in der Schweiz, Deutschland und Großbritannien erdrückend.
Die Viehwirtschaft ist ein weiterer traditioneller Sektor mit theoretischem Potenzial – Sudan hat einen der größten Viehbestände Afrikas, und Lebendvieh-Exporte machen einen bedeutenden Teil der Exporteinnahmen aus, hauptsächlich in arabische Länder. Doch der Export lebender Tiere nach Europa ist aus Tierschutz- und Veterinärgründen hochreguliert und zunehmend umstritten. Selbst wenn sudanesische Exporteure die europäischen Standards erfüllen könnten, wäre dies ein Niedrigmargen-Geschäft mit hohen logistischen Hürden. Verarbeitete Fleischprodukte aus Sudan, die höhere Margen erlauben würden, sind derzeit undenkbar, da die Verarbeitungsinfrastruktur zerstört ist und Hygienestandards nicht eingehalten werden können.
Die wenigen verbliebenen Großunternehmen Sudans – wie die Bank of Khartoum, Sudan Telecom oder staatliche Ölgesellschaften – operieren, wenn überhaupt, nur im Inland und kämpfen ums Überleben. Diese Firmen haben weder die Ressourcen noch die strategische Ausrichtung für internationale Expansion. Die meisten sind zudem staatsverbunden und unterliegen internationalen Sanktionen oder zumindest erhöhter Due-Diligence-Prüfung durch westliche Banken.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in vielen Entwicklungsländern das Rückgrat der Wirtschaft und die Innovatoren für Exportgeschäfte sind, existieren im Sudan derzeit nur in Ansätzen. Während des Krieges sind Hunderte von Mikrounternehmen entstanden, die Grundbedarfsgüter wie Milchprodukte, Verpackungsmaterial und Detergenzien herstellen. Doch diese Betriebe sind auf lokale Märkte ausgerichtet, verwenden oft primitive Technologien, haben extrem begrenzte Ressourcen und keine Erfahrung mit Export oder internationalen Geschäften. Die Vorstellung, dass ein sudanesischer Kleinstproduzent von Tontöpfen oder Seife den deutschen Markt erobern könnte, ist absurd.
Der Vergleich mit erfolgreichen afrikanischen Expansionsgeschichten macht die Unmöglichkeit noch deutlicher. Kenianische Tech-Startups, äthiopische Kaffee-Exporteure oder marokkanische Automobilzulieferer haben ihre Erfolge in funktionierenden Staaten mit relativer politischer Stabilität, Infrastruktur und Zugang zu Kapital erzielt. Sudan bietet nichts davon. Selbst Länder wie Südsudan oder Somalia, die ebenfalls von Konflikten geplagt sind, haben zumindest in Teilgebieten Stabilität und konnten rudimentäre Wirtschaftsstrukturen aufrechterhalten. Sudan befindet sich in einem totalen Zusammenbruch.
Die regulatorischen und praktischen Hürden für einen sudanesischen Markteintritt in Europa sind überwältigend. EU-Importvorschriften verlangen Herkunftsnachweise, Qualitätszertifikate, Zollabfertigungen und die Einhaltung von Produktstandards. Deutsche Geschäftspartner würden Due-Diligence-Prüfungen durchführen, die Fragen nach Unternehmensregistrierung, Bilanzen, Steuernachweisen und Reputation aufwerfen. Keine dieser Anforderungen kann ein sudanesisches Unternehmen derzeit erfüllen. Selbst der Geldtransfer wäre problematisch, da das sudanesische Bankensystem nicht funktioniert und internationale Banken Transaktionen aus Sudan aufgrund von Sanktionen und Geldwäsche-Risiken ablehnen würden.
Die Vorstellung eines “starken und spezialisierten deutschen Partners im Bereich Marketing, PR und Business Development” löst diese fundamentalen Probleme nicht. Marketing kann ein nicht existierendes Produkt nicht verkaufen. PR kann ein kriegsgebeuteltes Land nicht in einen attraktiven Geschäftspartner verwandeln. Business Development kann keine Geschäftsbeziehungen aufbauen, wo es keine Geschäfte gibt. Ein seriöser deutscher Dienstleister würde von einer Zusammenarbeit mit sudanesischen “Partnern” abraten, da die Reputationsrisiken, rechtlichen Unwägbarkeiten und praktischen Unmöglichkeiten jedes potenzielle Geschäft zunichtemachen würden.
Vergleichsanalyse: Wenn Krieg die Wirtschaft zerstört
Ein Blick auf andere Länder, die von bewaffneten Konflikten oder wirtschaftlichen Krisen betroffen waren, verdeutlicht sowohl die Besonderheit als auch die Tragik der sudanesischen Situation. Die Vergleichsanalyse zeigt, unter welchen Bedingungen wirtschaftliche Erholung möglich ist – und warum Sudan diese Bedingungen derzeit nicht erfüllt.
Syrien hat einen noch längeren und blutigeren Bürgerkrieg erlebt, der seit 2011 andauert. Doch selbst in Syrien haben sich in den von der Regierung kontrollierten Gebieten rudimentäre Wirtschaftsstrukturen erhalten. Damaskus und andere Städte funktionieren – wenn auch eingeschränkt – weiter. Syrische Exporteure, hauptsächlich der Diaspora, unterhalten weiterhin Geschäftsbeziehungen, und syrische Produkte – Olivenöl, Textilien, Lebensmittel – erreichen internationale Märkte, oft über Drittländer. Der entscheidende Unterschied: Syrien hat eine funktionierende Regierung, die Gebiete kontrolliert, und eine Diaspora mit Kapital und internationalen Netzwerken. Sudan hat weder das eine noch das andere in ausreichendem Maße.
Die Ukraine bietet ein anderes Vergleichsszenario: ein Land im Krieg, das dennoch versucht, Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten und internationale Investoren anzuziehen. Ukrainische Unternehmen exportieren weiterhin Getreide, Stahlprodukte und IT-Dienstleistungen. Internationale Konferenzen diskutieren den Wiederaufbau und mobilisieren Milliarden an Hilfsgeldern. Die Ukraine genießt massive westliche Unterstützung, hat eine relativ entwickelte Infrastruktur (trotz Kriegsschäden), ein Bildungssystem und eine funktionierende Verwaltung in weiten Teilen des Landes. Zudem kämpft die Ukraine gegen einen externen Aggressor, was internationale Solidarität mobilisiert. Sudan hingegen ist ein Bürgerkrieg, bei dem beide Seiten Kriegsverbrechen begehen und internationale Sympathien begrenzt sind.
Somalia ist möglicherweise der vergleichbarste Fall: ein von Jahrzehnten des Bürgerkriegs und staatlichen Zusammenbruchs gezeichnetes Land. Doch selbst Somalia hat in Teilregionen – insbesondere im relativ stabilen Somaliland – eine bescheidene wirtschaftliche Entwicklung erlebt. Viehzucht, Geldtransfer-Dienstleistungen und lokaler Handel funktionieren. Somalische Diaspora-Gemeinden in Europa und Nordamerika sind stark und investieren in ihr Heimatland. Sudans Diaspora ist kleiner und weniger vernetzt, und das Kriegsgeschehen ist flächendeckender, sodass keine sicheren Teilregionen existieren, in denen Wirtschaftsaktivität gedeihen könnte.
Ruanda nach dem Genozid 1994 ist ein Beispiel für erfolgreiche Transformation nach katastrophaler Gewalt. Das Land erlebte innerhalb weniger Monate die Ermordung von etwa einer Million Menschen. Dennoch gelang eine bemerkenswerte Erholung, getrieben von starker (wenn auch autoritärer) Staatsführung, internationaler Hilfe, Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie einer bewussten Politik der Versöhnung und wirtschaftlichen Entwicklung. Sudan fehlt jede dieser Voraussetzungen: Es gibt keine anerkannte Regierung mit Autorität und Legitimität, internationale Hilfe ist begrenzt und oft blockiert, Bildung findet nicht statt, und Versöhnung ist angesichts der laufenden Gewalttaten unmöglich.
Der Irak nach 2003 ist ein weiterer Vergleich: ein von Krieg verwüstetes Land mit zerstörter Infrastruktur, aber enormen Ölreserven, die den Wiederaufbau finanzierten. Internationale Konzerne kehrten zurück, angelockt von Öl- und Bauaufträgen. Der entscheidende Unterschied: Der Irak hatte eine funktionierende Ölindustrie und massive internationale Militär- und Entwicklungshilfe. Sudan hat seine Ölreserven größtenteils mit der Unabhängigkeit Südsudans 2011 verloren; das verbliebene Öl wird im Krieg von den Konfliktparteien ausgebeutet, nicht zum Wiederaufbau genutzt.
Der Jemen, ähnlich wie der Sudan in einem brutalen Bürgerkrieg gefangen, zeigt die Gefahren einer anhaltenden Kriegsökonomie. Auch dort kontrollieren verschiedene Fraktionen (Huthis, saudisch-gestützte Regierung) Teile des Landes und finanzieren sich durch Rohstoffexporte, Schmuggel und externe Unterstützung. Die Wirtschaft ist kollabiert, die Bevölkerung leidet unter Hunger und Krankheiten. Der Vergleich zeigt: Ohne politische Lösung gibt es keine wirtschaftliche Zukunft. Sudan läuft Gefahr, ein “zweiter Jemen” zu werden – ein failed state mit permanentem Bürgerkrieg und humanitärer Dauerkrise.
Die Analyse zeigt, dass wirtschaftliche Erholung nach Konflikten möglich ist, aber spezifische Voraussetzungen erfordert: einen funktionierenden (auch wenn autoritären) Staat, Kontrolle über Rohstoffeinnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaus, massive internationale Unterstützung, eine gebildete und fähige Bevölkerung sowie ein Minimum an Sicherheit und Vorhersehbarkeit. Sudan erfüllt keine dieser Bedingungen. Stattdessen kombiniert das Land die schlimmsten Elemente: andauernden Krieg, zersplitterte Herrschaft, Plünderung von Ressourcen durch Kriegsparteien, fehlende internationale Priorität, Massenflucht der Bildungsschicht und totale Unsicherheit. In diesem Kontext von Geschäftsentwicklung oder Marktexpansion zu sprechen, ist nicht nur unrealistisch, sondern zynisch.
Die unbequemen Wahrheiten: Risiken, Abhängigkeiten und strukturelle Verwerfungen
Die kritische Würdigung der sudanesischen Wirtschaftssituation führt zu mehreren unbequemen Wahrheiten, die in euphemistischen Entwicklungsdiskursen oft ausgeblendet werden.
Erstens: Die Kriegsökonomie ist für bestimmte Akteure profitabel. General Dagalo, Anführer der RSF, gilt als einer der reichsten Männer Sudans, mit einem durch Goldhandel und Landbesitz erworbenen Vermögen. Die VAE profitieren vom billigen sudanesischen Gold und verkaufen im Gegenzug teure Waffen. Ägyptische Händler nutzen die Not sudanesischer Flüchtlinge aus. Warlords in Darfur kontrollieren Minen und Schmugglerrouten. Diese Akteure haben kein Interesse an Frieden und Rechtsstaatlichkeit, da dies ihre Profite gefährden würde. Solange die Anreizstrukturen Krieg belohnen, wird er weitergehen. Dies ist der “Ressourcenfluch” in Reinform: Rohstoffreichtum – insbesondere leicht extrahierbare und schmuggelbare Güter wie Gold – macht Krieg lukrativ und perpetuiert ihn.
Zweitens: Die internationale Gemeinschaft hat Sudan weitgehend aufgegeben. Während die Ukraine oder Gaza erhebliche internationale Aufmerksamkeit und Hilfsgelder erhalten, ist Sudan ein “vergessener Konflikt”. Die Gründe dafür sind vielfältig: geopolitische Bedeutungslosigkeit (Sudan ist weder energiepolitisch relevant noch strategisch zentral), Konfliktmüdigkeit nach Jahrzehnten sudanesischer Krisen, rassistische Hierarchien in der internationalen Aufmerksamkeitsökonomie und die Komplexität eines Bürgerkriegs ohne klare “gute” und “böse” Seite. Die Folge: Die humanitäre Hilfe ist massiv unterfinanziert. 2024 erhielt Sudan nur etwa ein Drittel der benötigten 4,2 Milliarden US-Dollar an humanitärer Hilfe. Entwicklungshilfe ist praktisch eingestellt. Diese internationale Vernachlässigung bedeutet, dass Sudan keine “Marshall-Plan”-ähnliche Wiederaufbauhilfe erwarten kann, wie sie anderen Krisenländern zuteilwurde.
Drittens: Die ökologischen und demographischen Langzeitfolgen sind verheerend. Millionen von Kindern erhalten keine Bildung, eine ganze Generation wächst in Gewalt, Hunger und Hoffnungslosigkeit auf. Die Traumatisierung ist umfassend. Gleichzeitig degradieren Umwelt und Agrarressourcen durch Übernutzung, fehlende Wartung von Bewässerungssystemen und klimatische Veränderungen. Die Desertifikation schreitet voran. Wenn der Krieg endet, wird Sudan eine ungebildete, traumatisierte Bevölkerung und degradierte natürliche Ressourcen haben – keine gute Ausgangsbasis für Entwicklung.
Viertens: Die soziale Fragmentierung und ethnische Spaltung werden durch den Krieg vertieft. Die RSF wird beschuldigt, ethnische Säuberungen in Darfur gegen nicht-arabische Bevölkerungsgruppen zu verüben. Die Armee bombardiert wahllos zivile Gebiete. Beide Seiten begehen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Diese Gräueltaten hinterlassen tiefe Gräben zwischen Gemeinschaften, die Generationen überdauern werden.
Selbst wenn ein Waffenstillstand erreicht wird, bleibt die Frage: Wie kann eine Gesellschaft, die sich derart zerfleischt hat, wieder zu friedlicher Koexistenz und wirtschaftlicher Kooperation finden? Die Erfahrungen aus Ruanda, Bosnien und anderen Postkonflikt-Gesellschaften zeigen, dass Versöhnung möglich ist, aber Jahrzehnte dauert und aktiver politischer Anstrengung bedarf – die im Sudan derzeit nicht absehbar ist.
Fünftens: Die Abhängigkeit von Rohstoffexporten perpetuiert Unterentwicklung. Sudans Exportstruktur – Gold, Sesam, Gummi Arabicum, Vieh – ist typisch für einen Rohstoffexporteur ohne Industrialisierung. Diese Produkte haben niedrige Wertschöpfung, volatile Preise und schaffen wenig Arbeitsplätze. Sie sind zudem anfällig für Kontrolle durch Eliten und Kriegsherren. Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung erfordert Industrialisierung, Diversifizierung und Wertschöpfungsketten – alles Dinge, die im kriegszerstörten Sudan unmöglich sind. Der Krieg hat die ohnehin schwache Industriebasis vernichtet; ein Wiederaufbau wird Jahrzehnte dauern.
Sechstens: Die bestehenden internationalen Sanktionen erschweren selbst wohlmeinende Geschäfte. UN-, EU- und US-Sanktionen umfassen Waffenembargos, Reiseverbote, Vermögenssperren gegen Einzelpersonen und Einschränkungen im Finanzverkehr. Während diese Sanktionen offiziell nur bestimmte Sektoren und Personen treffen, haben sie de facto eine abschreckende Wirkung auf jegliche Geschäftstätigkeit. Banken und Unternehmen meiden Sudan aus Angst vor Compliance-Verstößen. Dies bedeutet: Selbst wenn ein sudanesisches Unternehmen legitim exportieren wollte, würde es kaum eine internationale Bank finden, die Transaktionen abwickelt, und kaum einen Logistikdienstleister, der Waren transportiert.
Die kontroversen Debatten drehen sich um die Frage der Verantwortung und Lösung. Ist der Westen verpflichtet, Sudan zu helfen, oder ist dies eine “afrikanische” Krise, die von Afrikanern gelöst werden muss? Sollten Sanktionen verschärft werden, um Druck auf die Kriegsparteien auszuüben, oder erschweren sie die humanitäre Hilfe? Sollte man mit Warlords verhandeln, um Zugang für Hilfsorganisationen zu erhalten, oder legitimiert man damit Kriegsverbrecher? Diese Fragen haben keine einfachen Antworten, und die internationale Gemeinschaft bleibt zerstritten und handlungsunfähig.
Die Zielkonflikte sind offensichtlich: Sofortige humanitäre Hilfe versus langfristiger Staatsaufbau; Verhandlungen mit Kriegsparteien versus Gerechtigkeit für Opfer; Fokus auf urbane Zentren versus ländliche Regionen; Investition in Infrastruktur versus soziale Programme. In der aktuellen Kriegssituation dominiert zwangsläufig das Überleben; strategische Entwicklungsfragen sind Luxus. Doch ohne langfristige Perspektive wird Sudan in der Falle des failed state verbleiben.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Humanitäre Krise und Wirtschaft: Welche Rolle kann die Diaspora spielen?
Zwischen Dystopie und Hoffnung: Mögliche Entwicklungspfade bis 2035
Die Prognose für Sudan ist düster, aber nicht ohne Alternativen. Drei Szenarien zeichnen sich ab, die drastisch unterschiedliche Zukünfte skizzieren.
Szenario 1: Permanenter failed state
In diesem pessimistischen, aber leider realistischen Szenario setzt sich der Bürgerkrieg über Jahre fort, ohne dass eine Seite einen entscheidenden militärischen Sieg erringt. Sudan zerfällt in Einflusssphären, die von verschiedenen Milizen, Warlords und ausländischen Akteuren kontrolliert werden. Die Kriegsökonomie basierend auf Gold, Schmuggel und externer Unterstützung verstetigt sich. Die humanitäre Katastrophe wird zum Dauerzustand. Millionen bleiben in Flüchtlingslagern in Nachbarländern, die zunehmend feindselig werden. Die internationale Gemeinschaft gewöhnt sich an die Krise und reduziert ihre ohnehin unzureichende Hilfe weiter. Sudan wird zu einem “zweiten Somalia” oder “Jemen” – ein dauerhaft gescheiterter Staat am Rande der Weltgemeinschaft. In diesem Szenario ist jede wirtschaftliche Entwicklung unmöglich; das Land bleibt auf unabsehbare Zeit ein Kriegsgebiet und eine humanitäre Katastrophe. Eine Expansion sudanesischer Firmen nach Europa wäre so absurd wie die Vorstellung, dass somalische Piraten Boutiquen in Hamburg eröffnen.
Szenario 2: Fragile Stabilisierung und langsamer Wiederaufbau
In diesem gemäßigt optimistischen Szenario gelingt es in den nächsten Jahren, einen brüchigen Waffenstillstand zu erreichen, vielleicht vermittelt durch die Afrikanische Union, IGAD oder internationale Mächte. Die Kriegsparteien einigen sich auf eine Machtteilung oder eine Föderation mit autonomen Regionen. Unter internationaler Aufsicht beginnt ein Wiederaufbauprozess, der an die HIPC-Schuldenerlasse von 2021 anknüpft. Internationale Entwicklungsbanken und bilaterale Geber stellen Milliarden zur Verfügung. Priorität haben die Wiederherstellung von Basisinfrastruktur, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie Landwirtschaft.
In diesem Szenario könnte Sudan bis 2030-2035 eine bescheidene Erholung erleben. Modellrechnungen zeigen, dass bei Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Produktivität auf Vorkriegsniveau und Investitionen von etwa 1 Milliarde US-Dollar in Infrastruktur die Armut um 1,9 Millionen Menschen reduziert werden könnte. Die Wirtschaft könnte um jährlich 3-5 Prozent wachsen, was aber angesichts der massiven Verluste nur eine langsame Erholung bedeutet. Die Bevölkerung bliebe weitgehend arm, und Sudan würde ein typisches LDC (Least Developed Country) bleiben, abhängig von Rohstoffexporten und internationaler Hilfe.
In diesem Szenario könnte es einzelne sudanesische Unternehmen geben – hauptsächlich in der Agroproduktion (Gummi Arabicum, Sesam) oder im Dienstleistungsbereich (etwa von der Diaspora gegründete Startups) –, die bescheidene Exporte aufnehmen. Doch auch hier würde es sich um Nischenprodukte handeln, nicht um eine breite Exportoffensive. Der Markteintritt in Europa wäre mühsam, erfordert jahrelange Vorbereitung, Zertifizierungen und Kapital. Bestenfalls könnten Fair-Trade-zertifizierte Produkte aus Sudan in spezialisierten Läden auftauchen, vermarktet mit der Geschichte des Wiederaufbaus – ähnlich wie ruandischer Kaffee oder bosnisches Handwerk nach dortigen Konflikten. Von einer “Eroberung” des europäischen Marktes kann keine Rede sein.
Szenario 3: Transformative Renaissance
In diesem optimistischen, aber höchst unwahrscheinlichen Szenario endet der Krieg schnell durch einen umfassenden Friedensschluss, der von einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung getragen wird. Eine demokratische Übergangsregierung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft übernimmt die Macht. Die internationale Gemeinschaft, beeindruckt von diesem Kurswechsel, mobilisiert massive Unterstützung im Stil eines “Marshall-Plans für Sudan”. Es kommt zu Wahrheits- und Versöhnungskommissionen nach ruandischem oder südafrikanischem Vorbild. Investitionen fließen in Bildung, Gesundheit, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur.
Sudan nutzt sein enormes landwirtschaftliches Potenzial – 85 Millionen Hektar Ackerland, Zugang zum Nil, geeignetes Klima – und wird zur “Kornkammer Ostafrikas”. Die Goldproduktion wird legalisiert und reguliert, Einnahmen fließen in den Staatshaushalt. Eine junge, technisch versierte Generation baut Start-ups auf, insbesondere in Fintech, Agritech und erneuerbaren Energien. Die sudanesische Diaspora kehrt mit Kapital und Know-how zurück. Bis 2035 ist Sudan ein middle-income country mit funktionierender Demokratie, diversifizierter Wirtschaft und wachsender Mittelschicht.
In diesem Szenario könnten tatsächlich sudanesische Firmen internationale Märkte anvisieren – Lebensmittelproduzenten, die Bio-Produkte nach Europa exportieren; IT-Unternehmen, die Dienstleistungen für internationale Kunden erbringen; Logistikfirmen, die Sudans strategische Lage zwischen Afrika und Nahem Osten nutzen. Doch selbst in diesem optimistischsten Szenario würde eine solche Entwicklung 10-15 Jahre dauern und massive Voraussetzungen erfordern.
Szenarien für Sudan: Entwicklungschance oder dauerhaftes Scheitern?
Die Realität wird vermutlich irgendwo zwischen Szenario 1 und 2 liegen: Ein brüchiger Waffenstillstand nach Jahren weiteren Krieges, gefolgt von einem mühsamen, unterfinanzierten Wiederaufbau. Potenzielle Disruptionen sind zahlreich: klimatische Schocks (Dürren, Überschwemmungen) könnten die ohnehin fragile Ernährungssicherheit weiter gefährden; regionale Konflikte (etwa ein erneuter Bürgerkrieg im Südsudan oder Instabilität in Äthiopien) könnten auf Sudan übergreifen; globale Wirtschaftskrisen könnten Rohstoffpreise einbrechen lassen und Entwicklungshilfe reduzieren; technologische Veränderungen (etwa Alternativen zu Gummi Arabicum) könnten Sudans Exportmärkte zerstören.
Regulatorische Veränderungen in der EU könnten ebenfalls Auswirkungen haben: Strengere Regeln zu Konfliktmineralien, Herkunftsnachweisen und Nachhaltigkeit würden es sudanesischen Exporteuren noch schwerer machen, europäische Märkte zu erreichen. Gleichzeitig könnten EU-Programme zur Förderung afrikanischer Entwicklung – wie die Global Gateway Initiative – theoretisch Chancen bieten, wenn Sudan die politischen und wirtschaftlichen Mindeststandards erfüllt.
Die geopolitischen Konstellationen sind ebenfalls unsicher. China und Russland haben historisch Interessen in Sudan (Öl, Bergbau, Hafenzugang am Roten Meer), aber ihre Bereitschaft, ein kriegszerstörtes Land zu unterstützen, ist begrenzt. Die Golfstaaten (VAE, Saudi-Arabien) sind sowohl Teil des Problems (Waffenlieferungen, Goldschmuggel) als auch potenzielle Partner für Wiederaufbau. Die EU und USA haben Sudan weitgehend abgeschrieben, könnten aber bei politischem Wandel wieder Interesse zeigen, nicht zuletzt wegen der Migrationskontrolle.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Sudan steht vor einem langen, steinigen Weg. Im besten Fall – fragiler Frieden und internationaler Wiederaufbau – wird das Land bis 2035 bescheidene Fortschritte machen und ein Entwicklungsland mit niedrigem Einkommen bleiben. Im schlimmsten Fall – anhaltender Bürgerkrieg – wird Sudan ein permanenter failed state. In keinem realistischen Szenario werden sudanesische Firmen in den nächsten zehn Jahren in der Lage sein, europäische Märkte substanziell zu erobern oder Deutschland als “Ausgangsbasis” zu nutzen. Die Vorstellung bleibt, was sie ist: eine Illusion, fern jeder ökonomischen Realität.
Die bittere Bilanz: Kein Land für Unternehmer
Die abschließende Einordnung muss nüchtern ausfallen: Der Sudan in seiner gegenwärtigen Verfassung ist kein Ort für unternehmerische Ambitionen, geschweige denn für internationale Geschäftsexpansion. Die umfassende Analyse führt zu mehreren zentralen Erkenntnissen, die für politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsakteure und auch für sudanesische Diaspora-Gemeinschaften relevant sind.
Erstens: Die sudanesische Wirtschaft existiert derzeit nicht als funktionierendes System. Was im Sudan stattfindet, ist keine Wirtschaft im modernen Sinne – mit Märkten, Institutionen, Rechtssicherheit und arbeitsteiliger Produktion – sondern eine Kriegsökonomie, in der militärische Akteure Ressourcen plündern, die Bevölkerung ums Überleben kämpft und jegliche produktive Aktivität auf Subsistenzniveau zusammengebrochen ist. Von diesem Ausgangspunkt aus von “Markterschließung” oder “Expansion” zu sprechen, verkennt die Grundlagen wirtschaftlichen Handelns fundamental.
Zweitens: Die Frage nach sudanesischen Branchen, die sich nach Europa ausweiten könnten, ist falsch gestellt. Sie setzt voraus, was nicht existiert: funktionsfähige sudanesische Unternehmen mit Produktionskapazitäten, Exportfähigkeit und strategischem Geschäftssinn. Die Realität ist: Die wenigen Firmen, die überlebt haben, kämpfen ums blanke Überleben. Neue Kleinstunternehmen, die während des Krieges entstanden sind, bedienen lokale Grundbedürfnisse unter primitivsten Bedingungen. Weder die einen noch die anderen haben Ressourcen, Kapital oder Know-how für internationale Geschäfte.
Drittens: Selbst in den theoretisch exportfähigen Sektoren – Gummi Arabicum, Sesam, Gold, Viehwirtschaft – verhindern strukturelle Hindernisse jede ernst zu nehmende Exportoffensive. Diese Hindernisse umfassen: Kontrollverlust über Produktionsgebiete durch Kriegshandlungen, Unterbrechung von Lieferketten und Logistik, Qualitätsverlust und fehlende Zertifizierungen, internationale Sanktionen und Compliance-Risiken, Hyperinflation und Währungsverfall, Bankenkollapspezielle und Unmöglichkeit internationaler Zahlungen, Reputationsschäden durch Assoziation mit Krieg und Konfliktmineralien. Diese Hindernisse sind nicht durch Marketing oder Business Development überwindbar; sie sind fundamentale, systemische Probleme, die nur durch Friedensschluss, Staatswiederaufbau und jahrelange institutionelle Entwicklung gelöst werden können.
Viertens: Die Rolle eines “deutschen Partners im Bereich Marketing, PR und Business Development” wäre, wenn überhaupt, die eines Realitätsberaters. Ein seriöser deutscher Dienstleister müsste sudanesischen Interessenten erklären, dass eine Europa-Expansion unter gegenwärtigen Bedingungen unmöglich ist und dass jegliche Ressourcen stattdessen auf Überleben, humanitäre Hilfe und langfristige Vorbereitung eines Wiederaufbaus konzentriert werden sollten. Marketing kann keine Produkte schaffen, die nicht existieren. PR kann kein Image polieren, das durch Krieg, Hunger und Gräueltaten fundamental beschädigt ist. Business Development kann keine Geschäfte entwickeln, wo es keine Geschäftsgrundlage gibt.
Fünftens: Die langfristige Bedeutung des sudanesischen Zusammenbruchs geht über Sudan selbst hinaus. Mit 12,9 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen destabilisiert der Konflikt die gesamte Region – Ägypten, Tschad, Südsudan, Äthiopien sind überfordert mit der Aufnahme von Sudanesen. Die Famine-Situation wird langfristige Gesundheits- und Entwicklungsschäden für Millionen von Kindern verursachen. Die regionale wirtschaftliche Integration – etwa durch die afrikanische Freihandelszone AfCFTA – wird durch Sudans Kollaps behindert. Sudan ist nicht nur ein nationales Desaster, sondern eine regionale Katastrophe mit globalen Implikationen (Migration, Extremismus, humanitäre Kosten).
Sechstens: Die strategischen Implikationen für unterschiedliche Akteure sind klar. Für europäische und deutsche Unternehmen gilt: Sudan ist kein Markt. Es gibt dort nichts zu kaufen und nichts zu verkaufen, das sich lohnen würde. Engagement sollte rein humanitär sein oder – für Bauunternehmen, Infrastruktur-Spezialisten – auf einen fernen Wiederaufbau nach Kriegsende ausgerichtet sein, ähnlich wie Firmen sich im Hinblick auf den Ukraine-Wiederaufbau positionieren. Für politische Entscheidungsträger in Deutschland und der EU gilt: Sudan braucht keine Handelsförderung, sondern Konfliktvermittlung, humanitäre Hilfe und langfristige Entwicklungsstrategie. Die bestehenden Sanktionen sollten gezielt bleiben, um Warlords zu treffen, ohne humanitäre Hilfe zu behindern. Für internationale Investoren gilt: Sudan ist auf unabsehbare Zeit ein No-Go. Das politische Risiko ist maximal, Rechtssicherheit existiert nicht, Enteignung und Gewalt sind jederzeit möglich. Für sudanesische Diaspora-Gemeinschaften gilt: Engagement ist wichtig für langfristigen Wiederaufbau, aber unter realistischen Prämissen. Diaspora-Investitionen sollten auf Bildung, Gesundheit und Zivilgesellschaft fokussieren, nicht auf kurzfristige Geschäfte.
Siebtens: Es gibt eine bittere Ironie in der ursprünglichen Fragestellung. Die Idee, dass sudanesische Firmen Europa “erobern” könnten, kehrt die tatsächliche Machtdynamik um. Historisch haben europäische Kolonialmächte – Großbritannien, Frankreich – Afrika ausgebeutet und dominiert. Auch heute fließen Rohstoffe aus Afrika nach Europa, während Fertigwaren und Kapital in die andere Richtung gehen – eine strukturelle Ungleichheit, die sich verschärft, nicht verringert. Sudan ist das extreme Beispiel eines Landes am absoluten unteren Ende dieser Hierarchie: arm, kriegszerrüttet, rohstoffabhängig, ohne technologische Fähigkeiten oder institutionelle Kapazitäten. Die Vorstellung, solche Länder könnten entwickelte europäische Märkte “erobern”, ignoriert diese strukturellen Realitäten vollständig.
Die finale Bewertung lautet daher: Sudan ist kein Partner für Geschäftsexpansion, sondern ein humanitärer Notfall von historischem Ausmaß. Die Priorität muss auf Beendigung des Krieges, Linderung menschlichen Leids und langfristigem Staatsaufbau liegen. Erst wenn diese fundamentalen Voraussetzungen geschaffen sind – und das wird im besten Fall Jahrzehnte dauern – können Fragen nach Wirtschaftsentwicklung, Export und internationaler Integration sinnvoll gestellt werden. Bis dahin bleibt jede Diskussion über sudanesische Markteroberung in Europa nicht nur unrealistisch, sondern auch zynisch angesichts des unermesslichen Leids der sudanesischen Bevölkerung.
Die strategische Empfehlung für alle beteiligten Akteure ist eindeutig: Realistischen Blick bewahren, keine falschen Hoffnungen wecken, humanitäre Prioritäten setzen und für den langen, mühsamen Weg des Wiederaufbaus vorbereiten – aber keine Geschäftsabenteur unternehmen in einem Land, das derzeit nur als Kriegsgebiet existnehmen in einem Land, das derzeit nur als Kriegsgebiet existiert.
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder
mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.