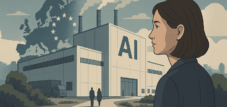EU’s große Zukunftsstrategie “Strategischer Vorausschau-Bericht 2025” – Experten kritisieren Mangel an neuen Ideen
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 8. Oktober 2025 / Update vom: 8. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein
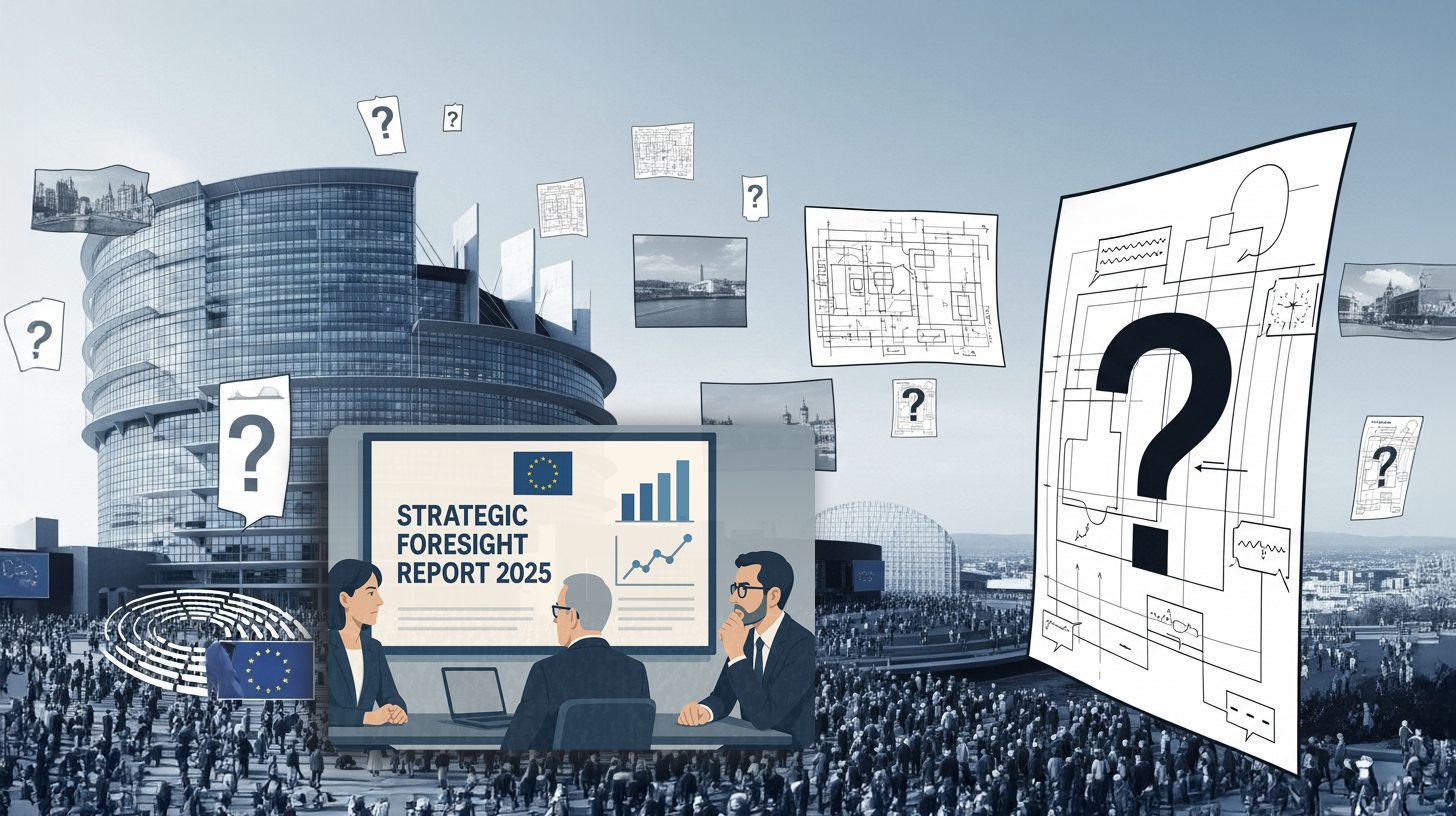
EU’s große Zukunftsstrategie “Strategischer Vorausschau-Bericht 2025” – Experten kritisieren Mangel an neuen Ideen – Bild: Xpert.Digital
Neuer EU-Plan vorgestellt: Genialer Wurf oder nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Mehr Polit-Show als echte Strategie?
Die Europäische Kommission hat mit ihrem “Strategischen Vorausschau-Bericht 2025” einen ambitionierten Fahrplan für die Zukunft der EU vorgelegt. Unter dem Schlagwort “Resilienz 2.0” soll die Union proaktiver und widerstandsfähiger gegen Krisen wie den Klimawandel, technologische Umbrüche und geopolitische Spannungen gemacht werden. Der Bericht skizziert eine Vision, wie die EU in einer Welt voller Turbulenzen nicht nur bestehen, sondern gestärkt hervorgehen kann.
Doch kaum veröffentlicht, gerät das Papier in die scharfe Kritik des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS). In einer detaillierten Analyse kommen die Experten zu einem ernüchternden Urteil: Bei dem Bericht handle es sich weniger um eine fundierte Zukunfts-Analyse als vielmehr um eine politische Agenda für die neue Legislaturperiode. Der Hauptvorwurf lautet, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen kaum neu sind und stattdessen bereits bekannte politische Ziele wiederholen, ohne konkrete Lösungsansätze zu bieten.
Im Kern identifiziert der Kommissionsbericht vier zentrale Spannungsfelder, in denen die EU navigieren muss: den Konflikt zwischen Wettbewerbsfähigkeit und strategischer Autonomie, die Balance zwischen KI-Innovation und Schutzmechanismen, den Spagat zwischen Wohlstand und demografischem Wandel sowie die Verteidigung der Demokratie gegen den Einfluss von Algorithmen. Die Analyse des Parlamentsdienstes legt jedoch nahe, dass die vorgeschlagenen Handlungsbereiche sehr eng an die politische Linie von Kommissionspräsidentin von der Leyen angelehnt sind. Das Dokument dient den EU-Abgeordneten somit als wichtige Einordnung: Der Vorstoß der Kommission ist weniger eine neutrale Bestandsaufnahme als der strategische Auftakt zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele in den kommenden Jahren.
Passend dazu:
- European Parliament – Directorate-General for Parliamentary Research Services | Strategic Foresight Report 2025: Resilience 2.0
- Think Tank – European Parliament | Strategic Foresight Report 2025: Resilience 2.0
Strategischer Vorausschaubericht 2025: Eine umfassende Analyse
Grundlagen und Kontext des Berichts
Was ist der Strategische Vorausschaubericht 2025?
Der Strategische Vorausschaubericht 2025, mit dem offiziellen Titel „Resilienz 2.0: Die EU befähigen, in Zeiten von Turbulenzen und Unsicherheit zu gedeihen“, ist ein Schlüsseldokument, das von der Europäischen Kommission am 9. September 2025 vorgelegt wurde. Es handelt sich um den ersten Vorausschaubericht der zweiten von der Leyen-Kommission. Das Dokument baut auf etablierten Trends auf und bietet eine aktualisierte Analyse der globalen und EU-spezifischen Herausforderungen. Sein zentrales Anliegen ist es, die Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz, der Europäischen Union zu stärken, um sie für die Zukunft besser zu wappnen. Der Bericht dient als Grundlage für eine neue Vorausschau-Zyklus und soll die politische Agenda der kommenden Jahre mit einer langfristigen Perspektive untermauern.
Was ist der übergeordnete Zweck dieser Art von Vorausschauberichten?
Seit dem Jahr 2020 veröffentlicht die Europäische Kommission jährlich, mit Ausnahme des Wahljahres 2024, einen solchen strategischen Vorausschaubericht. Diese Berichte verfolgen einen doppelten Zweck: Zum einen untersuchen sie zukünftige Entwicklungen und Trends, die die EU beeinflussen könnten, und zum anderen beleuchten sie die aktuellen Prioritäten der Union. Laut der Kommission sollen diese Berichte dazu dienen, die politischen Prioritäten zu untermauern und das langfristige politische Denken bei querschnittlichen Themen zu fördern. Diese Praxis ist Teil einer breiteren Bemühung innerhalb der EU-Institutionen, die politische Vorausschau, auch bekannt als „Foresight“, zu stärken. Die treibende Überzeugung dahinter ist, dass traditionelle Planungs- und Politikgestaltungsprozesse nicht mehr ausreichen, um den komplexen und miteinander verknüpften Herausforderungen der sogenannten „Polykrisen“, mit denen die EU konfrontiert ist, wirksam zu begegnen. Es geht also darum, proaktiv statt nur reaktiv zu handeln.
In welchem Kontext wurde der Bericht 2025 vorgestellt?
Der Bericht wurde von Kommissar Micallef als eine „Brücke zwischen der Vorausschauarbeit der letzten Kommission und dem neuen Mandat“ bezeichnet. Dies unterstreicht seinen Übergangscharakter. Er knüpft an eine Reihe wichtiger strategischer Dokumente an, die kurz zuvor veröffentlicht wurden. Dazu gehören die Berichte von Enrico Letta und Mario Draghi, die sich intensiv mit dem Binnenmarkt und der Wettbewerbsfähigkeit Europas auseinandersetzen, sowie der Niinistö-Bericht. Zudem ist er eng mit der Strategischen Agenda 2024-2029 des Rates und der EU-Strategie für eine Bereitschaftsunion vom Mai 2025 verknüpft. Der Bericht versucht somit, die Erkenntnisse und Stoßrichtungen dieser verschiedenen Initiativen zu bündeln und in einen kohärenten Rahmen für die Zukunft zu gießen.
Das Kernkonzept: Resilienz 2.0
Was ist das zentrale Thema des Berichts und was genau bedeutet „Resilienz 2.0“?
Das zentrale und leitende Thema des Berichts ist die Resilienz. Dies war bereits das Hauptthema des allerersten Vorausschauberichts im Jahr 2020. Die Kommission argumentiert jedoch, dass sich die globale Situation seither so dramatisch verändert hat, dass ein neuer, weiterentwickelter Ansatz für Resilienz erforderlich ist. Diesen neuen Ansatz nennt sie „Resilienz 2.0“. Diese neue Form der Resilienz soll transformativer, proaktiver und vorausschauender sein als die bisherige Konzeption. Während die ursprüngliche Idee von Resilienz bereits das Konzept umfasste, dass die EU sich transformieren und „vorwärts springen“ (bounce forward) soll, um nachhaltiger, fairer und demokratischer zu werden, scheint „Resilienz 2.0“ eine noch stärkere Betonung auf eine aktive Gestaltung der Zukunft und eine tiefgreifende Anpassung an eine unsicherere Welt zu legen. Der Text merkt allerdings kritisch an, dass nicht vollständig klar wird, worin der genaue Unterschied zur vorherigen Version besteht, da diese bereits sehr ambitioniert formuliert war. Das Rebranding zu „2.0“ dient also auch dazu, ein Gefühl der Dringlichkeit und der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels zu vermitteln.
Welche fundamentalen Ziele soll eine resiliente EU bis zum Jahr 2040 laut dem Bericht erreichen?
Der Bericht definiert drei grundlegende Pfeiler oder „Fundamentals“, die eine widerstandsfähige Europäische Union im Jahr 2040 auszeichnen müssten. Erstens, die Gewährleistung von Frieden durch europäische Sicherheit. Dies spiegelt die veränderte geopolitische Lage wider, in der Sicherheitsfragen eine zentrale Rolle in allen Politikbereichen einnehmen. Zweitens, die Wahrung der Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Dies ist eine Reaktion auf interne und externe Bedrohungen dieser Grundwerte. Drittens, die Sicherstellung des Wohlergehens der Menschen. Dieses Ziel ist breit gefasst und umfasst soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte des Lebens in der EU. Diese drei Fundamentals bilden den übergeordneten Rahmen, innerhalb dessen die spezifischen Herausforderungen und Handlungsfelder des Berichts zu verstehen sind.
Globale Entwicklungen und EU-spezifische Herausforderungen
Welche globalen Entwicklungen identifiziert der Bericht als besonders einflussreich für die EU?
Der Bericht benennt drei globale Entwicklungen, die einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft der EU haben. Die erste ist die wachsende Zentralität von Sicherheitsfragen in allen Politikbereichen. Sicherheit wird nicht mehr als isoliertes Thema der Verteidigungs- oder Außenpolitik betrachtet, sondern als ein Querschnittsthema, das die Wirtschafts-, Energie-, Gesundheits- und sogar die Bildungspolitik durchdringt. Die zweite Entwicklung ist die Erosion der regelbasierten internationalen Ordnung. Institutionen und Abkommen, die jahrzehntelang für Stabilität sorgten, verlieren an Einfluss, was zu einer unberechenbareren und konfrontativeren Welt führt. Die dritte globale Entwicklung sind die anhaltenden Auswirkungen des Klimawandels sowie die fortschreitende Verschlechterung des Zustands von Natur und Wasserressourcen. Diese ökologischen Krisen haben direkte Konsequenzen für die Sicherheit, die Wirtschaft und das Wohlergehen in der EU.
Der Bericht spricht von vier EU-spezifischen Herausforderungen als „Balanceakte“. Was ist damit gemeint und welches ist der erste Balanceakt?
Die vier EU-spezifischen Herausforderungen werden als „Balanceakte“ dargestellt. Diese Formulierung unterstreicht die inhärenten Zielkonflikte und die Schwierigkeiten, mit denen politische Entscheidungsträger konfrontiert sind. Es geht nicht um einfache Lösungen, sondern um das Austarieren konkurrierender Prioritäten.
Der erste Balanceakt besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern und gleichzeitig ihre offene strategische Autonomie zu verfolgen. Einerseits muss die EU offen für den Welthandel und attraktiv für Investitionen bleiben, um Innovation und wirtschaftliche Stärke zu erhalten. Andererseits muss sie ihre Abhängigkeiten von externen Akteuren und ihre Anfälligkeit für Schocks reduzieren. Der Bericht schlägt vor, dass nationale Interessen gelegentlich hinter gemeinsamen Maßnahmen wie der gemeinsamen Energiebeschaffung oder der bevorzugten Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen aus der EU zurückstehen sollten. Ein konkretes Beispiel für die Abhängigkeit ist der digitale Sektor, wo 70 % der Cloud-Infrastruktur der EU von nur drei US-amerikanischen Unternehmen kontrolliert werden. Eine größere Unabhängigkeit soll auch durch den Ausbau sauberer Energien, eine verbesserte Energieeffizienz und die Förderung der Kreislaufwirtschaft erreicht werden, um die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern.
Was ist der zweite beschriebene Balanceakt?
Der zweite Balanceakt befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen der Förderung technologischer Innovation und der Schaffung und Aufrechterhaltung von Schutzmechanismen. Einerseits soll ein wettbewerbsfähiges Umfeld geschaffen werden, das das volle Potenzial neuer Technologien entfesselt und so die wirtschaftliche Resilienz der EU stärkt. Andererseits müssen angemessene Schutzvorkehrungen getroffen werden, um Risiken für die Sicherheit, die Rechte von Bürgern und Arbeitnehmern, die Privatsphäre, die Umwelt und die Demokratie abzuwehren. Der Bericht nennt hier explizit neue Technologien wie Quantencomputing, Biotechnologie, Neurotechnologie, fortschrittliche Materialien, Robotik und insbesondere künstliche Intelligenz (KI). Bei der KI stellt die Kommission fest, dass sie sich zwar rasch verbreitet hat, die Marktdominanz einiger weniger globaler Akteure jedoch die Grenzen zwischen kommerziellen und öffentlichen Akteuren und Räumen verschwimmen lässt.
Was ist der dritte Balanceakt?
Der dritte Balanceakt thematisiert die Herausforderung, das hohe Niveau des Wohlergehens in der EU aufrechtzuerhalten und gleichzeitig auf den demografischen Wandel und den Klimawandel zu reagieren. Die EU ist für ihren hohen Lebensstandard, ihre starken Volkswirtschaften, ihre Umweltstandards und ihr Gesundheitswesen bekannt. Dieses Modell steht jedoch unter Druck. Der demografische Wandel, insbesondere die alternde Bevölkerung, führt dazu, dass weniger Menschen zur Wirtschaft beitragen, während der Bedarf an Pflege und Gesundheitsdienstleistungen steigt. Der Bericht vermeidet eine ausführliche Diskussion über Migration, deutet aber an, dass reguläre Migration ein möglicher Weg sei, um den Bedarf auf den EU-Arbeitsmärkten mit Talenten aus dem Ausland zu decken. Darüber hinaus stellt der Bericht eine direkte Verbindung zwischen dem Wohlergehen der Menschen und der Gesundheit des Planeten her. Es wird argumentiert, dass ein Handeln im Einklang mit der Natur zur Sicherheit und zum wirtschaftlichen Wohlstand beiträgt, beispielsweise indem Klimaschutz und -anpassung helfen, Pandemien einzudämmen oder die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.
Und was ist der vierte und letzte Balanceakt?
Der vierte Balanceakt konzentriert sich auf die Spannung zwischen der Notwendigkeit, die Demokratie und die Grundwerte zu wahren, und der Anpassung an die algorithmusbasierte Nutzung von (sozialen) Medien. Der Bericht fordert eine Stärkung der demokratischen Entscheidungsfindung, erkennt aber gleichzeitig an, dass die Meinungsbildung der Menschen zunehmend durch algorithmusbasierte, personalisierte Quellen geprägt wird. Dies schränkt den gemeinsamen Raum für eine demokratische Debatte, die auf geteilten Fakten und Beweisen beruht, erheblich ein. Zusätzlich warnt der Bericht vor einer „neuen globalen Oligarchie“, in der einige wenige Tech-Milliardäre zunehmend Einfluss auf demokratische Prozesse nehmen. Dies kann die Demokratie weiter schwächen und das Vertrauen der Bürger untergraben. Als Antwort darauf fordert der Bericht eine Stärkung der demokratischen Resilienz durch sozialen Zusammenhalt, institutionelle Kontrollmechanismen („Checks and Balances“) und innovative Verbesserungen der Demokratie selbst.
Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen
Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.
Passend dazu:
EU-Resilienz im Check: Chancen, Lücken und konkrete Kritikpunkte
Kritik am EU-Bericht: Warum konkrete Umsetzungswege fehlen
Der Strategische Vorausschaubericht 2025 setzt acht Handlungsbereiche auf die Agenda, um die Resilienz der EU gegen geopolitische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Risiken zu stärken. Inhaltlich deckt der Bericht zentrale Felder ab — von globaler Vision über Sicherheit, Technologie und wirtschaftliche Resilienz bis hin zu Bildung, Demokratie und Generationengerechtigkeit — und spiegelt damit die Leitlinien von Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie die Strategische Agenda des Rates wider. Kritisch ist allerdings, dass der Bericht oft eher wie eine politische Agenda wirkt: Konkrete Verknüpfungen zwischen den benannten Herausforderungen und den vorgeschlagenen Maßnahmen fehlen, Umsetzungswege bleiben vage, und echte Innovationen sind selten. Auffällig bleibt die Diskrepanz zwischen ambitionierten Zielen (z. B. globale KI-Standards oder WTO-Reform) und der realpolitischen Handlungsfähigkeit der EU. Für Parlamente stellt der Bericht eine Herausforderung dar: sektorübergreifende Themen lassen sich schwer in klassischen Ausschussstrukturen behandeln, weshalb verschiedene Modelle parlamentarischer Vorausschau diskutiert werden — von spezialisierten Ausschüssen über einzelne Ombudspersonen bis zur Integration von Vorausschau in Gesetzgebungsprozesse.
Die acht Handlungsbereiche und die kritische Bewertung
Welche acht Handlungsbereiche schlägt der Bericht vor, um die Resilienz der EU zu stärken?
Der letzte Teil des Berichts identifiziert acht zentrale Handlungsbereiche, in denen die Resilienz der EU gestärkt werden soll. Diese sollen sowohl die EU-spezifischen Herausforderungen als auch die globalen Entwicklungen adressieren. Die acht Bereiche sind:
- Eine globale Vision entwickeln.
- Die innere und äußere Sicherheit verstärken.
- Technologie und Forschung nutzbar machen.
- Die wirtschaftliche Resilienz stärken.
- Nachhaltiges und inklusives Wohlergehen fördern.
- Bildung neu denken.
- Die Fundamente der Demokratie stärken.
- Die Generationengerechtigkeit stärken.
Diese Bereiche spiegeln die politischen Leitlinien der zweiten von der Leyen-Kommission und die Strategische Agenda des Europäischen Rates wider.
Welche Kritik wird an der Darstellung dieser Handlungsbereiche geübt?
Das Briefing übt eine recht deutliche Kritik an diesem Abschnitt des Berichts. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass keine expliziten Verbindungen zwischen den acht vorgeschlagenen Handlungsbereichen und den zuvor identifizierten Herausforderungen oder globalen Entwicklungen hergestellt werden. Dies schwächt den Fokus und die Wirkung der Vorschläge. Der Bericht hätte an Überzeugungskraft gewonnen, wenn die Aktionen klarer den spezifischen Problemen zugeordnet worden wären.
Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist, dass dieser Abschnitt sich weniger wie eine vorausschauende Analyse liest, sondern vielmehr wie eine politische Agenda oder eine Sammlung von Absichtserklärungen. Der Ton wird als eher direktiv beschrieben, mit häufigen Formulierungen wie „die EU muss“ oder „die EU sollte“.
Darüber hinaus wird bemängelt, dass die vorgeschlagenen Aktionen nur wenige Überraschungen enthalten und größtenteils auf bereits existierenden Politiken und Zielen der Kommission aufbauen. Es werden kaum wirklich neue Wege oder Instrumente aufgezeigt, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.
Konkrete Beispiele für Kritik, insbesondere hinsichtlich der Umsetzbarkeit
Das Briefing nennt konkrete Beispiele, die die Kritik untermauern. Im Bereich der „globalen Vision“ fordert der Bericht beispielsweise, dass die EU die Diskussion über eine Reform des Multilateralismus, einschließlich einer Reform der Welthandelsorganisation (WTO), gestalten solle. Der kritische Kommentar dazu lautet, dass der Bericht nicht erklärt, wie dies erreicht werden soll, insbesondere in einer Zeit, in der die Fähigkeit der EU, ihre handelspolitischen Instrumente vollständig einzusetzen, unter Druck steht, vor allem durch die USA.
Ein weiteres Beispiel betrifft die Künstliche Intelligenz. Der Bericht fordert die Festlegung globaler Standards und den Aufbau strategischer Autonomie in der KI-Forschung. Auch hier wird die Frage aufgeworfen, wie dies gelingen soll, wenn der Bericht selbst zuvor festgestellt hat, dass der KI-Sektor von „einigen wenigen Tech-Milliardären“ dominiert wird, die Teil einer „neuen globalen Oligarchie“ sind. Die Diskrepanz zwischen der ambitionierten Forderung und der realistischen Machtverteilung wird nicht aufgelöst.
Im Bereich der wirtschaftlichen Resilienz werden viele Ziele genannt, wie die industrielle Transformation oder die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten, aber es werden keine neuen Wege zur Erreichung dieser Ziele aufgezeigt. Forderungen nach einer Kreislaufwirtschaft oder einer echten Spar- und Investitionsunion sind Wiederholungen bestehender politischer Ziele.
Gibt es überhaupt neue Ideen oder Ansätze in den Handlungsbereichen?
Der Text deutet an, dass die meisten Vorschläge Wiederholungen bekannter politischer Forderungen sind. So ist der Ruf nach einer Steuerverlagerung weg von der Arbeit hin zur Besteuerung negativer externer Effekte (wie Umweltverschmutzung) eine langjährige Forderung in der EU-Politik. Ebenso ist das Ziel, die Bürger nicht nur auf spezifische Berufe, sondern auf mehrfache Übergänge im Laufe ihres Lebens vorzubereiten, seit langem Teil der bildungspolitischen Debatte. Die einzige Forderung, die als wirklich neu und als eine Form der antizipatorischen Regierungsführung hervorgehoben wird, ist der Ruf nach der „Förderung der KI-Kompetenz“ (AI literacy) in der Bevölkerung.
Einordnung des Berichts im strategischen Kontext der EU
Wie verhält sich der Strategische Vorausschaubericht 2025 zur Strategischen Agenda 2024-2029 des Rates?
Bei einem Vergleich der beiden Dokumente fallen sowohl Gemeinsamkeiten als auch bemerkenswerte Unterschiede auf. Zwei der drei fundamentalen Ziele des Vorausschauberichts, nämlich die Erreichung von Frieden durch europäische Sicherheit und die Wahrung von Demokratie und Menschenrechten, spiegeln direkt zwei der Hauptthemen der Strategischen Agenda des Rates wider: „ein starkes und sicheres Europa“ und „ein freies und demokratisches Europa“.
Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Behandlung des dritten Themas der Strategischen Agenda: „ein wohlhabendes und wettbewerbsfähiges Europa“. Dieses Ziel erscheint im Vorausschaubericht nicht als eigenständiges, fundamentales Ziel. Stattdessen werden wirtschaftliche Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Resilienz unter den übergeordneten Zielen der europäischen Sicherheit und des Wohlergehens der Menschen subsumiert. Es scheint, als ob die Kommission sich bewusst dafür entschieden hat, wirtschaftliche Prosperität nicht als Selbstzweck darzustellen, sondern primär als ein Werkzeug, um die übergeordneten Ziele Resilienz, Sicherheit und Wohlergehen zu erreichen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass Sicherheit als ein Leitmotiv dargestellt wird, das alle EU-Politikbereiche durchzieht.
In welchem Zusammenhang steht der Bericht zu den politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin von der Leyen?
Es besteht eine sehr enge Verbindung. Die politischen Leitlinien, die die Präsidentin im Juli 2024 vorstellte, sind in sieben Kapitel unterteilt. Diese Kapitel adressieren im Großen und Ganzen dieselben Themen wie die acht Handlungsbereiche des Vorausschauberichts, wenn auch in anderer Reihenfolge und Gruppierung. Es gibt eine breite thematische Überlappung mit den drei Hauptthemen der Strategischen Agenda des Rates. Der einzige Bereich der politischen Leitlinien, der keine klare Parallele im Vorausschaubericht oder in der Strategischen Agenda hat, ist das letzte Kapitel mit dem Titel „Gemeinsam handeln und unsere Union für die Zukunft vorbereiten“. Dieses Kapitel befasst sich mit Haushaltsambitionen, institutionellen Reformen und der Zusammenarbeit mit dem Parlament – also eher mit den internen Funktionsweisen der EU.
Gibt es eine Verbindung zwischen dem Bericht und der Rede zur Lage der Union (SOTEU) 2025?
Ja, die Verbindung ist sehr stark und unterstützt die Einschätzung, dass der Vorausschaubericht eher eine politische Agenda als eine reine Analyse ist. Die Rede zur Lage der Union von Präsidentin von der Leyen wurde am Tag nach der Präsentation des Vorausschauberichts gehalten. Inhaltlich folgte die Rede in weiten Teilen den im Bericht skizzierten acht Handlungsbereichen. Die Rede war in einigen Politikfeldern, wie zum Beispiel der Migration, etwas spezifischer, ließ aber das im Bericht genannte Thema der Generationengerechtigkeit aus. Die zeitliche und inhaltliche Nähe legt nahe, dass der Vorausschaubericht als strategische Grundlage und als vorbereitendes Kommunikationsdokument für die politische Leitungsrede der Kommissionspräsidentin diente.
Wie steht der Bericht im Vergleich zu früheren Strategischen Vorausschauberichten seit 2020?
Es gibt eine bemerkenswerte Kontinuität der Themen über die Jahre hinweg. Während der erste Bericht 2020 nur vier Resilienz-Dimensionen (sozial und wirtschaftlich, geopolitisch, grün und digital) identifizierte, listeten die Berichte von 2021 und 2022 jeweils zehn führende Themen oder Handlungsbereiche auf. Wiederkehrende Kernthemen sind die Stärkung der offenen strategischen Autonomie der EU (insbesondere bei Technologie, Rohstoffen und Energie), die Bewältigung von Gesundheits- und Umweltherausforderungen, die Verteidigung der demokratischen Werte der EU sowie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten und des globalen Partnernetzwerks. Obwohl sich die Sprache und die Schlagworte ändern – so spricht kaum noch jemand von der „doppelten, grünen und digitalen Transition“ der früheren Berichte – bleiben die zugrunde liegenden Probleme und Herausforderungen dieselben. Der Bericht von 2025 vermeidet es dabei, ein allzu düsteres Bild eines drohenden Krieges oder einer sicherheitsdominierten Gesellschaft zu zeichnen. Er behält einen Fokus auf positive Ziele bei, die mit demokratischen Werten und dem Wohlergehen der Bürger verbunden sind, obwohl die Ernsthaftigkeit der kombinierten Herausforderungen als besorgniserregend beschrieben wird.
Mögliche institutionelle Folgemaßnahmen
Wie reagieren die EU-Institutionen üblicherweise auf solche Berichte?
Die Reaktionen der verschiedenen EU-Institutionen sind traditionell unterschiedlich. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat seit 2020 zu allen bisherigen Vorausschauberichten Stellungnahmen abgegeben und wird dies auch für den Bericht 2025 tun. Im Gegensatz dazu haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament auf die früheren Berichte keine formellen Antworten oder Positionen veröffentlicht. Angesichts des horizontalen, alle Politikbereiche umfassenden Charakters des Berichts wäre der Europäische Rat eigentlich ein geeignetes Forum, um Schlussfolgerungen des Rates anzunehmen. Ebenso könnte das Europäische Parlament durch einen Meinungsaustausch und eine Entschließung reagieren.
Welche Probleme gibt es für das Europäische Parlament bei der Behandlung solcher ressortübergreifenden Berichte?
Das Hauptproblem für das Europäische Parlament liegt in seiner internen Struktur. Das parlamentarische System der Verweisung von Dokumenten an einen oder mehrere Fachausschüsse ist für die Bearbeitung von Dokumenten mit einem derart breiten, sektorübergreifenden Charakter schlecht geeignet. Ein Vorausschaubericht, der Themen von Sicherheit über Wirtschaft bis hin zu Bildung und Demokratie abdeckt, passt nicht in die Zuständigkeit eines einzelnen Ausschusses. Eine Zuweisung an mehrere Ausschüsse kann zu Koordinationsproblemen und einem fragmentierten Ergebnis führen.
Der Text schlägt vor, sich an nationalen Parlamenten zu orientieren. Welches ist das erste beschriebene Modell für parlamentarische Vorausschauarbeit?
Die erste und prominenteste Option ist die Einrichtung eines speziellen Gremiums von Parlamentsabgeordneten, wie zum Beispiel eines „Vorausschau-Ausschusses“ oder eines „Zukunftsausschusses“. Das erste derartige Gremium wurde 1993 in Finnland gegründet, und diesem Beispiel sind seitdem sieben weitere nationale Parlamente gefolgt. Der Erfolg dieses Modells hängt von mehreren entscheidenden Bedingungen ab. Es erfordert eine aktive, parteiübergreifende Unterstützung, um nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen zu werden. Eine enge Verknüpfung mit der Vorausschauarbeit der Exekutive und mit Think-Tanks ist entscheidend, um relevant zu bleiben und auf fundierte Analysen zugreifen zu können. Zudem ist eine nicht polarisierende Debattenkultur wichtig, die sich auf langfristige, sektorübergreifende Herausforderungen konzentriert. Dies hilft auch, Konflikte mit den bestehenden ständigen Fachausschüssen und dem laufenden Legislativprozess zu vermeiden.
Was ist die zweite Option für die Verankerung von Vorausschau in Parlamenten?
Die zweite Option besteht darin, die Vorausschau-Aufgabe an eine einzelne Person oder eine kleine Einheit zu binden, beispielsweise an einen Ombudsmann oder einen Kommissar für Vorausschau oder für zukünftige Generationen. Dieser Ansatz hat jedoch erhebliche Risiken, wie die Erfahrungen in Ungarn und Israel gezeigt haben. Es besteht die Gefahr, dass Debatten über die Unparteilichkeit des Amtsinhabers entstehen, was die Legitimität der Arbeit untergraben kann. Ein weiteres großes Risiko ist die mangelnde Kontinuität. Die Aktivitäten können nach Wahlen oder politischen Wechseln abrupt eingestellt werden, wenn der politische Wille zur Unterstützung dieser Position nicht mehr vorhanden ist. Die Institutionalisierung ist bei diesem Modell also deutlich schwächer.
Und was ist die dritte Möglichkeit?
Die dritte Option besteht darin, Vorausschau-Elemente fallweise in den regulären Gesetzgebungsprozess zu integrieren. Dies würde bedeuten, dass bei der Ausarbeitung spezifischer Gesetze in den Fachausschüssen auch langfristige Aspekte und Zukunftsszenarien berücksichtigt werden. Dieser sektorale Ansatz hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Er kann die komplexen, sektorübergreifenden Herausforderungen, die im Zentrum der Vorausschau und auch der Vorausschauberichte der Kommission stehen, nicht adäquat adressieren. Die Stärke der Vorausschau liegt gerade darin, Silodenken zu überwinden und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Politikfeldern zu analysieren. Ein rein sektoraler Ansatz würde diesem Kernanliegen nicht gerecht werden.
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Head of Business Development
Chairman SME Connect Defence Working Group
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder
mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten