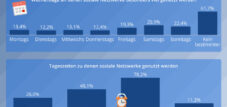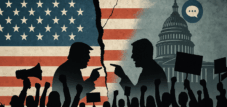Wann hört endlich diese “Scheisse” auf? Die politische Glaubwürdigkeit in Deutschland ist sowas von unter Null!
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 7. Oktober 2025 / Update vom: 7. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Wann hört endlich diese “Scheisse” auf? Die politische Glaubwürdigkeit in Deutschland ist sowas von unter Null! – Kreativbild: Xpert.Digital
580.000 Euro für Fotos: Regierung predigt Sparen, gönnt sich aber Luxus-PR
„Ein Schlag ins Gesicht“: Warum die Wut auf die Regierung eskaliert
Wir stehen hier fassungslos und fragen uns: Wann hört das endlich auf? Tag für Tag arbeiten wir in der deutschen Wirtschaft mit vollem Einsatz daran, Lösungen zu finden, unsere Unternehmen widerstandsfähig zu machen und den Standort Deutschland wieder zukunftsfähig aufzustellen. Wir sehen uns dabei als Partner, der die Politik entlastet und die wirtschaftlichen Herausforderungen proaktiv annimmt. Die jüngsten Signale aus Berlin sind nicht nur ein Schlag ins Gesicht für alle, die Verantwortung übernehmen, sondern sie werfen eine entscheidende Frage auf: Wie sollen wir diesem Land eine positive Zukunft sichern, wenn die eigene Regierung unsere Anstrengungen derart konterkariert?
Die Wahl dieser drastischen Überschrift ist kein Zufall, sondern eine bewusste und notwendige Entscheidung aus drei Gründen:
Es ist ein Weckruf, weil sachliche Kritik ignoriert wird
Jahrelange, konstruktive Vorschläge, Analysen und Appelle aus der Wirtschaft verhallen im politischen Berlin. Wenn diplomatische und sachliche Worte nicht mehr durchdringen, muss die Sprache lauter und direkter werden. Diese Überschrift ist ein bewusst gesetzter Alarm, um jene wachzurütteln, die die Dramatik der Lage immer noch nicht verstanden haben.
Sie benennt die Realität ungeschönt
Wir spielen hier nicht Monopoly, wo man am Ende das Brett einfach wegpackt. Es geht um reale Existenzen, um Arbeitsplätze und um die Zukunft des Standorts Deutschland. Das Wort „Scheisse“ ist keine Beleidigung, sondern eine präzise Zustandsbeschreibung für das Gefühl vieler, die täglich mit den Konsequenzen unberechenbarer und realitätsferner Politik konfrontiert sind. Es spiegelt die rohe, ungefilterte Wahrheit wider.
Sie durchbricht die Fassade der politischen Phrasen
Während die Politik sich in beschönigenden Floskeln und technokratischem Jargon verliert, spricht diese Überschrift die Sprache derer, die an der Basis die Scherben aufkehren. Sie ist der authentische Ausdruck von Wut, Enttäuschung und dem Gefühl, von der eigenen Regierung im Stich gelassen zu werden.
Kurz gesagt: Die Härte der Formulierung ist ein direktes Resultat der Härte der Realität. Wenn das Vertrauen derart fundamental zerstört wird, braucht es eine Sprache, die unmissverständlich klarmacht: So geht es nicht weiter.
Politische Glaubwürdigkeit, Ausgabenpraxis und wirtschaftliche Resilienz in Deutschland
Der aktuelle Vertrauensverlust in die Politik speist sich aus einer Mischung sichtbarer Symbolpolitik, widersprüchlicher Prioritätensetzung im Haushalt und fragwürdiger Kommunikationssignale – etwa bei Styling- und PR-Ausgaben von Regierungsstellen – während Wirtschaft und Gesellschaft parallel zu strukturellen Reformen und Resilienzaufbau aufgerufen werden. Transparenz, Priorisierung, Wirkungskontrolle und klare Leitplanken für Öffentlichkeitsarbeit sind zentrale Hebel, um Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und die wirtschaftliche Erneuerung zu stärken.
Was steht hinter der Empörung über PR- und Stylingausgaben von Ministerien?
Die zugespitzte Kritik entzündet sich daran, dass Ministerien einerseits zur Haushaltsdisziplin und harten Einschnitten mahnen, andererseits neue oder fortlaufende Aufträge für Foto-, Video- und Styling-Dienstleistungen vergeben. Laut Regierungsantworten fielen in einem Dreimonatszeitraum nach Amtsantritt Ausgaben in Höhe von rund 172.608 Euro für Fotografen sowie 58.738 Euro für „körpernahe Dienstleistungen“ (Visagisten, Friseure) an; im Ressortvergleich war das Finanzministerium besonders ausgabestark. Parallel berichten Medien über zusätzliche Stylingkosten ehemaliger Amtsinhaberinnen und -inhaber aus der vorherigen Legislaturperiode, was den Eindruck verfestigt, politische Kommunikation und Selbstdarstellung würden trotz Sparkurs privilegiert behandelt. Dieser Befund trifft auf eine ohnehin gespannte Vertrauenslage in Parteien und Institutionen und wird deshalb als symbolisch brisant wahrgenommen.
Trifft es zu, dass das Finanzministerium hochdotierte Foto-/Videoaufträge plant?
Ja. Medien berichten über eine EU-weite Ausschreibung des Bundesfinanzministeriums für Foto- und Videodienstleistungen mit einem Rahmenwert von bis zu 580.000 Euro netto (ca. 620.000 Euro inkl. ausgewiesener Mehrwertsteuerangabe), mit Laufzeit ab Januar bis Ende 2027 und Verlängerungsoptionen. Erwartet werden 175–225 Einsätze pro Jahr, kurzfristige Verfügbarkeit bundesweit und „in Ausnahmefällen weltweit“, inklusive optionaler Visagisten- und Assistenzleistungen mit separater Abrechnung. Das Ministerium verweist auf den Informationsauftrag der Bundesregierung und die branchenübliche Praxis in allen Ressorts. Unabhängig davon weisen Parlamentsangaben aus einem früheren Dreimonatszeitraum das Finanzministerium als Ressort mit den höchsten Fotografenkosten aus.
Sind Ausgaben für Visagistik und Styling in Bundesministerien außergewöhnlich oder Routine?
Es handelt sich um eine etablierte Praxis der Öffentlichkeitsarbeit: Laut Regierungsantwort werden Visagisten und Friseure nicht als Angestellte geführt, sondern fallweise extern beauftragt; in einem Dreimonatszeitraum summierten sich die Ausgaben ministerienübergreifend auf knapp 60.000 Euro. Spitzenwerte gab es in dieser Periode im Wirtschaftsministerium, das Kanzleramt lag ebenfalls im vierstelligen Bereich. Parallel wurden im gleichen Zeitraum für Fotografen rund 172.608 Euro verausgabt. Zuvor waren für die zurückliegende Legislaturperiode (Ampel) zusätzliche Stylingausgaben gemeldet worden, darunter im Auswärtigen Amt und Kanzleramt, sowie einzelne, öffentlich breit diskutierte Posten von Ex-Amtsinhabern. Kurz: Es ist Routine – aber Routine rechtfertigt nicht zwingend den Umfang; die politische Wirkung hängt an Transparenz, Zweckbindung und Verhältnismäßigkeit.
Warum löst gerade jetzt die Kombination aus Sparappellen und PR-Ausgaben besondere Kritik aus?
Weil der finanzpolitische Kontext konfliktiv ist: Der Finanzminister mahnt Sparsamkeit und Konsolidierung an, verweist auf große Finanzierungslücken (Planjahre 2027–2029) und fordert substanzielle Einsparvorschläge aller Ressorts. Zugleich werden Sondervermögen in dreistelliger Milliardenhöhe für Investitionen und Verteidigung genutzt, deren Zweckbindung und Steuerung umstritten ist. Diese Gemengelage verstärkt die Wahrnehmung eines Auseinanderklaffens zwischen politischem Anspruch (Sparen, Prioritäten, Wirkung) und symbolträchtigen Ausgaben (PR, Styling), wodurch Vertrauen weiter erodieren kann.
Handelt es sich bei PR- und Stylingausgaben nur um „Peanuts“ – oder um ein Grundsatzproblem?
In absoluten Zahlen sind die genannten PR- und Stylingausgaben im Vergleich zum Gesamtetat marginal. Politisch sind sie aber symbolstark. In Zeiten, in denen Unternehmen und Bevölkerung auf Verzicht, Effizienz und Priorisierung eingeschworen werden, wirken sichtbar inszenierte Kommunikationsaufwendungen wie ein Missklang. Forschung und Umfragen zeigen einen längerfristigen Vertrauensverlust in Parteien und einen verbreiteten Eindruck, dass Eliten „in einer eigenen Welt“ agieren. Der Bund der Steuerzahler mahnt seit Jahren Prioritätensetzung, Wirkungskontrolle und Transparenz an; die aktuelle Debatte um das neue Infrastruktur-Sondervermögen verstärkt diese Forderung. Fazit: Der Betrag ist klein, das Signal ist groß – und Signale formen politische Glaubwürdigkeit.
Ist die Beauftragung externer Fotografen rechtlich und organisatorisch begründet?
Ja, Regierungs- und Parlamentsdokumente bestätigen, dass Öffentlichkeitsarbeit und Informationsaufträge die Beauftragung externer Leistungen umfassen; im Bundespresseamt existieren zudem festangestellte Fotografen. Ressorts ohne interne Bildstellen greifen bedarfsweise extern zu. In der Antwort auf Medienanfragen wird die Üblichkeit einer solchen Praxis hervorgehoben. Dennoch bleibt die Frage nach Umfang, Vergabemodell, Leistungsbeschreibung, Wirkung und Controlling – und nach Alternativen (z. B. Nutzung des Bundespresseamts, gemeinsame Rahmenverträge, stärkere Bündelung) eine politische Abwägung, nicht nur eine juristische.
Warum wird die Diskrepanz zwischen „Sparen“ und sichtbarer Kommunikationsleistung als Glaubwürdigkeitsproblem gelesen?
Weil öffentliche Kommunikation den politischen Stil verkörpert. Eine Regierung, die „harte Entscheidungen“ ankündigt, eine Konsolidierung fordert und Strukturreformen avisiert, muss erwartungskonform handeln. Wenn parallel Aufträge für visuelle Inszenierung wachsen oder verlängert werden, fehlt vielen Bürgern die sichtbare Priorität „vorne an der Wirkung, hinten bei der Verpackung“. Der Vorwurf ist nicht, dass Kommunikation stattfindet, sondern dass die Reihenfolge der Mittel den falschen Fokus signalisiert. Diese Spannung wird durch Debatten um Sondervermögen, Verschiebebahnhöfe und unklare Wirkungssteuerung potenziert. Vertrauensforschung und Umfragen attestieren, dass das Vertrauen in Parteien historisch niedrig ist und Elitenferne empfunden wird. In diesem Umfeld haben kleine Symbole große Wirkung.
Welche Zahlen untermauern die aktuelle Kritik konkret?
Die in Anfragen und Medien wiedergegebenen Dreimonatszahlen nach Regierungsantritt: 172.608 Euro für Fotografen gesamt; Ressortspitzenreiter Finanzministerium mit ca. 33.700 Euro. Für Styling/Friseur 58.738 Euro gesamt in drei Monaten; Ressortspitzenreiter Wirtschaftsministerium mit 19.264,76 Euro, Kanzleramt 12.501,30 Euro. Zuvor bereits für die Ampel-Regierung (Restregierung Jan–März 2025) knapp 50.000 Euro für Visagisten gemeldet. Diese Zahlen belegen das Muster: Öffentlichkeitsarbeit wird kontinuierlich beauftragt, aber in der aktuellen Lage schwindet das Verständnis für solche Ausgabenrasters, wenn gleichzeitig zu spürbarer Konsolidierung aufgerufen wird.
Liegt die Ursache des Glaubwürdigkeitsproblems tiefer als bei PR-Ausgaben?
Ja. Politische Glaubwürdigkeit hängt an Prioritäten, Ergebnissen und Kohärenz. Im Haushalt werden Rekordinvestitionen, Verteidigungsausgaben und Konsolidierung gleichzeitig verfolgt; Kritiker sehen falsche Prioritäten (Kürzungen bei Sozialem und Klimaschutz, zu wenig zukunftsgerichtete Investitionen, unzureichende Wirkungskontrolle), während Befürworter die Notwendigkeit von Sicherheit, Standortpolitik und Wachstumsimpulsen betonen. Parallel warnen Ökonomen und Beraterkreise vor Strukturproblemen (Energiepreise, Regulierung, Demografie, Produktivität) und fordern eine Wachstumsagenda mit teils schmerzhaften Reformen. Wenn kommunikative Signale mit diesen Prioritäten kollidieren, verstärkt es vorhandenes Misstrauen.
Was ist der wirtschaftliche Kontext – schaffen Unternehmen bereits Resilienz?
Viele Unternehmen arbeiten an Resilienz, insbesondere an Lieferketten-Transparenz, Dual Sourcing, Bestandsaufbau, Digitalisierung des Risikomanagements, Kreislaufwirtschaft und robusteren Prozessen. Studien und Leitfäden (VDI, BMBF-Resilienzkompass, Branchenkompendien) belegen die praktische Umsetzung und Herausforderungen (Kosten, Personal, Messbarkeit). Gleichzeitig belasten Strukturbrüche (Deindustrialisierungsrisiken, Standortkosten, Arbeitsmarktverschiebungen) die Perspektiven; daher wird stärkerer politischer Mut zu Reformen gefordert. Kurz: Die Wirtschaft bewegt sich – und erwartet ein Regieren, das Prioritätensetzung, planbares Investitionsumfeld und zielgerichtete, wirksame Ausgaben gewährleistet.
Welche Rolle spielen Sondervermögen und warum erzeugen sie Misstrauen?
Sondervermögen sind außerhalb des Kernhaushalts geführte Kreditermächtigungen mit spezifischen Zweckbindungen (z. B. Verteidigung, Infrastruktur, Klima). Sie dienen, politisch gewollt, als Hebel für große Investitionsprogramme. Kritik entzündet sich an Umwidmungen, Transparenzdefiziten, der Versuchung, reguläre Ausgaben umzuschichten, und am potenziellen „Verschiebebahnhof“, der zusätzliche Impulse vorgaukelt. Der Bund der Steuerzahler fordert belastbare Kriterien, zusätzliche Wirkung und strikte Kontrolle, um Politikverdrossenheit zu vermeiden. Medienberichte thematisieren zudem kreative Haushaltsbuchungen und Intransparenzvorwürfe, was die Vertrauensfrage verschärft.
Ist die politische Kommunikation grundsätzlich zu reduzieren – oder eher neu auszurichten?
Politische Kommunikation ist notwendig, um Informationspflichten zu erfüllen, demokratische Rechenschaft zu leisten und Transparenz zu schaffen. Reduzieren sollte man nicht Kommunikation an sich, sondern ineffiziente, wenig wirkungsorientierte und selbstdarstellerische Ausgaben. Handlungsfelder sind: Konsolidierung und Bündelung von Aufträgen, Nutzung zentraler Bildstellen (BPA), klare Output- und Outcome-Kennzahlen (z. B. Reichweiten, Zielgruppenabdeckung, Zugänglichkeit), Open-Data-Veröffentlichung von Verträgen und Leistungscontrolling, restriktive Leitlinien für Styling/Inszenierung, sowie Priorisierung barrierefreier Informationsangebote gegenüber Bildästhetik. So wird Kommunikation mehr Dienst an Bürgern als PR-Inszenierung.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Kommunikation neu denken – Transparenz statt Inszenierung: So gewinnt die Bundesregierung Vertrauen zurück
Wie kann die Bundesregierung das akute Glaubwürdigkeitsdefizit durch konkrete Schritte mildern?
Erstens, Soforttransparenz
Veröffentlichung aller laufenden Rahmenverträge für Foto/Video/Styling mit Leistungsbeschreibung, Abrufstatistiken und Abrechnungsposten im Open-Data-Format; jährliche Konsolidierungsziele ressortübergreifend.
Zweitens, Prioritätenscreening
Pflichtprüfung „kommunikativer Muss-Kaskaden“ vor jeder Beauftragung (Informationsauftrag vs. Selbstdarstellung).
Drittens, Bündelung
Zentrale Produktionskapazitäten im Bundespresseamt erweitern und als Standarddienst vorschreiben, externe Abrufe als Ausnahme.
Viertens, Deckelung
Ein digitaler Ausgaben-Deckel je Ressort für „körpernahe Dienstleistungen“ mit strenger Dokumentationspflicht. Fünftens, Wirkungskontrolle: Standardisierte KPIs und unabhängige Evaluation der Kommunikationskampagnen (Zielerreichung, Bürgernutzen, Zugang). Die Kombination stärkt die Botschaft „Wir sparen bei uns selbst zuerst“.
Was kann die Wirtschaft vom Staat erwarten – und was nicht?
Erwartbar sind klare, verlässliche Rahmenbedingungen, beschleunigte Verfahren, planbare Energie- und Netzkosten, moderne Infrastruktur und fokussierte Förder- und Investitionsprogramme. Nicht zu erwarten sind risikofreie Umfeldbedingungen oder vollständige Kompensation globaler Schocks. Deshalb ist Resilienzaufbau in Unternehmen essenziell, aber er muss durch staatliche Strukturreformen flankiert sein: Entbürokratisierung, gezielte Technologie- und Digitalinvestitionen, Fachkräftestrategien, wettbewerbsfähige Abgabensysteme. Beraterkreise und Studien benennen konkrete Reformpfade; die politische Aufgabe ist Priorisierung und Umsetzung mit Wirkungskontrolle.
Welche Rolle spielen Opposition und Medien bei der Vertrauensfrage?
Opposition und Medien sind Korrektiv, indem sie Verteilung, Zweckbindung und Wirkung öffentlicher Mittel hinterfragen. Aktuelle Haushaltsdebatten zeigen breite Kritik an der Verwendung von Sondervermögen und Prioritätensetzung; gleichzeitig ist der Auftrag, konstruktiv Alternativen vorzulegen. Medienberichte über Styling- und PR-Ausgaben schärfen Sensibilität für Symbolpolitik; sie ersetzen jedoch keine strukturelle Finanzkontrolle. Entscheidender Hebel ist eine datenbasierte, offene, fortlaufende Ausgaben- und Wirkungstransparenz, die politischen Streit faktenbasiert ermöglicht.
Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen „Sparen“ und „Kommunizieren“ operativ schließen?
Durch eine Governance für politische Kommunikation mit vier Bausteinen: Leitplanken (Was ist Pflichtinformation? Was ist verzichtbar?), Zentralisierung (BPA-Lead, Ressorts als Bedarfsmelder), Evidenz (KPIs, Audits), und Ethik (Inszenierung vs. Information). Die resultierende Praxis sollte sichtbare Verhaltensnormen setzen: minimaler Make-up-/Styling-Einsatz, größtmöglicher Informationsgehalt, barrierefreie Formate vor Bildinszenierung, Re-use statt Neuproduktion, und digitale Erstveröffentlichung im Open-Data-Kanal. Damit lassen sich Kosten und Reputationsrisiken senken, ohne die Informationspflicht zu beschädigen.
Wie ernst ist der Vertrauensverlust in Deutschland – und was hilft nachhaltig?
Studien und Umfragen zeigen einen deutlichen Rückgang des Vertrauens in Parteien und zunehmende Distanz zu politischen Eliten. Viele Bürger empfinden die Prioritäten als nicht gerecht oder alltagsfern. Nachhaltig helfen nicht symbolische Kürzungen allein, sondern spürbare Resultate: beschleunigte Planung/Bau, messbare Entbürokratisierung, investive Schwerpunkte mit nachweislicher Wirkung (z. B. Netze, Schulen, Verwaltung), konsistente Sicherheits- und Standortpolitik, und verlässliche Kommunikation. Kurz: Die politische Praxis muss die versprochenen Prioritäten erfahrbar machen – dann folgt Glaubwürdigkeit.
Was sagen Befürworter der Kommunikationsausgaben – und wie ist das zu bewerten?
Befürworter argumentieren, dass hochwertige, aktuelle Bild- und Videodokumentation Aufgabe demokratischer Transparenz sei, vor allem bei bundesweiten und internationalen Terminen. Sie verweisen auf rechtssichere Vergabe, anspruchsvolle Einsatzprofile und die Notwendigkeit professioneller Standards in der Regierungskommunikation. Das ist nachvollziehbar – solange der Umfang dem Zweck dient, die Leistungen gebündelt und effizient erbracht werden, und eine belastbare Wirkungskontrolle stattfindet. In einer fiskalisch angespannten Lage müssen zudem Spar- und Prioritätslogiken sichtbar auch für die Exekutive gelten.
Welche Lehren lassen sich aus den Zahlen in den ersten Regierungsmonaten ziehen?
Erstens: Die Kommunikationsapparate springen schnell an (Neuproduktion, Porträts, Social-Media-Material), was kurzfristig Ausgabenpeaks erzeugt. Zweitens: Ressorts ohne eigene Bildstellen beauftragen häufiger extern – hier liegt Potenzial zur Zentralisierung und Kostensenkung. Drittens: „Körpernahe Dienstleistungen“ variieren stark je Ressort; ohne verbindliche Leitplanken entstehen Reputationsrisiken. Viertens: Ein transparenter Rhythmus für Veröffentlichung von Kommunikationsauftragsdaten (monatlich/quartalsweise) würde Debatten versachlichen.
Wie können Unternehmen und Regierung vertrauensbildend zusammenwirken?
Durch einen ehrlichen, priorisierten Reformfahrplan: Unternehmen adressieren Resilienz, Digitalisierung, Qualifizierung; Regierung liefert Planungsbeschleunigung, verlässliche Energiekostenrahmen, steuerliche und regulatorische Entlastung in wirkungsvollen Bereichen, sowie Schwerpunkte auf Wachstumstreibern (KI, Mikroelektronik, Biotechnologie, Mobilität, Netze). Politische Kommunikation begleitet erklärend – nicht inszenierend – und macht Fortschritt messbar und vergleichbar. Gemeinsame Zielkanzlei: „Jeder Euro erzeugt Wirkung“, belegt in Kennzahlen und Projekterfolg.
Welche konkreten, kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen würden das Signal drehen?
- Veröffentlichung eines ressortübergreifenden 12-Monats-Konsolidierungsplans speziell für Kommunikationsausgaben mit quantifizierten Einsparzielen und zentralen Einkaufsmechanismen.
- Sofortige Deckelung „körpernaher Dienstleistungen“ pro Ressort (quartalsbezogen), mit Veröffentlichung jeder Abrechnung im Open-Data-Portal.
- Verpflichtende Erstprüfung beim Bundespresseamt vor externer Beauftragung; externer Abruf nur bei Kapazitätsgrenzen mit Begründung.
- Standardisierte Produktions-„Reuse“-Policy (Bild-/Videoarchive, freie Lizenzen) zur Vermeidung von Doppelproduktionen.
- KPI-Set für Kommunikationsprojekte: Reichweite in relevanten Zielgruppen, Barrierefreiheit, Informationswert; unabhängige Audit-Veröffentlichung halbjährlich.
Diese Maßnahmen sind keine symbolische Kosmetik, sondern setzen reale Anreize, senken Kosten und erhöhen die Legitimation von Pflichtkommunikation.
Wie ordnen sich Make-up-/Styling-Ausgaben historisch ein?
Solche Ausgaben gab es auch früher; Unterschiede liegen in Umfang, Transparenz und Kontext. In der jüngeren Debatte fallen die Summen ins Gewicht, weil sie mit breiten Strukturreformen, Sondervermögen und einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld zusammentreffen. Vergleiche mit früheren Amtszeiten dienen als Kontext, lösen aber das aktuelle Priorisierungsproblem nicht. Entscheidend ist die heutige Signalwirkung und die künftige Steuerung.
Warum eskaliert die Empörung trotz geringer Beträge?
Weil politische Kultur stark performativ ist. Menschen schließen vom Sichtbaren aufs Ganze. Wenn palpable Belastungen, Zukunftssorgen und Standortfragen drängen, wird Inszenierung schwerer verziehen. Genauso gilt: Sichtbare Selbstbeschränkung, offene Kontrolle und harte Prioritätensetzung werden anerkannt. Die Legitimation von Sondervermögen und Schuldenpfaden hängt deshalb nicht nur an juristischen Feinheiten, sondern an der erfahrbaren Ernsthaftigkeit, die Regierung bei sich selbst anlegt.
Was sagen aktuelle Haushaltsdebatten über Prioritäten?
Opposition und Verbände kritisieren, die Regierung vergäbe Chancen, investive Mittel zielschwach zu verteilen, Klimaschutz und Soziales zu schwächen und zu sehr auf Rüstung und Schulden zu setzen. Die Regierungsseite betont Sicherheitsnotwendigkeiten, Investitionsrekorde und Wachstumsimpulse. Die Wahrheit liegt in der Wirkungsmessung: Projekte brauchen klare Ziele, Meilensteine und Outcome-Kontrolle; ohne diese bleiben Rekordsummen politisch angreifbar.
Wie kann Vertrauen systematisch zurückgewonnen werden?
Drei Ebenen:
Ergebnisorientierung
Priorisierte, wenige, große Projekte mit klaren Kennzahlen (Netzausbau, Verwaltungsdigitalisierung, Bildung, industrielle Transformation) und öffentlicher Zwischenstandsberichterstattung.
Finanzielle Redlichkeit
Sichtbare Einhaltung der Leitplanken für Schuldenbremse (oder transparente Abweichung mit Frist und Begründung), strikte Zweckbindung von Sondervermögen, externe Wirkungsaudits.
Kommunikationsethos
Informationsauftrag vor Selbstdarstellung; Open Data über Verträge und Kosten; konsequente Barrierefreiheit; stringentes Kostenmanagement in PR/Styling.
Diese Trias adressiert Ursachen, nicht nur Symptome des Vertrauensverlustes.
Wie lange „geht das so weiter“ – und was ist realistisch?
Politische Systeme reagieren auf Druck durch Skandale, Wahlergebnisse und Verwaltungsreformen. Erfahrungen zeigen: Wenn Transparenz steigt und harte Leitplanken greifen, normalisieren sich Ausgabenmuster. Realistisch ist kein „Null-Euro-PR“, wohl aber eine deutliche Reduktion, Zentralisierung und bessere Steuerung. Der größere Hebel liegt in der sichtbaren Umsetzung von Strukturreformen, die Wachstum und Produktivität heben. Gelingt das, relativieren sich symbolische Debatten. Gelingt es nicht, werden kleine Ausgaben weiter große Empörung auslösen.
Was ist die Rolle des Parlaments?
Das Parlament kann über Haushaltsvermerke, Berichtspflichten und Evaluationsaufträge Präzision und Kontrolle erhöhen: etwa quartalsweise Berichte über Kommunikationsausgaben, verbindliche KPI-Sets, Veröffentlichungspflichten und Deckelungen. Zudem kann es die Steuerung von Sondervermögen verbessern, unabhängige Erfolgscontrollingstellen einsetzen und den Vorrang „zusätzlicher“ Investitionen im Gesetzestext sichern. Damit wird die Exekutive zu einem kohärenten Prioritätenmodus gezwungen.
Wie findet die Debatte zurück zur Sache?
Indem Regierung kurzfristig sichtbare Selbstbeschränkung zeigt (Transparenz, Deckelung, Bündelung) und mittelfristig Wirkung liefert (Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung, Entbürokratisierung). Medien sollten Zahlen im Kontext des Gesamthaushalts einordnen und zugleich auf Wirkung und Prioritäten fokussieren. Unternehmen sollten ihre Resilienzpfade kommunizieren und belegbare Standortbedarfe adressieren. So entsteht ein Kreislauf von Ergebnissen statt Erregungen.
Gibt es valide Gegenargumente zur Reduktion von PR-/Stylingaufwand?
Ja: Zugängliche, gut produzierte Inhalte erhöhen Reichweite, Verständlichkeit und politische Teilhabe – gerade in digitalen, visuell geprägten Öffentlichkeiten. Das stützt demokratische Legitimation. Allerdings rechtfertigt das nicht jeden Umfang. Professionalisierung muss mit Effizienz, Reuse-Politik, zentraler Produktion und strikter Wirkungsmessung einhergehen. Sonst kippt der Nutzen in Misstrauen.
Welche Kennzahlen eignen sich für eine objektive Bewertung politischer Kommunikation?
- Reichweiten in priorisierten Zielgruppen (nicht nur Gesamtaufrufe).
- Barrierefreiheitsquote (Untertitel, Leichte Sprache, Screenreader-Fähigkeit).
- Informationswert (z. B. Anteil sachlicher Informationsstücke vs. Image-Content).
- Kosten je erreichten relevanten Nutzer.
- Reuse-Quote (Archivmaterial vs. Neuproduktion).
- Zeitnahe Verfügbarkeit nach Ereignis.
- Bürgerfeedback-Indikatoren (Verständlichkeit, Nützlichkeit).
Diese KPIs sind transparent zu berichten und extern zu auditieren.
Welche „No-Regret“-Reformen stärken Wirtschaft und Glaubwürdigkeit gleichzeitig?
- Turbo für Planungs-/Genehmigungsbeschleunigung bei Netzen, Energie, Industrieprojekten.
- Digitale Verwaltung mit verbindlichen, messbaren Service-Levels.
- Zielgerichtete, temporäre Investitionsanreize in Schlüsseltechnologien und Energieinfrastruktur.
- Entbürokratisierung über Sunset-Klauseln, Reporting-Abbau, experimentierfreundlichen Datenschutz-Korridor mit klaren Schutzstandards.
- Arbeitsmarktreformen für Fachkräftegewinnung und Qualifizierung.
- Lieferkettenresilienz fördern (Diversifizierung, Nearshoring, Energiepreisstabilisierung).
Diese Agenda deckt sich mit Empfehlungen von Ökonomen und Beraterkreisen.
Was „soll das“ und „wann hört das auf“?
Die Empörung über Styling- und PR-Ausgaben ist Ausdruck tieferer Zweifel an Prioritäten, Wirkung und Fairness staatlichen Handelns. „Aufhören“ wird es, wenn Regierung und Verwaltung sichtbar bei sich selbst anfangen zu sparen, Kommunikation effizient bündeln, Verträge offenlegen, Deckel einziehen und Wirkung messen – und wenn große Versprechen in greifbare Ergebnisse münden: bessere Infrastruktur, digitale Verwaltung, spürbare Entlastung von Bürokratie, klare Investitionspfade. Der Vertrauensaufbau ist ein Ergebnisprozess. Er beginnt mit sofortiger Transparenz und endet mit belegbarer Wirkung im Alltag. Bis dahin gilt: Jede kommunikative Ausgabe muss nicht nur rechtlich, sondern politisch-demokratisch gerechtfertigt sein – durch Nutzen, Effizienz und Verhältnismäßigkeit.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier: