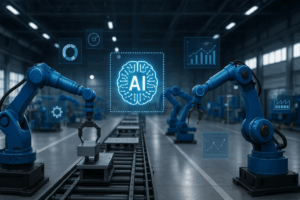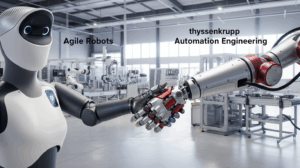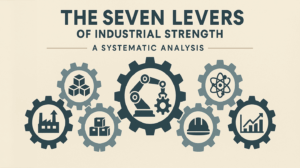„Physical AI“ & Industrie 5.0 & Robotik – Deutschlands hat die besten Chancen und Voraussetzungen in der physikalischen KI
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 25. November 2025 / Update vom: 25. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

„Physical AI“ & Industrie 5.0 & Robotik – Deutschlands hat die besten Chancen und Voraussetzungen in der physikalischen KI – Bild: Xpert.Digital
Für Deutschland öffnet sich ein Zeitfenster von 24 Monaten – In dieser kurzen Phase muss die KI-Transformation gelingen
Vom generierten Wort zur ausgeführten Tat: Deutschlands Schicksalsstunde in der Ära der Physical AI
Während die Welt noch über die Fähigkeiten generativer Sprachmodelle staunt, vollzieht sich im Hintergrund bereits der nächste, weitaus tiefgreifendere tektonische Wandel der Technologielandschaft. Die Ära der rein digitalen Algorithmen weicht der Ära der „Physical AI“ – einer verkörperten künstlichen Intelligenz, die nicht mehr nur Texte dichtet, sondern die physische Welt wahrnimmt, versteht und aktiv in ihr handelt. Was sich zunächst nach Science-Fiction anhört, entwickelt sich derzeit zum entscheidenden Schlachtfeld der globalen Industrie, mit einem prognostizierten Marktwachstum auf knapp 68 Milliarden US-Dollar bis 2034.
Für den Industriestandort Deutschland markiert diese Entwicklung eine historische Zäsur: Waren wir im reinen Software-Wettlauf gegen das Silicon Valley chancenlos, werden die Karten nun neu gemischt. Denn Physical AI benötigt nicht nur digitale Intelligenz, sondern exzellente Mechatronik, präzisen Maschinenbau und tiefe Domänenexpertise – also genau jene Tugenden, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.
Doch der internationale Wettbewerb schläft nicht. Zwischen den innovationsgetriebenen USA und dem auf Massenproduktion spezialisierten China öffnet sich für Deutschland ein kritisches Zeitfenster von nur etwa 24 Monaten. In dieser kurzen Phase muss die Transformation gelingen: von starren Industrierobotern hin zu adaptiven, humanoiden Systemen, gestützt durch souveräne Recheninfrastrukturen wie die neue „Industrial AI Cloud“ von Telekom und NVIDIA.
Diese Analyse beleuchtet, warum Deutschland im Bereich der physischen KI über einen strukturellen „Unfair Advantage“ verfügt, wie visionäre Akteure aus München und Metzingen den Fachkräftemangel durch humanoide Robotik bekämpfen wollen und warum die Jahre 2024 bis 2026 darüber entscheiden, ob wir zum bloßen Hardware-Lieferanten degradieren oder als Leitmmarkt der nächsten industriellen Revolution hervorgehen.
Passend dazu:
- Die schlaue Fabrik mit Industrial AI: Neben Robotik von schlauen Sensoren zur vollautomatischen Fabrik
Wer die physische Welt beherrscht, kontrolliert die industrielle Zukunft
Die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und robotischer Ausführung markiert einen tektonischen Wandel in der globalen Technologielandschaft. Während sich das vergangene Jahrzehnt durch die Dominanz digitaler Plattformen und generativer Sprachmodelle definierte, steht das kommende unter dem Zeichen der Physical AI, der verkörperten künstlichen Intelligenz, die nicht mehr nur Texte generiert, sondern die reale Welt wahrnimmt, versteht und in ihr handelt. Der globale Markt für Physical AI, der 2024 noch bei bescheidenen 3,78 Milliarden US-Dollar lag, wird bis 2034 auf geschätzte 67,91 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer Verachtzehnfachung des Volumens entspricht. Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines intensiven geopolitischen Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten, China und Europa, wobei Deutschland aufgrund seiner einzigartigen industriellen Substanz und mechatronischen Kompetenz eine potenzielle Schlüsselrolle einnehmen könnte, die es im Bereich der reinen Software-KI niemals innehatte.
Die zentrale These dieser Analyse lautet: Deutschland besitzt im Bereich der Physical AI einen strukturellen Vorteil, den es im Feld der generativen KI nicht vorweisen kann. Während das Silicon Valley bei Algorithmen und Large Language Models dominiert und China die Massenproduktion von Consumer-Hardware perfektioniert hat, verfügt Deutschland über Jahrzehnte akkumulierte Domänenexpertise in der Präzisionsmechatronik, im Maschinenbau und in der industriellen Fertigung sowie über den Zugang zu den wertvollsten Industriedaten der Welt. Ob diese Chance genutzt wird, entscheidet sich in einem kritischen Zeitfenster zwischen 2024 und 2026, das sich derzeit öffnet und bald wieder schließen wird.
Passend dazu:
Der tektonische Wandel von lernenden Algorithmen zu handelnden Maschinen
Die fundamentalste Verschiebung im Bereich der Physical AI vollzieht sich auf der Ebene der Grundlagenmodelle für Roboter. Traditionelle Industrieroboter folgten starren programmierten Abläufen, einer Wenn-Dann-Logik, die für jede neue Aufgabe mühsam von spezialisierten Ingenieuren implementiert werden musste. Diese Ära geht zu Ende. An ihre Stelle treten Vision-Language-Action-Modelle, kurz VLA-Modelle, die eine neue Klasse multimodaler Foundation Models darstellen, welche visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis und physische Aktionen in einem einzigen System vereinen. Ein solches Modell nimmt ein Kamerabild der Roboterumgebung auf, verarbeitet eine textuelle Anweisung und gibt direkt niedrigschwellige Roboteraktionen aus, die zur Erfüllung der Aufgabe ausgeführt werden können. Dies geschieht ohne explizite Programmierung einzelner Bewegungsabläufe.
Die technische Architektur dieser Systeme besteht typischerweise aus zwei Komponenten: einem vortrainierten Vision-Language-Model, das als Wahrnehmungs- und Schlussfolgerungskern dient und Kamerabilder zusammen mit Sprachanweisungen in eine gemeinsame latente Repräsentation kodiert, sowie einem Aktionsdecoder, der diese Repräsentation in kontinuierliche, vom Roboter ausführbare Bewegungen übersetzt. Die Modelle werden auf Datensätzen trainiert, die robotische Demonstrationen in Form von Paaren aus visueller Beobachtung, Textanweisung und Bewegungstrajektorie enthalten. Diese Demonstrationen können von realen Robotern, menschlicher Teleoperation oder synthetisch in Simulationsumgebungen generiert werden.
Die Implikationen dieser Entwicklung sind weitreichend. Roboter müssen nicht mehr für jede Aufgabe einzeln programmiert werden, sondern können durch wenige Demonstrationen oder natürlichsprachliche Anweisungen auf neue Aufgaben transferiert werden. Das System Helix, entwickelt für humanoide Roboter, demonstriert die Skalierbarkeit dieses Ansatzes und wurde auf circa 500 Stunden robotischer Teleoperation mit automatisch generierten Textbeschreibungen trainiert. Die entkoppelte Architektur, die strategisches Denken und Aufgabenplanung in einem System-2-Modul von schneller Reaktionsfähigkeit und feinmotorischer Präzision in einem System-1-Modul trennt, ermöglicht sowohl breite Generalisierung als auch schnelle niedrigschwellige Kontrolle.
Für Deutschland eröffnet sich hier eine strategische Opportunität. Die präzise Hardware, die diese Foundation Models zur Ausführung benötigen, entspricht genau den Stärken deutscher Ingenieurskunst. Unternehmen wie NEURA Robotics aus Metzingen und Agile Robots aus München entwickeln Systeme, die nicht mehr nur für einen einzigen Handgriff optimiert sind, sondern Aufgaben generisch lösen können. Das Start-up GEN-0 hat eine neue Klasse verkörperter Foundation Models vorgestellt, die auf einem Korpus von 270.000 Stunden realer Manipulationstrajektorien trainiert wurden und über verschiedene Roboterverkörperungen hinweg funktionieren, von sechsachsigen über siebenachsige bis hin zu semihumanoiden Systemen mit mehr als 16 Freiheitsgraden.
Die Architektur souveräner Recheninfrastruktur als industrielles Fundament
Die Frage der technologischen Souveränität hat sich von einem abstrakten politischen Konzept zu einer konkreten industriellen Notwendigkeit gewandelt. Am 5. November 2025 haben die Deutsche Telekom und NVIDIA in Berlin die weltweit erste Industrial AI Cloud vorgestellt, eine souveräne, unternehmenstaugliche Plattform, die Anfang 2026 in Betrieb gehen soll. Diese Partnerschaft bringt die bewährte Infrastruktur und den Betrieb der Deutschen Telekom mit den NVIDIA-AI- und Omniverse-Digital-Twin-Plattformen zusammen und repräsentiert eine Investition im Wert von einer Milliarde Euro, die rein privatwirtschaftlich finanziert wird.
Die technische Substanz dieser Initiative ist beachtlich. In einem renovierten Rechenzentrum in München werden derzeit mehr als tausend NVIDIA-DGX-B200-Systeme und RTX-PRO-Server installiert, die bis zu 10.000 NVIDIA-Blackwell-GPUs beherbergen werden. Diese Rechenkapazität erhöht die in Deutschland verfügbare KI-Rechenleistung um circa 50 Prozent. Die Plattform nutzt modernste Software-Stacks, darunter NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA Omniverse, die vollständig in das Cloud- und Netzwerk-Ökosystem der Deutschen Telekom integriert sind.
Die strategische Bedeutung liegt in der Verbindung von Rechenleistung und Datensouveränität. Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, formulierte die Vision prägnant: Jedes produzierende Unternehmen wird in Zukunft zwei Fabriken besitzen, eine für das physische Produkt und eine für die KI, die dieses Produkt ermöglicht. Die Industrial AI Cloud bietet führenden Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Automobilbau, Robotik, Gesundheitswesen, Energie und Pharma die Rechenleistung, die sie für KI-Training, Simulation und Bereitstellung in großem Maßstab benötigen.
Ein zentrales Element ist der sogenannte Deutschland-Stack, eine sichere, souveräne digitale Infrastruktur, die die Deutsche Telekom gemeinsam mit SAP entwickelt. Die Telekom stellt die physische Infrastruktur bereit, während SAP die Business Technology Platform und KI-basierte Anwendungen beisteuert. Diese Kombination garantiert höchste Standards bei Datenschutz, Sicherheit und Verlässlichkeit unter europäischen Regeln. Für den deutschen Mittelstand mit seinen wertvollen Prozessgeheimnissen ist dies von existenzieller Bedeutung, da sensible Konstruktionsdaten und Fertigungsparameter nicht auf ausländische Server geladen werden müssen.
Die ersten Kunden und Partner dieser neuen KI-Fabrik wurden bereits bekannt gegeben. Neben SAP und der Deutschen Telekom selbst gehören dazu Mercedes-Benz und die BMW Group, die hochkomplexe Simulationen mit KI-gestützten digitalen Zwillingen durchführen und ihre Entwicklungsprozesse für neue Fahrzeuge massiv beschleunigen können. Auch Robotik-Unternehmen wie Agile Robots und Wandelbots wurden als Partner genannt, ebenso wie die KI-Suchmaschine Perplexity und der Drohnenhersteller Quantum Systems.
Die Rückkehr des Maschinenmenschen in die Produktionshalle
Der humanoide Roboter, lange Zeit Gegenstand von Science-Fiction-Phantasien, betritt die industrielle Realität. Der globale Markt für humanoide Roboter wird bis 2030 auf 15 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 39,2 Prozent, und bis 2035 auf 51 Milliarden US-Dollar, mit einer dann erwarteten Wachstumsrate von 55 Prozent pro Jahr. Goldman Sachs prognostiziert für 2026 weltweit 50.000 bis 100.000 ausgelieferte humanoide Einheiten, während die Fertigungskosten durch Skaleneffekte auf 15.000 bis 20.000 US-Dollar pro Einheit sinken. Bis 2035 könnten die jährlichen Auslieferungen in die Millionen gehen.
Deutschland positioniert sich in diesem Wachstumsmarkt mit zwei vielversprechenden Akteuren. NEURA Robotics, 2019 von David Reger in Metzingen bei Stuttgart gegründet, hat sich als weltweit einziges Unternehmen etabliert, das intelligente, kognitive Roboter vollständig selbst entwickelt und herstellt. Im Januar 2025 sicherte sich das Unternehmen eine Series-B-Finanzierung von 120 Millionen Euro, um die Entwicklung kognitiver humanoider Roboter in Europa für verschiedene Industrien voranzutreiben. Der 4NE1, ein 1,80 Meter großer humanoider Roboter mit einem Gewicht von 80 Kilogramm und einer Tragfähigkeit von 15 Kilogramm, ist als Europas erster serienreifer humanoider Roboter konzipiert.
Der zweite bedeutende deutsche Akteur ist Agile Robots, 2018 von Dr. Zhaopeng Chen und weiteren Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gegründet. Das Unternehmen hat im November 2025 seinen ersten humanoiden Roboter, den Agile One, vorgestellt und plant, die Serienproduktion bereits Anfang 2026 in einer neuen Fabrik in Fürstenfeldbruck aufzunehmen. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter in Deutschland, China und Indien. Der Agile One ist speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt, in denen er sicher und effizient mit Menschen, aber auch mit anderen Robotersystemen zusammenarbeiten wird.
Die technologischen Alleinstellungsmerkmale des Agile One umfassen eine hochpräzise robotische Hand, die das Unternehmen als die weltweit präziseste bezeichnet, mit fünf beweglichen Fingern, Fingerspitzensensoren und Kraft-Drehmoment-Sensoren in den Gelenken. Die KI des Roboters wurde mit einem der größten industriellen Datensätze Europas und mit menschlich erfassten Daten trainiert. Die Architektur basiert auf einer mehrschichtigen KI-Struktur, wobei jede Schicht auf eine spezifische Ebene von Kognition und Steuerung spezialisiert ist, von strategischem Denken über Aufgabenplanung bis hin zu schneller Reaktionsfähigkeit und feinmotorischer Präzision.
Der strategische Kontext dieser Entwicklungen liegt im deutschen Fachkräftemangel. Mit einem Defizit von circa 387.000 qualifizierten Arbeitskräften im Jahr 2025 und einer prognostizierten Schrumpfung der erwerbstätigen Bevölkerung um 3,9 Millionen bis 2030 steht die deutsche Industrie vor einer demografischen Herausforderung von existenziellem Ausmaß. Die Bundesagentur für Arbeit identifiziert 163 Berufe mit Fachkräftemangel, was circa jeden achten qualifizierten Beruf betrifft. Besonders betroffen sind Pflege und Gesundheitswesen, das Baugewerbe und das Handwerk sowie Fahrer und Erzieher. Das ifo-Institut beziffert die durch den Fachkräftemangel verursachten verlorenen Produktionskapazitäten auf 49 Milliarden Euro pro Jahr.
Die Virtualisierung der Fabrik als Trainingsgelände für maschinelle Intelligenz
Die Erkenntnis, dass physische KI-Systeme Millionen von Trainingsstunden benötigen, die in der realen Welt nicht wirtschaftlich zu sammeln wären, hat zur Renaissance des Konzepts des digitalen Zwillings geführt. Bevor eine Physical AI in der echten Welt agiert, muss sie in der virtuellen Welt trainieren, und zwar in fotorealistischen Simulationen, in denen die Gesetze der Physik gelten. NVIDIA Omniverse hat sich als führende Plattform für diese Simulation-First-Strategie etabliert und ermöglicht die Erstellung hochdetaillierter digitaler Zwillinge, in denen Roboter durch Reinforcement Learning in Stunden lernen können, was in der Realität Jahre dauern würde.
Die technische Basis bildet NVIDIA Isaac Sim, ein Referenz-Anwendungsframework, das auf NVIDIA Omniverse aufbaut und es Entwicklern ermöglicht, KI-gesteuerte Roboter zu konstruieren, zu trainieren, zu testen und zu validieren. Die Plattform unterstützt LiDAR-Sensoren, RGB-Kameras, Tiefensensoren und Segmentierungsmasken und generiert synthetische Daten für das Training von Robotersicht und autonomer Navigation. Durch GPU-beschleunigte Parallelisierung können tausende Robotersimulationen gleichzeitig ausgeführt werden, was eine bis zu hundertfache Beschleunigung des Trainings gegenüber CPU-basierten Ansätzen ermöglicht.
Das Mega NVIDIA Omniverse Blueprint stellt einen skalierbaren Referenz-Workflow für die Simulation von Multi-Roboter-Flotten in industriellen digitalen Zwillingen bereit. Unternehmen können damit heterogene Roboterflotten testen und trainieren, die mobile Roboter, humanoide Assistenten, intelligente Kameras und KI-Agenten in Fabriken und Lagerhäusern umfassen. Dieser Simulation-First-Ansatz ermöglicht es, zu validieren, dass Roboterflotten koordiniert und adaptiv in dynamischen Umgebungen agieren können, bevor sie physisch eingesetzt werden.
Deutschland besitzt in diesem Bereich einen strukturellen Heimvorteil. Siemens gilt als Weltmarktführer bei der Digital-Twin-Technologie und hat bei der CES 2025 wegweisende Innovationen im Bereich industrieller KI und digitaler Zwillinge vorgestellt. Der Siemens Industrial Copilot for Operations bringt industrielle KI direkt auf die Produktionsebene und ermöglicht schnelle Echtzeit-Entscheidungen für Bediener und Wartungsingenieure. In Zusammenarbeit mit NVIDIA wurde der Teamcenter Digital Reality Viewer angekündigt, der großmaßstäbliche, physikbasierte Visualisierung direkt in das Product Lifecycle Management System bringt.
Die praktische Anwendung dieser Technologien in deutschen Unternehmen schreitet voran. Schaeffler hat eine Technologiepartnerschaft mit NVIDIA angekündigt, um digitale Zwillinge für mehr als 100 Werke zu entwickeln. Mithilfe von KI-gestützten Lösungen können Mitarbeiter physikalische Eigenschaften von Materialien, Prozessen und Produktionsabläufen simulieren und schneller optimieren. Die Plattform ermöglicht zudem die flexible Integration zukünftiger Technologien wie humanoider Roboter in Produktionsumgebungen. T-Systems und Drees & Sommer arbeiten gemeinsam an der Integration von NVIDIA Omniverse für die nächste Generation digitaler Produktionswerke, wobei erste erfolgreiche Projekte bereits im Automobilsektor implementiert wurden.
Passend dazu:
Die Demokratisierung der Robotik durch kognitive Kollaboration
Der Wandel des Roboters vom dummen Werkzeug zum kognitiven Partner vollzieht sich durch die Integration von Fähigkeiten zur Wahrnehmung, Kommunikation und sicheren Interaktion mit Menschen. Kognitive kollaborative Roboter, sogenannte Cobots, können sehen, hören, fühlen und sicher auf Menschen reagieren. Der globale Cobot-Markt erreicht 2025 ein Volumen von 10,32 Milliarden US-Dollar, wobei Deutschland eine jährliche Wachstumsrate von circa 15 Prozent über die nächsten fünf Jahre erwartet. Allein in Deutschland werden für 2025 Verkäufe von mehr als 71.000 Cobot-Einheiten prognostiziert.
Das Konzept des Neuraverse, der von NEURA Robotics entwickelten KI-gestützten Robotikplattform, repräsentiert einen Paradigmenwechsel in der Art, wie Roboter lernen und Fähigkeiten teilen. Die Plattform verbindet alle robotischen Systeme von der Echtzeit-Synchronisation bis zur großmaßstäblichen Optimierung. Alle Roboter sind sicher mit dem Echtzeit-Digital-Twin verbunden und werden im großen Maßstab über individualisiertes Monitoring, Analytik und Leistungsverfolgung optimiert. Die zentrale Innovation liegt im kollektiven Lernen: Was ein Roboter lernt, ist sofort für alle anderen Roboter desselben Typs weltweit verfügbar.
NEURA Robotics baut eigene physische KI-Trainingszentren, sogenannte NEURA Gyms, in denen Daten aus realen Anwendungsszenarien generiert werden. Kombiniert mit synthetischen Daten aus dem Neuraverse entsteht ein hochkomplexes, transferierbares Modell. Sobald eine Fähigkeit erfolgreich trainiert ist, kann sie auf alle anderen Roboter übertragen werden. Die geschichtete KI-Architektur integriert Echtzeit-Sensorinferenz, lokale Inferenz und Verfeinerung auf dem Gerät, verteiltes Multi-Agenten-Rechnen, eine Modellbibliothek für Foundation-Modelle und cloud-basierte Trainingsinfrastruktur.
Die modulare, sichere Struktur des Neuraverse ermöglicht es Unternehmen, Entwicklern und Anwendungspartnern, gemeinsam zu innovieren, ohne ihr geistiges Eigentum zu gefährden. Partner können Anwendungen oder Skills für die Plattform entwickeln, etwa zum Staubsaugen, Ausräumen der Spülmaschine, Aufräumen von Räumen oder für Gesundheitsanwendungen. Diese Skills können an interessierte Nutzer branchenübergreifend verkauft werden, was ein demokratisches Innovationsmotor für die Robotik schafft.
Diese Entwicklung adressiert direkt das Kernproblem des deutschen Mittelstands: die High-Mix-Low-Volume-Produktion. Deutsche Unternehmen fertigen typischerweise eine breite Palette von Produktvarianten in relativ kleinen Stückzahlen, was hohe Flexibilität, Präzision und Agilität erfordert. Traditionelle Automatisierung, die auf große, wiederholbare Läufe standardisierter Produkte optimiert ist, war für diese Produktionsphilosophie oft nicht wirtschaftlich. Die Automatisierung der Automatisierung, wie das Fraunhofer IPA es formuliert, setzt Softwarelösungen und maschinelle Lernverfahren ein, um Programmier- und Rekonfigurationsaufwände für Bauteilvarianten zu automatisieren und den Robotereinsatz auch bei kleinen Losgrößen wirtschaftlich zu machen.
Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) - Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) – Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung - Bild: Xpert.Digital
Hier erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen schnell, sicher und ohne hohe Einstiegshürden realisieren kann.
Eine Managed AI Platform ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket für künstliche Intelligenz. Anstatt sich mit komplexer Technik, teurer Infrastruktur und langwierigen Entwicklungsprozessen zu befassen, erhalten Sie von einem spezialisierten Partner eine fertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung – oft innerhalb weniger Tage.
Die zentralen Vorteile auf einen Blick:
⚡ Schnelle Umsetzung: Von der Idee zur einsatzbereiten Anwendung in Tagen, nicht Monaten. Wir liefern praxisnahe Lösungen, die sofort Mehrwert schaffen.
🔒 Maximale Datensicherheit: Ihre sensiblen Daten bleiben bei Ihnen. Wir garantieren eine sichere und konforme Verarbeitung ohne Datenweitergabe an Dritte.
💸 Kein finanzielles Risiko: Sie zahlen nur für Ergebnisse. Hohe Vorabinvestitionen in Hardware, Software oder Personal entfallen komplett.
🎯 Fokus auf Ihr Kerngeschäft: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können. Wir übernehmen die gesamte technische Umsetzung, den Betrieb und die Wartung Ihrer KI-Lösung.
📈 Zukunftssicher & Skalierbar: Ihre KI wächst mit Ihnen. Wir sorgen für die laufende Optimierung, Skalierbarkeit und passen die Modelle flexibel an neue Anforderungen an.
Mehr dazu hier:
Deutschlands entscheidendes Zeitfenster im Wettlauf um humanoide Roboter: Wie No-Code-Robotik den Mittelstand revolutioniert
Die Überwindung der Komplexitätsbarriere für den industriellen Mittelstand
Die Demokratisierung der Physical AI erreicht ihre vollständige Wirkung erst, wenn die Bedienung dieser Systeme so einfach wird wie die eines Smartphones. No-Code- und Low-Code-Plattformen für die Roboterprogrammierung ermöglichen es Facharbeitern ohne Programmierkenntnisse, robotische Systeme für Aufgaben wie Bin-Picking, Pick-and-Place und 3D-Objekterkennung zu konfigurieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Laut Gartner werden bis 2025 siebzig Prozent aller neuen von Organisationen entwickelten Anwendungen Low-Code- oder No-Code-Technologien nutzen, verglichen mit weniger als 25 Prozent im Jahr 2020.
Die natürliche Sprachsteuerung für Maschinen repräsentiert die nächste Evolutionsstufe. Vision-Language-Action-Modelle ermöglichen es, einem Roboter eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, die dann direkt in ausführbare Aktionen übersetzt wird. Ein Facharbeiter kann dem Roboter sagen oder zeigen, welche Aufgabe zu erledigen ist, etwa ein bestimmtes Teil zu nehmen und vorsichtig in eine Kiste zu legen, ohne die zugrundeliegende Programmierung verstehen zu müssen. Diese Entwicklung ist der Schlüssel zur breiten Adaption im deutschen Mittelstand, der über tiefes Prozesswissen, aber wenig spezialisiertes IT-Personal verfügt.
Die Adoptionsrate von KI im deutschen Mittelstand zeigt eine ambivalente Entwicklung. Während 91 Prozent der deutschen Unternehmen generative KI als wichtig für ihr Geschäftsmodell und ihre zukünftige Wertschöpfung betrachten, ein Anstieg um 36 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, bleibt die tatsächliche Nutzungsrate deutlich dahinter zurück. Nur etwa 19 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nutzen KI-Verfahren, ein Wert, der über dem EU-Durchschnitt liegt, aber deutlich unter vergleichbaren Unternehmen in Dänemark mit 26 Prozent, Schweden mit 24 Prozent oder Belgien mit 23 Prozent. Die Kluft zwischen KMU und Großunternehmen weitet sich: Während nur etwa jedes fünfte KMU in Deutschland künstliche Intelligenz nutzt, tut dies fast jedes zweite Großunternehmen.
Die Hindernisse für die KI-Adoption im Mittelstand sind vielfältig. Der Fachkräftemangel selbst stellt eine der größten Barrieren dar, da qualifiziertes Personal für Digitalisierungs- und KI-Projekte fehlt. Die technologische Komplexität von KI-Lösungen schreckt viele mittelständische Unternehmen ab, wobei 29 Prozent der befragten Unternehmen die Komplexität als zentrales Hindernis sehen. Die Integration neuer KI-Systeme in bestehende IT-Landschaften stellt eine weitere Herausforderung dar, ebenso wie die Qualität und Verfügbarkeit von Daten, die häufig unstrukturiert, verteilt oder in inkompatiblen Formaten vorliegen. Regulatorische Unsicherheiten, insbesondere im Umgang mit neuen Gesetzen wie dem EU AI Act, verursachen eine Investitionszurückhaltung, und die Angst vor dem Verlust der Kontrolle über sensible Unternehmensdaten, besonders beim Rückgriff auf ausländische Cloud- oder KI-Anbieter, ist weit verbreitet.
Die Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom adressiert mehrere dieser Barrieren direkt. Als souveräne Infrastruktur unter europäischen Datenschutzstandards reduziert sie die Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Die Skalierbarkeit ermöglicht auch kleineren Unternehmen den Zugang zu Rechenkapazitäten, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Die Integration mit SAP-Systemen, die in vielen deutschen Unternehmen bereits implementiert sind, senkt die Integrationsbarriere. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, dass die Investitionsbereitschaft die tatsächliche Implementierung übertrifft: 82 Prozent der Unternehmen planen, ihre KI-Budgets in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen, mehr als die Hälfte um mindestens 40 Prozent, doch die flächendeckende Nutzung bleibt oft fragmentiert.
Der globale Wettlauf um die physische Intelligenz
Der Wettbewerb um die Führerschaft in der Physical AI vollzieht sich in einem Dreieck zwischen den Vereinigten Staaten, China und Europa, wobei jede Region distinkte Stärken und Strategien einbringt. Die USA dominieren bei der Entwicklung von Foundation Models und der Kapitalausstattung von Start-ups. Figure AI, ein 2022 gegründetes Unternehmen, befindet sich in der Finanzierungsrunde für 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 39,5 Milliarden US-Dollar. Apptronik hat im Februar 2025 eine Series-A-Runde über 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen, mit Beteiligung von Google, dessen DeepMind-Abteilung mit Apptronik bei der Entwicklung von Verhaltensmodellen für bipede Roboter zusammenarbeitet. Tesla plant für 2025 die Produktion von 5.000 Optimus-Einheiten und strebt langfristig eine jährliche Kapazität von einer Million Robotern an, wobei Elon Musk behauptet, Optimus könnte einen Wert von 10 Billionen US-Dollar generieren.
China verfolgt eine staatlich koordinierte Strategie zur Entwicklung der humanoiden Robotikindustrie. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat eine Roadmap für ein vollständiges humanoider Ökosystem bis 2025 veröffentlicht. Im November 2025 wurde ein Standardisierungskomitee für humanoide Roboter mit 65 Mitgliedern eingerichtet, darunter Führungskräfte von Unitree Robotics, ZhiYuan Robotics, Huawei, ZTE und XPeng sowie Wissenschaftler von Tsinghua-Universität und Shanghai Jiao Tong-Universität. China verfügt über mehr als die Hälfte aller weltweit aktiven Unternehmen im Bereich humanoider Roboter, unterstützt durch Regierungspolitik und lokale Anreize. Die Verkäufe humanoider Roboter in China werden 2025 voraussichtlich 10.000 Einheiten überschreiten, ein Anstieg von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Kostenstruktur chinesischer Anbieter stellt eine wettbewerbliche Herausforderung dar. Unitree Robotics bietet mit dem G1 einen humanoiden Einsteiger-Roboter für etwa 6.000 US-Dollar an, weit unter den Preispunkten westlicher Konkurrenten. Während der preiswerte Unitree-Bot weniger ausgereift ist als Tesla Optimus, demonstriert sein früher Markteintritt zu einem erschwinglichen Preis den Vorteil Chinas bei Teilen, Produktionsanlagen und Arbeitskräften, die für eine schnelle und kostengünstige Markteinführung erforderlich sind. Laut TrendForce übertrifft die neueste Generation von Tesla Optimus die Produkte der führenden chinesischen Hersteller in Bezug auf Körper- und Handvielseitigkeit, Tragfähigkeit und Batterielebensdauer deutlich, doch der Preisvorteil bleibt ein kritischer Faktor für die Massenadoption.
Die Europäische Union hat ihre Apply-AI-Strategie im Oktober 2025 vorgestellt, einen umfassenden Plan zur Beschleunigung der KI-Adoption in elf Sektoren bei gleichzeitiger Wahrung der strategischen Autonomie. Die Strategie betont, dass es eine Priorität für die EU ist, sicherzustellen, dass europäische Modelle mit Spitzenfähigkeiten die Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit auf vertrauenswürdige und menschenzentrierte Weise stärken. Die Kommission hat Vulnerabilitäten im KI-Stack identifiziert, bei denen staatliche und nichtstaatliche Akteure externe Abhängigkeiten, einschließlich Cloud-Computing-Infrastruktur, Halbleiterchips und Software-Frameworks, als Waffe einsetzen könnten.
Eine Accenture-Studie vom November 2025 zeigt, dass 62 Prozent der europäischen Organisationen aufgrund der aktuellen geopolitischen Unsicherheit souveräne Lösungen suchen, wobei der Anteil bei deutschen Organisationen mit 72 Prozent besonders hoch ist. Dennoch räumen 65 Prozent ein, dass sie ohne nicht-europäische Technologieanbieter nicht wettbewerbsfähig bleiben können. Durchschnittlich erfordern nur 36 Prozent der KI-Initiativen und Daten in europäischen Organisationen aufgrund regulatorischer Anforderungen oder Datensensibilität einen souveränen Ansatz.
- KI Industrie 5.0: Wie das 6,2 Milliarden Dollar Project Prometheus von Jeff Bezos (Amazon) die KI in die Fabrikhallen bringt
Die strukturellen Herausforderungen des Industriestandorts Deutschland
Die Analyse der strategischen Position Deutschlands im Bereich Physical AI muss die gegenwärtigen strukturellen Schwächen der deutschen Industrie berücksichtigen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erwartet für 2025 einen Rückgang der Industrieproduktion um 0,5 Prozent, was den vierten Rückgang in Folge nach einem Minus von 4,8 Prozent im Jahr 2024 und negativen Entwicklungen in den beiden Vorjahren darstellt. Im EU-Vergleich hat die deutsche Industrie seit 2019 deutlich schlechter abgeschnitten.
Das ifo-Institut berichtet, dass im Juli 2025 etwa jedes vierte Industrieunternehmen in Deutschland einen Rückgang seiner Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Ländern außerhalb der EU meldete. Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich zuletzt in keinem Industriesektor verbessert. Der Maschinenbau ist besonders hart getroffen, wobei der Anteil der Unternehmen mit sinkender Wettbewerbsfähigkeit von 22,2 auf 31,9 Prozent gestiegen ist, der höchste Wert aller Zeiten. Die strukturellen Nachteile umfassen Energiepreise, Regulierung und Investitionsbedingungen.
Die Automobilindustrie, traditionell eine Säule der deutschen Wirtschaft, verliert weiterhin globale Wettbewerbsfähigkeit. Einst dominierende Akteure wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz haben stetig Marktanteile an US-amerikanische und chinesische Hersteller verloren. China hat sich laut Goldman Sachs vom wichtigsten Exportmarkt Deutschlands zum Hauptkonkurrenten entwickelt, insbesondere in Sektoren wie Elektrofahrzeugen, wo deutsche Automobilhersteller hinterherhinken.
Der VDMA Robotik + Automation prognostiziert für 2025 einen Rückgang des Gesamtumsatzes der deutschen Robotik- und Automatisierungsindustrie um neun Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Diese strukturellen Schwächen waren bereits 2024 evident, mit einem Rückgang der Inlandsnachfrage um 16 Prozent gegenüber 2023. Wachstumsimpulse aus dem Ausland waren ebenfalls rückläufig mit einem Minus von zwei Prozent. Der einzige Lichtblick war der Export in die Eurozone, mit einem Anstieg der Auftragseingänge um beeindruckende 44 Prozent im Jahr 2024.
Dennoch bleibt Deutschland der führende Robotikmarkt in Europa und nimmt bei der Roboterdichte mit 415 Industrierobotern pro 10.000 Beschäftigte weltweit den dritten Platz ein, nur hinter Südkorea und Singapur. Der Bestand an operativen Industrierobotern erreichte 2023 mit 269.427 Einheiten einen neuen Rekordwert. Zwischen 2019 und 2024 wurden mehr als 450 ausländische Direktinvestitionsprojekte im Bereich Automatisierung und Robotik in Deutschland realisiert, was den ersten Platz in Europa und den zweiten Platz weltweit nach den Vereinigten Staaten bedeutet.
Die Forschungslandschaft als Fundament industrieller Transformation
Die deutsche Forschungslandschaft im Bereich KI-basierter Robotik ist bemerkenswert robust. Mit über 1.200 wissenschaftlichen Publikationen in den letzten fünf Jahren, mehr als 70 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Großprojekten und neun deutschen Universitäten unter den Top 100 im globalen Informatik-Ranking für Robotik ist der Standort gut positioniert. Eine Trendstudie der Beratungsfirma Capgemini zeigt, dass KI-basierte Robotik und generative KI zu den fünf weltweit führenden Technologietrends im Jahr 2025 gehören. Fast die Hälfte der weltweit befragten Unternehmen entwickelt derzeit Anwendungsszenarien, und 89 Prozent der Investoren sind überzeugt, dass KI-basierte Robotik zu den drei wichtigsten Technologiethemen im Jahr 2025 gehören wird.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, insbesondere das Institut für Robotik und Mechatronik, spielt eine Schlüsselrolle als Forschungspartner. Das Institut hat eine weitreichende Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Siemens zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Technologien für die Produktion der Zukunft gestartet. Die Zusammenarbeit zielt auf die Erforschung wegweisender Lösungen im Bereich KI-basierter, intelligenter Produktion, mit Fokus auf Roboterunterstützung, Mensch-Roboter-Interaktion und humanoide Robotik.
Der humanoide Laufroboter TORO, seit 2013 am DLR entwickelt, hat sich von einem bipeden Laufroboter zu einem vielseitigen humanoiden Roboter mit 1,74 Metern Höhe weiterentwickelt. Seine Gelenke werden nachgiebig gesteuert, was ihm ermöglicht, sicher mit Menschen zu interagieren, robust zu gehen und Treppen zu steigen. Nun kann TORO auch sehen, fühlen und seine Umgebung verstehen durch ein neuartiges Verfahren, das am Institut entwickelt wurde und es TORO ermöglicht, visuelle Daten seiner Kamera-Augen intelligent zu interpretieren und entsprechend zu reagieren.
Die erste Deutsche Robotik-Konferenz, organisiert vom Robotics Institute Germany, fand vom 13. bis 15. März 2025 in Nürnberg statt und präsentierte die Stärke von Robotik und KI made in Germany. Über 200 Forscher präsentierten die neuesten Trends in KI-basierter Robotik, darunter Roboterdesign und Lernalgorithmen für Roboterwahrnehmung und -interaktion. Das Institut für Robotik und Mechatronik des DLR ist als Partner für den Technologietransfer verantwortlich und zielt darauf ab, Forschungsergebnisse schnell in innovative Anwendungen in der Industrie zu transferieren.
Das kritische Zeitfenster und die strategischen Implikationen
Die Branchenführer haben einen Konsens formuliert: Der ChatGPT-Moment für humanoide Roboter ist eingetreten, und 2025 markiert das Eröffnungsjahr der Massenproduktion. Der Begriff bezieht sich auf den kulturellen Wendepunkt Ende 2022, als OpenAIs ChatGPT die breite Akzeptanz großer Sprachmodelle und die Anerkennung ihres Potenzials auslöste. Wang Xingxing, Gründer von Unitree Robotics, prognostiziert, dass der ChatGPT-Moment der Robotikbranche innerhalb von ein bis fünf Jahren eintreten wird, wenn humanoide Roboter einer Person in einer Menschenmenge in einer unbekannten Umgebung auf Anweisung des Besitzers sanft eine Wasserflasche überreichen können.
Die technologischen Voraussetzungen für diesen Durchbruch sind zunehmend gegeben. Verbesserungen in der Feinmotorik der Hände und Arme humanoider Roboter, Fortschritte in der Agilität, bessere Weltmodelle für synthetische Datentrainingsumgebungen, verstärkte Finanzierung für Robotik und Verteidigungsanwendungen sowie die Entstehung schnell lernender Roboter durch Physical-AI-Fortschritte konvergieren zu einem perfekten Sturm der Innovation. Das chinesische Unternehmen Galbot hat bereits fast 1.000 Roboter in verschiedenen Unternehmen eingesetzt, ein bedeutender Meilenstein, der nahelegt, dass die Technologie von Prototypen in reale Anwendungen übergeht.
Die Investitionsbereitschaft folgt dieser Dynamik. Der Deal-Wert im Bereich humanoider und KI-gesteuerter Robotik stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 7,3 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren signalisiert. Die Inflektionspunkte der Jahre 2025 und 2026 werden bestimmen, welche Unternehmen und Nationen die Marktführerschaft in der nächsten Stufe der industriellen Evolution übernehmen werden.
Deutschland besitzt in diesem Wettbewerb einen strukturellen Vorteil, der oft als unfair advantage bezeichnet wird. Während die USA bei den Algorithmen führen und China bei der Skalierung von Consumer-Hardware dominiert, verfügt Deutschland über die Domänenexpertise in der Mechatronik und den Zugang zu realen Industriedaten. Die Weltmarktführerschaft bei der Digital-Twin-Technologie durch Siemens, die etablierten Partnerschaften mit NVIDIA im Bereich Industrial AI Cloud, die aufstrebenden nationalen Champions wie NEURA Robotics und Agile Robots sowie die robuste Forschungslandschaft mit dem DLR und den Fraunhofer-Instituten bilden ein einzigartiges Ökosystem.
Die Gefahr besteht jedoch, dass dieses Potenzial nicht realisiert wird. Der deutsche Mittelstand bleibt bei der KI-Adoption hinter vergleichbaren Ländern zurück. Die strukturellen Wettbewerbsnachteile in Bezug auf Energiepreise, Regulierung und Investitionsbedingungen belasten die Industrie. Die demografische Entwicklung verschärft den Fachkräftemangel kontinuierlich. Die Investitionszurückhaltung bei Unternehmen, die sich angesichts unsicherer Rahmenbedingungen zur Vorsicht entschließen, könnte das Zeitfenster für die Etablierung einer Führungsposition schließen.
Die strategische Implikation ist eindeutig: Wer jetzt in cyber-physische Systeme investiert, sichert sich die Marktführerschaft in der kommenden Dekade. Wer zögert, degradiert sich zum reinen Hardware-Lieferanten für US-amerikanische KI-Modelle oder zum Absatzmarkt für chinesische Massenfertigung. Die Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom, die humanoiden Roboter von NEURA und Agile Robots, die Digital-Twin-Kompetenz von Siemens und die Forschungsexzellenz der deutschen Wissenschaftslandschaft bilden die Bausteine für eine deutsche Pole-Position im globalen Wettlauf um Physical AI. Ob diese Bausteine zu einem kohärenten Ganzen zusammengefügt werden, entscheidet sich in den kommenden 18 bis 24 Monaten.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
LTW Lösungen
LTW bietet seinen Kund:innen keine losen Bausteine, sondern integrierte Gesamtlösungen. Beratung, Planung, mechanische und elektrotechnische Komponenten, Steuerungs- und Leittechnik sowie Software und Service – alles ist vernetzt und präzise aufeinander abgestimmt.
Besonders vorteilhaft ist die eigene Fertigung wesentlicher Komponenten. Dadurch können Qualität, Lieferketten und Schnittstellen optimal kontrolliert werden.
LTW steht für Verlässlichkeit, Transparenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Loyalität und Ehrlichkeit sind fest im Unternehmensverständnis verankert – hier zählt noch ein Handschlag.
Passend dazu:
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier: