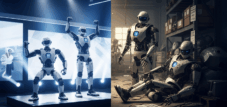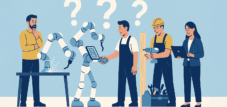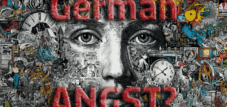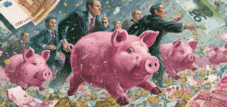Trotz voller Auftragsbücher: Warum der Exoskelett-Star German Bionic plötzlich Insolvenz anmelden muss
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 20. November 2025 / Update vom: 20. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Trotz voller Auftragsbücher: Warum der Exoskelett-Star German Bionic plötzlich Insolvenz anmelden muss – Bild: Xpert.Digital
Die Insolvenz von German Bionic: Wenn Innovation auf Finanzierungsrealität trifft
Europas Exoskelett-Vorreiter scheitert an der Kapitallücke – Ein Lehrstück über strukturelle Schwächen im deutschen Hightech-Ökosystem
Die Insolvenzanmeldung von German Bionic Systems im November 2025 markiert einen weiteren schmerzhaften Einschnitt in der deutschen Hightech-Landschaft. Das Augsburger Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2017 als europäischer Technologieführer für intelligente, KI-gestützte Exoskelette galt, musste beim Amtsgericht Augsburg einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens stellen. Mit rund 70 Mitarbeitenden und einem breiten Patentportfolio zählte German Bionic zu jenen innovativen Unternehmen, denen Analysten und Politiker gleichermaßen eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen zuschrieben. Der Fall wirft fundamentale Fragen über die Funktionsfähigkeit des europäischen Innovationssystems auf und offenbart strukturelle Defizite, die weit über das Einzelschicksal eines Unternehmens hinausweisen.
Die Chronik eines angekündigten Scheiterns
Das Paradoxon der German Bionic-Insolvenz liegt in der scheinbar widersprüchlichen Konstellation von operativem Erfolg und finanziellem Kollaps. Geschäftsführer Armin G. Schmidt betonte ausdrücklich, dass nicht die operative Lage des Unternehmens zur Insolvenz geführt habe, sondern die kurzfristige Rücknahme zugesagter Investitionen. Trotz einer sehr positiven Umsatzentwicklung und eines dynamisch wachsenden Marktes sah sich das Unternehmen mit der unerwarteten Rücknahme von Investitionszusagen konfrontiert. Das Scheitern einer finalen Finanzierungsrunde löste einen akuten Liquiditätsengpass aus, der die Insolvenzanmeldung unumgänglich machte. German Bionic hatte für den Sommer 2026 den Break-even erwartet und befand sich damit in einer Phase, in der Hardware-Startups typischerweise noch auf externe Kapitalzuführungen angewiesen sind.
Diese Konstellation offenbart einen grundlegenden Konstruktionsfehler im Finanzierungsmodell hardwarelastiger Deeptech-Startups. Während Software-Unternehmen oft bereits nach sechs bis achtzehn Monaten die Gewinnzone erreichen können, benötigen Hardware-Startups deutlich längere Vorlaufzeiten. Die Entwicklung physischer Produkte, der Aufbau von Produktionskapazitäten und die Etablierung komplexer Lieferketten erfordern mehrjährige Investitionszyklen. German Bionic durchlief typische Entwicklungsphasen eines Hardware-Startups: Von der Gründung 2017 über die Produktentwicklung und Markteinführung bis zur geplanten Skalierung. Die Erwartung, erst im Sommer 2026 den Break-even zu erreichen, entspricht einem neunjährigen Entwicklungszyklus und liegt damit am oberen Ende dessen, was Bankkredite finanzieren würden, aber noch im Rahmen dessen, was Risikokapitalgeber bei vielversprechenden Deeptech-Unternehmen akzeptieren.
Das Investorenpuzzle: Von Samsung bis zur Europäischen Investitionsbank
Die Finanzierungsgeschichte von German Bionic liest sich wie ein Who’s Who der internationalen Technologiefinanzierung und illustriert zugleich die Komplexität moderner Venture-Capital-Strukturen. Im Dezember 2020 sicherte sich das Unternehmen in einer Series-A-Finanzierungsrunde 20 Millionen US-Dollar von einem namhaften Konsortium. Samsung Catalyst Fund und die Münchner MIG AG führten die Runde an, begleitet von Storm Ventures, Benhamou Global Ventures und dem japanischen Investor IT Farm. Für die MIG AG, die mit ihrer frühen Beteiligung an BioNTech legendäre Erfolge feierte und ihren Anlegern aus BioNTech-Aktienverkäufen allein im Jahr 2020 Rekordausschüttungen von 600 Millionen Euro ermöglichte, stellte German Bionic das vierte Neuinvestment des Jahres 2020 dar.
Die Beteiligung des Wachstumsfonds Bayern, getragen von der LfA Förderbank Bayern und Bayern Kapital, unterstrich die strategische Bedeutung, die dem Unternehmen auf Landesebene beigemessen wurde. Der Wachstumsfonds Bayern 2 verfügte nach dem Einstieg der Europäischen Investitionsbank mit 50 Millionen Euro über ein Gesamtvolumen von 165 Millionen Euro und sollte innovative bayerische Startups gezielt fördern. Die EIB selbst stellte German Bionic im Dezember 2022 ein Venture-Debt-Darlehen von 15 Millionen Euro zur Verfügung, unterstützt durch das InvestEU-Programm der Europäischen Union. Diese Finanzierungsform, bei der die Vergütung weitgehend an den Unternehmenserfolg gekoppelt ist, ergänzt bestehende Risikokapitalfinanzierungen ohne die Anteile der Gründer zu verwässern. Das Darlehen sollte in Forschung und Entwicklung fließen und die internationale Expansion vorantreiben.
Trotz dieser beeindruckenden Investorenliste und eines Gesamtinvestitionsvolumens, das sich auf über 35 Millionen Euro belief, reichte das Kapital nicht aus, um das Unternehmen bis zur Profitabilität zu führen. Die gescheiterte finale Finanzierungsrunde Ende 2025 markiert das abrupte Ende einer Erfolgsgeschichte, die alle Ingredienzien für einen europäischen Technologie-Champion zu besitzen schien: innovative Technologie, relevanter Markt, namhafte Investoren und öffentliche Förderung. Das plötzliche Ausbleiben zugesagter Investitionen verweist auf ein fundamental verändertes Investitionsklima, das selbst vielversprechende Deeptech-Unternehmen in existenzielle Krisen stürzt.
Der Exoskelett-Markt: Zwischen Wachstumsprognosen und Realisierungsrisiken
Die Marktpotenziale, die Analysten dem Exoskelett-Sektor zuschreiben, bewegen sich in einer Dimension, die das Scheitern von German Bionic umso schmerzlicher erscheinen lässt. Führende Marktforschungsinstitute prognostizieren ein exponentielles Wachstum: Der globale Exoskelettmarkt hatte 2025 einen Wert von 555 Millionen US-Dollar und soll bis 2035 auf 4,23 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 22,5 Prozent entspricht. Andere Prognosen fallen noch optimistischer aus und erwarten ein Marktvolumen von 30,56 Milliarden US-Dollar bis 2032, was auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 43,1 Prozent hinausliefe.
Diese Diskrepanz zwischen verschiedenen Marktprognosen illustriert bereits die Unsicherheit, die mit Zukunftsmärkten verbunden ist. Während die Grundannahmen über die Treiber des Marktwachstums weitgehend konsensfähig erscheinen, divergieren die quantitativen Einschätzungen erheblich. Unstrittig ist, dass mehrere Megatrends die Nachfrage nach Exoskeletten befördern: Der demografische Wandel führt zu einer alternden Erwerbsbevölkerung, die länger im Arbeitsprozess verbleiben muss. Weltweit erleiden jährlich zwischen 250.000 und 500.000 Menschen Rückenmarksverletzungen. Muskel- und Skeletterkrankungen verursachen rund 23 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage. Der chronische Fachkräftemangel in körperlich anspruchsvollen Branchen verschärft sich kontinuierlich.
In Deutschland ist der Fachkräftemangel in der Logistikbranche nach Einschätzung von Experten gemessen an der Zahl der Beschäftigten dramatischer als in der Pflege. Bereits 2021 fehlten rund 36.000 Berufskraftfahrer, und jedes Jahr gehen weitere 36.000 in Rente, während nur 15.000 Neueinsteiger nachrücken. In der Pflege werden bis 2027 rund 36.000 Pflegekräfte fehlen, und das Statistische Bundesamt rechnet mit einer Verdreifachung des Bedarfs an Pflegepersonal bis 2049. Diese strukturellen Engpässe schaffen theoretisch ideale Rahmenbedingungen für Technologien, die menschliche Arbeitskraft unterstützen und ergänzen.
Technologische Exzellenz als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung
German Bionic positionierte sich als weltweit erstes Unternehmen, das ein vollständig vernetztes, KI-basiertes Exoskelett für die Arbeitswelt entwickelte. Das Flaggschiffprodukt Cray X, in der vierten Generation nur noch sieben Kilogramm schwer, konnte Lasten von bis zu 30 Kilogramm beim Heben abfangen. Die intelligente Software erkannte nicht nur Hebebewegungen, sondern korrigierte auch rückengefährdende Bewegungsabläufe: Je unergonomischer die Hebetechnik des Trägers, desto stärker die Unterstützung durch das Exoskelett. Zwei von einer intelligenten Software gesteuerte Motoren zogen den Träger an den Schultern nach oben, und die Kraft wurde auf die Oberschenkel umgeleitet.
Die technologische Differenzierung lag in der Vernetzung mit der German Bionic IO, einer selbstständig lernenden Robotik-Lösung für die Cloud, die sich in Fabrikprozesse integrieren ließ. Das System sammelte in Echtzeit Daten der Exoskelette und passte die Hebeleistung selbstständig optimal an die jeweiligen Erfordernisse an. Diese Kombination aus Hardware und cloudbasierter Softwareplattform unterschied German Bionic von Anbietern passiver Exoskelette, die lediglich mechanische Komponenten wie Sprungfedern nutzten. Die Fähigkeit, ergonomische Echtzeit-Daten aus dem Arbeitsalltag zu liefern, sollte nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden schützen, sondern auch Arbeitsabläufe datenbasiert optimieren.
Diese technologische Exzellenz manifestierte sich in zahlreichen Auszeichnungen: Der Bayerische und Deutsche Gründerpreis 2019, der Best of Innovation Award der CES, der Fast Company Innovation by Design Award und der Innovation Champion Award der European Investment Bank würdigten die Leistung des Unternehmens. Das breite Patentportfolio und die hochqualifizierten Teams an den Standorten Augsburg und Berlin unterstrichen die Innovationskraft. Kunden wie DPD, die das Cray X in Langzeittests in ihren Logistikzentren einsetzten, berichteten von positiven Erfahrungen. In einem zweimonatigen Test im Paketzentrum Malsch bei Karlsruhe, wo jährlich über 860.000 Pakete mit Kopierpapier à 26 Kilogramm entladen wurden, fanden Mitarbeitende in den Exoskeletten eine praktische Unterstützung im Arbeitsalltag. Die Resonanz war so positiv, dass DPD den Test verlängerte und weitere Standorte ausstattete.
Doch all diese technologischen Erfolge konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwischen technologischer Machbarkeit und kommerzieller Skalierbarkeit eine Kluft besteht, die viele Hardware-Startups nicht überwinden. Die Entwicklung eines funktionierenden Prototyps ist eine Sache, der Aufbau serienreifer Produktionskapazitäten, die Etablierung von Vertriebsstrukturen und die Generierung ausreichender Umsätze eine ganz andere. German Bionic hatte eine 1.000 Quadratmeter große Fertigungsanlage in Augsburg eröffnet und war weltweit vertreten mit Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Die internationale Expansion verschlang jedoch Kapital, ohne dass die Umsätze bereits ausreichten, um die laufenden Kosten und Investitionen zu decken.
Das Dilemma der Hardwarestartups: Kapitalintensität trifft auf Investorenzurückhaltung
Die Schwierigkeiten, mit denen Hardware-Startups konfrontiert sind, unterscheiden sich fundamental von jenen softwarebasierter Geschäftsmodelle. Studien zeigen, dass etwa 97 Prozent der Consumer-Hardware-Startups ihr Produkt nicht liefern können. Die Gründe sind vielfältig: Hohe anfängliche Hardwarekosten, ineffiziente Teams, fehlender Fokus auf die Definition eines Minimum Viable Product, Skalierungsprobleme in der Produktion, komplexe Lieferketten und lange Entwicklungszyklen. Während Software-Startups mit vergleichsweise geringen Mitteln skalieren können, erfordern Hardware-Produkte erhebliche Vorabinvestitionen in Werkzeuge, Formen, Produktionsanlagen und Qualitätssicherung.
Diese Kapitalintensität kollidiert mit einem Venture-Capital-Markt, der zunehmend risikoavers agiert. In Deutschland zeigt sich seit Jahren eine Zurückhaltung bei Investitionen in kapitalintensive Deeptech-Unternehmen. Während im ersten Quartal 2025 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf 4.187 Fälle stieg, ein Anstieg von einem Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, verschärfte sich die Situation für Startups dramatisch. Im Jahr 2025 eröffneten 336 Startups ein Insolvenzverfahren, rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr und sogar 85 Prozent mehr als 2022. Die deutsche Startup-Landschaft entwickelt sich zu einer Zweiklassengesellschaft: Einige wenige Unternehmen, vor allem aus der Rüstungsbranche und der Künstlichen Intelligenz, erhalten Millionen an Risikokapital und erreichen Milliardenbewertungen, während die Mehrheit gegen die Insolvenz kämpft.
Der Wegfall staatlicher Unterstützungsmaßnahmen aus der Corona-Pandemie, deutlich gestiegene Zinsen und eine allgemeine Risikoaversion haben das Kapitalumfeld fundamental verändert. Nach Jahren des Growth at all costs-Mantras senden Venture-Capital-Geber, Private-Equity-Investoren und Exit-Märkte eine klare Botschaft: Nur Startups mit positivem Cashflow sind investierbar. Diese Verschiebung ist eine direkte Reaktion auf veränderte makroökonomische Bedingungen. Während vor wenigen Jahren hohe Wachstumsraten bei steigenden Verlusten akzeptiert wurden, gilt heute die Devise Profitabilität über Wachstum.
Für German Bionic bedeutete dies eine paradoxe Zwickmühle: Um die Profitabilität zu erreichen, hätte das Unternehmen seine internationale Expansion beschleunigen und Skaleneffekte realisieren müssen. Dies erforderte jedoch zusätzliches Kapital. Um zusätzliches Kapital zu akquirieren, hätten Investoren eine klare Perspektive auf baldige Profitabilität sehen müssen. Der geplante Break-even im Sommer 2026 lag zwar in erreichbarer Nähe, doch offenbar waren Investoren nicht mehr bereit, die Brückenfinanzierung zu übernehmen. Die positive Umsatzentwicklung und der dynamisch wachsende Markt reichten nicht aus, um das Vertrauen in die finale Finanzierungsrunde zu sichern. Als die zugesagten Investitionen kurzfristig zurückgezogen wurden, brach das Kartenhaus zusammen.
Scale-up-Finanzierung: Die vergessene Lücke im deutschen Innovationsökosystem
Die German Bionic-Insolvenz verdeutlicht ein strukturelles Problem, das in der deutschen Startup- und Innovationspolitik seit langem bekannt ist, aber nur unzureichend adressiert wird: die Scale-up-Finanzierungslücke. Während für die Frühphasenfinanzierung diverse Programme existieren und auch für etablierte Mittelständler Kapital verfügbar ist, mangelt es in Deutschland eklatant an Wachstumskapital für Unternehmen in der kritischen Phase zwischen Produktvalidierung und profitablem Massenbetrieb. Trotz verstärkten staatlichen Engagements weichen die Investitionsvolumina deutlich von anderen Ländern wie den USA oder China ab, und Venture-Capital-Geber sind deutlich risikoaverser.
Europäische Deeptech-Startups stehen vor der paradoxen Situation, dass sie immer früher Finanzierungen erhalten, während gleichzeitig das technische Reifestadium abnimmt. Eine Studie von First Momentum zum europäischen Deeptech-Markt zeigt bedeutende Veränderungen: Im Jahr 2025 hatte kein einziger Pre-Seed-Deal bereits Umsätze generiert, während es 2024 noch 11,5 Prozent waren. Gleichzeitig befinden sich 80 Prozent der Pre-Seed-Unternehmen in der Konzept- oder Labordemonstrationsphase, verglichen mit 60 Prozent im Vorjahr. Das Finanzierungsvolumen steigt, während das technische Reifestadium früher wird. Dies führt dazu, dass Unternehmen zwar früh Kapital erhalten, dann aber in späteren Phasen, wenn der Kapitalbedarf massiv ansteigt, auf trockene Brunnen stoßen.
Die Studie dokumentiert auch eine Professionalisierung der Gründerteams: 90 Prozent der Gründer in Pre-Seed-Runden verfügen über relevante Promotionen, und 42 Prozent haben mehr als fünf Jahre Industrieerfahrung. Dennoch spielen Umsätze auch in späteren Finanzierungsphasen eine untergeordnete Rolle: 30 Prozent der Series-B-Unternehmen generieren noch keine Umsätze, und nur 29 Prozent der Series-A-Startups haben einen wiederholbaren Verkaufsprozess etabliert. Diese Zahlen illustrieren, dass Deeptech-Unternehmen fundamental andere Entwicklungszyklen aufweisen als Software-Startups. Die Bewertungslogik, die in der Software-Industrie funktioniert, lässt sich nicht einfach auf hardwarelastige Geschäftsmodelle übertragen.
Für Scale-ups ergibt sich daraus eine fatale Dynamik: Um Profitabilität zu erreichen, müssen sie einsparen und Kosten senken. Sparmaßnahmen führen aber zu schwächerem Wachstum, was wiederum Investoren abschreckt. Das Beispiel Anyline, das 2025 bis zu 40 Prozent der Belegschaft kündigte und sich vom Venture-Capital-Finanzierungsmodell abwendete, zeigt dieses Dilemma exemplarisch. Viele Scale-ups greifen zum Rotstift, um die Profitabilität innerhalb von 12 bis 18 Monaten herzustellen. Diese Maßnahmen mögen operativ notwendig erscheinen, schaffen jedoch ein neues Problem: Ohne Wachstum sind Startups für Investoren unattraktiv.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
German Bionic und Lilium: Pleiten mit System und ihre Folgen – Wie fehlendes Wachstumskapital Europas Hightech-Souveränität zerstört
Die Lehren aus Lilium: Wenn Milliardeninvestitionen nicht reichen
Die Insolvenz von German Bionic reiht sich ein in eine Serie spektakulärer Pleiten deutscher Hightech-Hoffnungsträger. Besonders der Fall Lilium, der Münchner Flugtaxi-Entwickler, weist verblüffende Parallelen auf. Lilium, gegründet 2015, hatte seit dem Start rund 1,5 Milliarden Euro an Investorengeldern eingesammelt und galt als eines der ambitioniertesten Luftfahrt-Startups Europas. Das Unternehmen entwickelte ein elektrisches Flugtaxi, das senkrecht starten und landen kann, mit geplanten Reichweiten bis zu 400 Kilometern. Trotz dieser gigantischen Kapitalausstattung musste Lilium im Oktober 2024 erstmals Insolvenz anmelden, weil Löhne nicht mehr gezahlt werden konnten.
Eine Übernahme durch das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation scheiterte trotz unterzeichnetem Kaufvertrag und angekündigten 200 Millionen Euro frischem Kapital, da die zugesagte Finanzierung nicht realisiert wurde. Im Februar 2025 folgte die zweite Insolvenz. Die Parallele zu German Bionic ist frappierend: Auch hier wurden Investitionen zugesagt, die dann nicht kamen. Der slowakische Unternehmer Marian Bocek hatte wiederholt versichert, dass 150 Millionen Euro überwiesen würden, doch das Geld kam nie. Insider vermuten, dass Bocek selbst nicht über die Mittel verfügte oder seine eigenen Geldgeber absprangen.
Der Lilium-Fall offenbart, dass selbst Milliardensummen nicht ausreichen, wenn das Geschäftsmodell nicht frühzeitig tragfähige Umsätze generiert. Das Fluggerät erreichte nie die Serienreife, obwohl über Jahre hinweg entwickelt wurde. Die komplexe Insolvenzstruktur mit mehreren rechtlich getrennten Einheiten erschwerte Lösungen zusätzlich. Am Ende wurden die Patente an den US-Konkurrenten Archer Aviation verkauft, über 300 Schutzrechte zu Hochvolt-Systemen, Batteriemanagementsystemen, Flugsteuerungstechnologie und elektrischen Antriebssystemen. Das geistige Eigentum, in das 1,5 Milliarden Euro geflossen waren, wanderte ins Ausland.
Diese Entwicklung illustriert ein fundamentales Problem: Europa und insbesondere Deutschland investieren erhebliche Summen in die Entwicklung von Zukunftstechnologien, schaffen es aber nicht, diese Unternehmen bis zur kommerziellen Reife zu begleiten. Das Tal des Todes zwischen technologischer Validierung und profitabler Skalierung wird zur Sollbruchstelle. Während in den USA und China geduldiges Kapital bereitsteht, das auch längere Durststrecken finanziert, bricht in Europa die Finanzierung ab, sobald die ersten Schwierigkeiten auftreten. Die Folge: Technologien und Know-how wandern ab, oft zu internationalen Wettbewerbern, die dann die Früchte europäischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit ernten.
Strukturwandel und Automatisierung: Die makroökonomische Perspektive
Trotz des Scheiterns einzelner Unternehmen vollzieht sich in Deutschland ein tiefgreifender Strukturwandel in Richtung Automatisierung und Robotik. Die deutsche Industrie installierte 2024 rund 27.000 neue Industrieroboter, nahezu den Rekord des Vorjahres. Mit 40 Prozent aller Fabrik-Roboter in der Europäischen Union dominiert Deutschland weiterhin den kontinentalen Robotik-Markt. Die Roboterdichte liegt bei 415 Industrierobotern pro 10.000 Arbeitnehmer, was international den dritten Platz bedeutet, nur hinter Südkorea und Singapur. Der operative Bestand erreichte 278.900 Einheiten, ein Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Diese Zahlen belegen die hohe Automatisierung der deutschen Wirtschaft und deren Vorreiterrolle in Europa. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum in der metallverarbeitenden Industrie mit einem Zuwachs von 23 Prozent auf 6.000 installierte Roboter. Auch die chemische und Kunststoffindustrie zeigt mit einem Plus von 71 Prozent und 3.100 installierten Einheiten, dass das Potenzial für Wachstum in der Robotik noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die Servicerobotik wächst mit 30 Prozent deutlich stärker als die traditionelle Industrierobotik, was insbesondere für den Mittelstand neue Chancen eröffnet. Kollaborative Roboter haben sich als Gamechanger erwiesen, da sie sicher mit Menschen zusammenarbeiten können, einfach zu programmieren sind und flexible Einsatzmöglichkeiten bieten.
Der Umsatz im deutschen Robotik-Markt wird für 2025 auf etwa 4,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, wobei die Servicerobotik den größten Anteil einnimmt. Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen steigt kontinuierlich in Branchen wie Fertigung, Gesundheitswesen und Logistik, nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels und des daraus resultierenden Fachkräftemangels. In den nächsten Jahren wird die Logistikbranche einen Paradigmenwechsel erleben, der durch fortschrittliche Robotik und Künstliche Intelligenz vorangetrieben wird.
Vor diesem Hintergrund erscheint das Scheitern von German Bionic umso paradoxer: Das Unternehmen entwickelte genau jene Technologien, die der Markt benötigt und nachfragt. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sprachen für den Erfolg: wachsende Automatisierung, akuter Fachkräftemangel, alternde Erwerbsbevölkerung, steigende Gesundheitskosten durch Muskel-Skelett-Erkrankungen. Doch zwischen gesellschaftlichem Bedarf und individueller Zahlungsbereitschaft klafft eine Lücke. Die Investitionszyklen in der Industrie sind lang, Beschaffungsprozesse komplex, und die Amortisationszeiten für Exoskelette müssen für potenzielle Kunden kalkulierbar sein. Ein Cray X kostete bis zu 40.000 Euro, was eine erhebliche Investition darstellte, die sich erst über Jahre durch reduzierte Krankheitstage und gesteigerte Produktivität rechnen sollte.
Die Rolle öffentlicher Förderung: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Die Beteiligung öffentlicher und halböffentlicher Investoren an German Bionic wirft grundsätzliche Fragen über die Effektivität staatlicher Innovationsförderung auf. Der Wachstumsfonds Bayern, getragen von der LfA Förderbank Bayern und der Bayern Kapital GmbH, investierte in das Unternehmen mit der erklärten Absicht, bayerische Startups mit hoch innovativen Geschäftsmodellen gezielt voranzubringen. Die Europäische Investitionsbank stellte 15 Millionen Euro als Venture-Debt-Darlehen zur Verfügung, unterstützt durch das InvestEU-Programm. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte betont, dass InvestEU europaweit eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen beim Zugang zu Finanzmitteln spiele, die sie für innovative Forschung und Entwicklung benötigen.
Doch trotz dieser öffentlichen Unterstützung, die zusammen mit privaten Investitionen ein Gesamtvolumen von über 35 Millionen Euro ausmachte, konnte German Bionic nicht gerettet werden. Dies wirft die Frage auf, ob öffentliche Förderprogramme so strukturiert sind, dass sie Unternehmen tatsächlich bis zur kommerziellen Reife begleiten können, oder ob sie lediglich den Zeitpunkt des Scheiterns hinauszögern. Die EIB bietet Venture-Debt-Finanzierungen typischerweise zwischen fünf und 50 Millionen Euro an, und die Vergütung richtet sich nach dem Eigenkapitalrisiko der Unternehmen. Venture-Debt-Darlehen sind bei Endfälligkeit rückzahlbar und ergänzen bestehende Risikokapitalfinanzierungen, ohne die Anteile der Gründer zu verwässern.
Dieses Modell funktioniert jedoch nur, wenn Unternehmen tatsächlich den Break-even erreichen und die Darlehen aus dem operativen Cashflow zurückzahlen können. Scheitert die finale Finanzierungsrunde, wie im Fall German Bionic, werden auch öffentliche Darlehen notleidend. Die Frage, die sich stellt, lautet: Sollten öffentliche Investoren in der Lage sein, in kritischen Phasen einzuspringen und Unternehmen über Durststrecken hinwegzuhelfen, auch wenn private Investoren aussteigen? Oder würde dies zu einer Fehlallokation öffentlicher Mittel führen, da der Markt offenbar signalisiert, dass das Geschäftsmodell nicht tragfähig ist?
Die Erfahrungen mit der MIG AG zeigen, dass erfolgreiche Venture-Capital-Investitionen möglich sind. Die frühe Beteiligung an BioNTech, damals eine Investition von 13,5 Millionen Euro, generierte Ausschüttungen von über 600 Millionen Euro an die Anleger der MIG-Fonds. Dies illustriert das fundamentale Prinzip von Risikokapital: Die wenigen erfolgreichen Investments müssen so hohe Renditen abwerfen, dass sie die zahlreichen Ausfälle überkompensieren. Doch öffentliche Investoren unterliegen anderen Logiken als private Fonds. Sie können nicht einfach auf den einen großen Exit warten, sondern müssen eine hohe Quote erfolgreicher Beteiligungen aufweisen, um ihre Daseinsberechtigung zu rechtfertigen.
Insolvenzverwalter und Sanierungsperspektiven: Der steinige Weg nach vorn
Das Amtsgericht Augsburg bestellte Rechtsanwalt Oliver Schartl von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach und Kollegen zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Schartl, ein erfahrener Sanierungsexperte, steht vor der Aufgabe, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und die geschaffenen Werte zu schützen. Der Geschäftsbetrieb mit rund 70 Mitarbeitenden läuft nach Unternehmensangaben uneingeschränkt weiter. Laut German Bionic hat die Insolvenz keine Auswirkungen auf bestehende Systeme im Markt oder laufende Kundenprojekte. Diese Aussagen sollen Kunden beruhigen und signalisieren, dass das Unternehmen als Ganzes fortgeführt werden könnte.
Die Chancen für eine erfolgreiche Sanierung hängen von mehreren Faktoren ab: Erstens muss sich ein Investor finden, der bereit ist, frisches Kapital einzubringen und das Unternehmen zu übernehmen. Zweitens muss das operative Geschäft tatsächlich so robust sein, wie die Geschäftsführung behauptet. Die positive Umsatzentwicklung und der dynamisch wachsende Markt sprechen dafür, dass ein tragfähiges Geschäftsmodell existiert. Drittens muss geklärt werden, wie mit den bestehenden Verbindlichkeiten, insbesondere dem EIB-Darlehen, umgegangen wird. Die Europäische Investitionsbank als Gläubiger wird prüfen müssen, ob eine Fortsetzung des Engagements sinnvoll ist oder ob Forderungen abgeschrieben werden müssen.
Im besten Fall findet sich ein strategischer Investor, der die Technologie von German Bionic in sein Produktportfolio integrieren oder das Unternehmen als eigenständige Einheit weiterführen kann. Angesichts des wachsenden Marktes für Exoskelette könnten internationale Wettbewerber oder Unternehmen aus der Automatisierungsbranche Interesse haben. Denkbar wäre auch, dass sich ein Konsortium aus bestehenden Investoren bildet, das das Unternehmen restrukturiert und mit reduziertem Kapitalbedarf weiterführt. Die Alternative wäre eine Zerschlagung, bei der Patente und Technologien verkauft werden, wie es bei Lilium geschah.
Branchenübergreifende Implikationen: Was bedeutet dies für Deutschlands Innovationsfähigkeit
Die Insolvenz von German Bionic ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines besorgniserregenden Musters. Im Jahr 2025 mussten zahlreiche deutsche Hightech-Startups Insolvenz anmelden, darunter Evum Motors im Bereich elektrische Nutzfahrzeuge, das Berliner Lade-Startup Jucr und das Pflege-Startup Kenbi. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass selbst innovative Geschäftsmodelle nicht vor den Herausforderungen der Kapitalbeschaffung gefeit sind. Die deutsche Startup-Szene erlebt eine massive Pleitewelle, die selbst Vorzeigeunternehmen nicht verschont, trotz erheblicher Investitionen in den vergangenen Jahren.
Das Geschäftsklima innerhalb der sehr heterogenen Startup-Branche ist so mies wie seit der Pandemie nicht mehr. Fast die Hälfte aller Startups verwendet inzwischen Künstliche Intelligenz im Zentrum ihrer Produkte, was zeigt, dass technologische Innovation allein nicht ausreicht. Die Finanzierung konzentriert sich zunehmend auf wenige Bereiche, insbesondere Rüstung und KI, während kapitalintensive Hardware-Unternehmen Schwierigkeiten haben, Investoren zu finden. Diese Entwicklung birgt erhebliche Risiken für Deutschlands industrielle Basis.
Deutschland war historisch stark in der Entwicklung und Produktion physischer Produkte, von Maschinen über Fahrzeuge bis zu Präzisionsinstrumenten. Diese Kompetenz droht verloren zu gehen, wenn Hardware-Startups systematisch scheitern und Investoren sich auf rein digitale Geschäftsmodelle konzentrieren. Die Roboterdichte in der deutschen Industrie mag hoch sein, doch die Roboter stammen zunehmend von ausländischen Herstellern. Wenn europäische Technologieführer wie German Bionic scheitern, öffnet dies ausländischen Wettbewerbern die Tür. Der globale Exoskelettmarkt wird nicht verschwinden, nur weil ein europäischer Anbieter ausfällt. Die Nachfrage bleibt bestehen, und andere Unternehmen, möglicherweise aus den USA oder Asien, werden die Lücke füllen.
Dies hat weitreichende Konsequenzen für die technologische Souveränität Europas. Die Europäische Union hat die Hightech Agenda Deutschland beschlossen, um das Land zum führenden Standort für neue Technologien zu machen. Die Bundesregierung richtet die Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik neu aus, mit dem Ziel, mehr Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität zu erreichen. Doch wenn vielversprechende Unternehmen in der kritischen Wachstumsphase scheitern, bleibt diese Strategie Stückwerk. Die Fokussierung auf sechs Schlüsseltechnologien – Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität – ist richtig, doch die Umsetzung krankt an der Finanzierungslücke.
Handlungsoptionen und Reformperspektiven: Was getan werden muss
Um zukünftige Fälle wie German Bionic zu verhindern, bedarf es struktureller Reformen im deutschen und europäischen Innovationsökosystem. Erstens muss die Scale-up-Finanzierungslücke geschlossen werden. Die Europäische Kommission plant einen Scale-up-Europe-Fonds, der als Teil des Fonds des Europäischen Innovationsrates in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor eingerichtet werden soll und die Finanzierungslücke von technologieintensiven Scale-ups schließen soll. Dieser Fonds sollte im Jahr 2026 an den Start gehen. Entscheidend wird sein, dass er tatsächlich Wachstumskapital in ausreichender Höhe und mit ausreichender Geduld bereitstellt.
Zweitens müssen öffentliche Investoren in der Lage sein, antizyklisch zu investieren. Wenn private Investoren in schwierigen Phasen aussteigen, sollten öffentliche Fonds einspringen können, um vielversprechende Unternehmen über Durststrecken hinwegzuhelfen. Dies erfordert entsprechende Mandate und Risikobudgets. Die Europäische Investitionsbank verfügt prinzipiell über die finanziellen Mittel, doch ihre Risikobereitschaft ist begrenzt. Eine Aufstockung der EU-Haushaltsgarantien im Rahmen von InvestEU könnte die Risikokapazität erhöhen.
Drittens bedarf es einer besseren Koordinierung zwischen verschiedenen Förderinstrumenten. German Bionic erhielt Unterstützung vom Wachstumsfonds Bayern, der Europäischen Investitionsbank und privaten Investoren. Doch offenbar gelang es nicht, eine kohärente Finanzierungsstrategie über mehrere Runden hinweg zu entwickeln. Ein strukturiertes Programm, das Unternehmen von der Seed-Phase bis zum Exit begleitet, mit definierten Meilensteinen und verlässlicher Anschlussfinanzierung, könnte die Erfolgsquote erhöhen.
Viertens sollte die öffentliche Beschaffung stärker als Instrument zur Unterstützung innovativer Unternehmen genutzt werden. Exoskelette könnten in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder kommunalen Bauhöfen eingesetzt werden. Verlässliche öffentliche Aufträge würden planbare Umsätze generieren und privaten Kunden signalisieren, dass die Technologie ausgereift ist. Die USA nutzen öffentliche Beschaffung systematisch zur Förderung von Startups, insbesondere im Verteidigungsbereich. Europa könnte ähnliche Mechanismen entwickeln.
Fünftens muss die Unternehmenskultur in Deutschland innovationsfreundlicher werden. Die hohe Risikoaversion, sowohl bei Investoren als auch bei Kunden, hemmt die Diffusion neuer Technologien. Exoskelette mögen technisch ausgereift sein, doch solange Unternehmen zögern, sie einzuführen, bleibt der Markt begrenzt. Hier könnten steuerliche Anreize, Abschreibungsmöglichkeiten oder Zuschüsse die Investitionsbereitschaft erhöhen. Auch kulturelle Faktoren spielen eine Rolle: In den USA gilt das Scheitern eines Startups als Lernchance, in Deutschland oft als persönliches Versagen. Diese Haltung muss sich ändern, wenn Deutschland Innovationen fördern will.
Ein vermeidbares Scheitern mit Symbolkraft
Die Insolvenz von German Bionic ist mehr als das Scheitern eines einzelnen Unternehmens. Sie ist ein Symptom für tieferliegende strukturelle Defizite im europäischen Innovationssystem. Ein technologisch exzellentes Unternehmen mit relevantem Produkt, namhaften Investoren, öffentlicher Förderung und positiver Umsatzentwicklung scheiterte, weil in der entscheidenden Phase die finale Finanzierungsrunde platzte. Dies offenbart, dass das Zusammenspiel zwischen privaten Investoren, öffentlichen Förderern und dem Markt nicht funktioniert. Die Scale-up-Finanzierungslücke, das Fehlen geduldigen Kapitals und die geringe Risikobereitschaft deutscher Investoren bilden eine toxische Mischung, die vielversprechende Unternehmen in die Insolvenz treibt.
Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sprechen für einen florierenden Markt für Exoskelette. Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel in körperlich anspruchsvollen Berufen und die steigenden Gesundheitskosten durch Muskel-Skelett-Erkrankungen schaffen einen strukturellen Bedarf. Die Roboterdichte in Deutschland steigt kontinuierlich, und die Automatisierung schreitet voran. Doch wenn deutsche Unternehmen diese Märkte nicht bedienen können, weil ihnen das Kapital ausgeht, werden ausländische Wettbewerber die Lücke füllen. Die technologische Souveränität Europas erodiert schleichend, Unternehmen für Unternehmen.
Die Lehren aus German Bionic sind eindeutig: Technologische Exzellenz allein reicht nicht. Es bedarf eines kohärenten Finanzierungsökosystems, das Unternehmen von der Idee bis zur Profitabilität begleitet. Öffentliche Förderung muss strategischer eingesetzt werden, mit längeren Zeithorizonten und größerer Risikobereitschaft. Private Investoren müssen geduldiger werden und akzeptieren, dass Hardware-Startups andere Entwicklungszyklen haben als Software-Unternehmen. Und Kunden müssen bereit sein, innovative Technologien frühzeitig zu adaptieren, um Unternehmen die Skalierung zu ermöglichen.
Ob German Bionic eine zweite Chance erhält, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der vorläufige Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Sanierung möglich ist oder ob das Unternehmen zerschlagen werden muss. Im besten Fall findet sich ein Investor, der die Vision der Gründer weiterführt und das Unternehmen zur Profitabilität führt. Im schlechtesten Fall wandern Patente und Know-how ins Ausland, und 70 hochqualifizierte Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Unabhängig vom Ausgang bleibt die Insolvenz von German Bionic ein Mahnmal für die Fragilität des deutschen Innovationsökosystems und die dringende Notwendigkeit struktureller Reformen. Die nächste Generation von Deeptech-Startups wird genau beobachten, was aus German Bionic wird und ob Europa in der Lage ist, seine Innovatoren zu schützen oder ob diese besser beraten wären, direkt im Silicon Valley oder in Shenzhen zu gründen.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier: