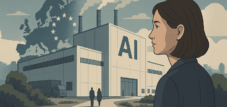Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Krise: Organisationale Ambidextrie als strategischer Ausweg
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 28. Oktober 2025 / Update vom: 28. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Krise: Organisationale Ambidextrie als strategischer Ausweg – Bild: Xpert.Digital
Das strukturelle Dilemma der europäischen Wirtschaft
Wie die Fähigkeit zur “Beidhändigkeit” zwischen Innovation und Effizienz den europäischen Mittelstand vor dem Bedeutungsverlust bewahren kann
Europa steht vor einer existenziellen wirtschaftlichen Herausforderung, die weit über konjunkturelle Schwankungen hinausgeht. Die Arbeitsproduktivität der Europäischen Union liegt heute bei weniger als 80 Prozent des US-Niveaus, eine Schere, die sich seit den 1990er-Jahren kontinuierlich geöffnet hat. Die Diagnose ist eindeutig und wurde im September 2024 durch den von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Draghi-Bericht eindrucksvoll dokumentiert: Europa steckt in der sogenannten Midtech-Falle. Während in den USA 85 Prozent der privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Hightech-Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und digitale Plattformen fließen, konzentriert Europa je etwa 45 Prozent seiner Innovationsausgaben auf Midtech- und Hightech-Industrien. Die statische Industriestruktur, in der die Automobilindustrie noch immer die Ranglisten der größten Forschungsbudgets dominiert, steht sinnbildlich für diese Erstarrung.
Die Zahlen sind ernüchternd: Nur vier der 50 größten Technologieunternehmen der Welt stammen aus der Europäischen Union. Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der EU liegen bei 2,2 bis 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, weit entfernt vom selbst gesetzten Dreiprozent-Ziel und deutlich unter den 3,4 Prozent der Vereinigten Staaten. Besonders gravierend ist die Lücke bei privaten Forschungsinvestitionen: Europäische Unternehmen investieren lediglich 1,5 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung, nur die Hälfte dessen, was ihre amerikanischen Wettbewerber aufwenden.
Diese strukturellen Defizite manifestieren sich in einem Teufelskreis niedriger Dynamik: Geringe private Investitionen führen zu weniger technologischen Durchbrüchen, was das Produktivitätswachstum dämpft. Das schwache Produktivitätswachstum begrenzt wiederum Einkommenszuwächse und fiskalischen Spielraum, sodass Mittel für zusätzliche Investitionen in Bildung, Forschung oder Digitalisierung fehlen. Der Rückstand bei der Digitalisierung verschärft dieses Problem zusätzlich: In Deutschland und Europa führt der Digitalisierungsstau direkt zu Produktivitätsdefiziten und verhindert die Verbreitung neuer Technologien. Eine Studie des ifo Instituts kalkuliert, dass allein die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung Deutschlands auf europäisches Spitzenniveau das deutsche BIP um etwa 96 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen könnte.
Die deutsche Wirtschaft, als Europas größte Volkswirtschaft besonders symptomatisch, kämpft mit massiven Digitalisierungsproblemen. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie haben 58 Prozent der deutschen Unternehmen Schwierigkeiten, die Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen. Die Unternehmen selbst bewerten ihren Digitalisierungsstand mit der Schulnote 3,0, also lediglich als befriedigend. Die Haupthindernisse sind vielfältig: Anforderungen an den Datenschutz, Fachkräftemangel, fehlende Zeit und finanzielle Mittel sowie überbordende Bürokratie dominieren die Problemlandschaft.
Dieser alarmierende Befund wird durch die Empfehlungen des Draghi-Berichts unterstrichen, der einen jährlichen Investitionsbedarf von 750 bis 800 Milliarden Euro identifiziert, was bis zu fünf Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Zum Vergleich: Die zusätzlichen Investitionen durch den Marshallplan zwischen 1948 und 1951 beliefen sich auf etwa ein bis zwei Prozent des BIP jährlich. Die geforderten Investitionen übersteigen somit selbst dieses historische Wiederaufbauprogramm bei weitem.
Passend dazu:
- Wenn Erneuerung auf Widerstand trifft: Das strukturelle Dilemma der organisationalen Ambidextrie | Xpert Business
Die historische Entwicklung des europäischen Innovationsdefizits
Die Wurzeln der gegenwärtigen Krise reichen tief in die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zurück. In den 1990er-Jahren begann sich die Schere zwischen europäischer und amerikanischer Produktivitätsentwicklung zu öffnen, eine Divergenz, die primär auf unterschiedliche Investitionsmuster in neue Technologien zurückzuführen ist. Während die Vereinigten Staaten massiv in Informations- und Kommunikationstechnologien investierten und eine dynamische Start-up-Kultur etablierten, die Unternehmen wie Microsoft, Apple, Amazon und später Google und Facebook hervorbrachte, blieb Europa weitgehend in traditionellen Industriestrukturen verhaftet.
Die europäische Innovationspolitik konzentrierte sich historisch auf die Unterstützung etablierter Industrien, insbesondere der Automobilbranche und ähnlicher Sektoren. Diese Pfadabhängigkeit erwies sich zunehmend als Hemmschuh, da die digitale Revolution die Wertschöpfungsarchitektur fundamental veränderte. Die Fragmentierung des europäischen Binnenmarktes, die durch unterschiedliche nationale Verbraucherschutzstandards, Mehrwertsteuersätze, Kennzeichnungsvorgaben und Lizenzierungsvorgaben gekennzeichnet ist, schränkte zudem die Geschäftsmöglichkeiten europäischer Exportunternehmen erheblich ein. 60 Prozent der europäischen Exportunternehmen und 74 Prozent der Unternehmen mit Spitzeninnovationen geben an, dass die Marktfragmentierung innerhalb der EU ihre Geschäftsmöglichkeiten einschränkt.
Die finanzielle Integration Europas ist nach wie vor geringer als auf ihrem Höhepunkt vor der Finanzkrise 2008, was die Mobilisierung von umfangreichen und risikoreicheren Finanzierungen für Innovationen erheblich erschwert. Größere, besser integrierte Kapitalmärkte wären entscheidend, um die erheblichen europäischen Ersparnisse effizient in Wachstum und Innovation zu lenken. Die unvollendete Kapitalmarktunion bleibt eine zentrale strukturelle Schwäche.
Parallel dazu entwickelte sich in Europa eine regulatorische Kultur, die zunehmend als innovationshemmend wahrgenommen wird. Die Bürokratiebelastung und die Komplexität von Genehmigungsverfahren führten dazu, dass sich neue Technologien langsamer verbreiteten als in anderen Wirtschaftsräumen. Die Datenschutz-Grundverordnung, obwohl aus Sicht des Verbraucherschutzes wegweisend, wird von vielen Unternehmen als eines der größten Digitalisierungshindernisse genannt.
Die Corona-Pandemie ab 2020 fungierte als Katalysator, der die digitalen Defizite europäischer Unternehmen schonungslos offenlegte. Unternehmen mit fortgeschrittener digitaler Transformation zeigten eine erhöhte Resilienz und konnten teilweise sogar Wachstum verzeichnen, während digital rückständige Firmen massiv unter den Lockdowns litten. Diese Krisenerfahrung verdeutlichte, dass Digitalisierung keine Option, sondern eine Überlebensfrage darstellt.
Das theoretische Fundament: Organisationale Ambidextrie als Managementkonzept
In diesem Kontext struktureller Schwäche und drohender Marginalisierung gewinnt ein Managementkonzept zentrale Bedeutung, das bereits seit den 1990er-Jahren in der Organisationsforschung diskutiert wird: die organisationale Ambidextrie. Der Begriff, der wörtlich Beidhändigkeit bedeutet, wurde 1976 von Robert Duncan in den organisationalen Kontext eingeführt und beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, gleichzeitig sowohl sein derzeitiges Kerngeschäft auszuschöpfen als auch neue Räume zu erschließen.
Die theoretische Grundlage bildet die Unterscheidung zwischen Exploitation und Exploration, die der Managementforscher James March 1991 in seiner wegweisenden Arbeit zur organisationalen Lernfähigkeit formulierte. Exploitation bezeichnet die Ausschöpfung und Optimierung bestehender Fähigkeiten, Prozesse und Geschäftsmodelle. Unternehmen verfeinern ihre Produktionsprozesse, steigern Effizienz, reduzieren Kosten und maximieren die Rendite ihrer etablierten Angebote. Diese Aktivitäten liefern verlässliche, vorhersehbare und kurzfristig profitable Ergebnisse. Exploration hingegen umfasst die Suche nach neuen Möglichkeiten, das Experimentieren mit innovativen Ansätzen und die Entwicklung völlig neuer Geschäftsfelder. Diese Aktivitäten sind riskant, unsicher und liefern erst langfristig Erträge, wenn überhaupt.
Das fundamentale Problem liegt in der inhärenten Asymmetrie zwischen beiden Ansätzen. Exploitation generiert schnelle, messbare Erfolge, während Exploration zunächst Ressourcen verbraucht ohne garantierte Gegenleistung. Adaptive Managementsysteme, die auf kurzfristige Erfolge optimiert sind, verstärken systematisch die Exploitation auf Kosten der Exploration. Budgetierungsprozesse bevorzugen Projekte mit kalkulierbarem Return on Investment. Führungskräfte werden für Quartalsergebnisse belohnt, nicht für langfristige Weichenstellungen. Teams konzentrieren sich auf das, was funktioniert, statt auf das, was funktionieren könnte. Diese selbstverstärkende Dynamik führt zu einem schleichenden Verlust der Innovationsfähigkeit, der erst sichtbar wird, wenn es bereits zu spät ist.
Die Harvard-Professoren Michael Tushman und Charles O’Reilly entwickelten das Konzept der organisationalen Ambidextrie systematisch weiter und identifizierten drei grundlegende Umsetzungsformen. Die strukturelle Ambidextrie sieht die Schaffung getrennter Organisationseinheiten für Exploration und Exploitation vor. Das Unternehmen etabliert separate Bereiche mit unterschiedlichen Strukturen, Prozessen, Kulturen und Führungssystemen, die jedoch gezielt integriert werden, um Synergien zu nutzen. Die kontextuelle Ambidextrie ermöglicht, dass Mitarbeiter und Teams je nach Situation und Aufgabenstellung zwischen explorativen und exploitativen Modi wechseln, wobei die organisationalen Rahmenbedingungen entsprechende Freiräume schaffen. Die sequentielle oder zeitliche Ambidextrie beschreibt den Wechsel zwischen Phasen der Exploration und Exploitation, etwa bei Restrukturierungen oder Produktlebenszyklen.
Die Forschung von O’Reilly und Tushman, die über zwei Jahrzehnte 15 Unternehmen untersuchten, die versuchten, ihre organisationale Ambidextrie auszubauen, kam zu eindeutigen Ergebnissen: Vor allem diejenigen Unternehmen waren erfolgreich, deren Führungsebene eine klare Vision und gemeinsame Identität entwickelte, in der Exploitation und Exploration gleichwertige Rollen spielten. Die Fähigkeit des Führungsteams, mit den Spannungen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft umzugehen, erwies sich als entscheidender Erfolgsfaktor. In 90 Prozent der Fälle braucht es eine neue Geschäftsleitung, um ambidextre Konzepte erfolgreich umzusetzen, da die meisten alteingesessenen Führungskräfte nicht in der Lage sind, die Spannungen im Team zu managen.
Ein weiterer zentraler Befund der Forschung betrifft die Bedeutung der Unternehmensidentität. Die Identität der Firma ist noch wesentlicher als ihre Strategie, betont Tushman im Interview. Eine übergreifende Identität, die beide widersprüchlichen Modi zusammenhält, ermöglicht es, dass unterschiedliche und innerlich widersprüchliche Kulturen als Teile ein und derselben Sinnhaftigkeit bestehen können. Diese gemeinsame Identität fungiert als emotionaler Anker und Nordstern, der die Organisation durch die Spannungen der Ambidextrie navigiert.
Die empirische Evidenz: Erfolg und Scheitern in der Praxis
Die praktische Umsetzung organisationaler Ambidextrie zeigt ein differenziertes Bild aus spektakulären Erfolgen und dramatischen Misserfolgen. Die Erfolgsgeschichten illustrieren eindrucksvoll, welches Potenzial in der systematischen Verbindung von Exploitation und Exploration liegt.
Das Paradebeispiel für kontextuelle Ambidextrie ist der amerikanische Konzern 3M, der bereits 1948 die sogenannte 15-Prozent-Regel einführte. Diese ermutigt Mitarbeiter, 15 Prozent ihrer Arbeitszeit der Weiterentwicklung und Verfolgung innovativer Ideen zu widmen, die sie besonders spannend finden. In Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, kreativ zu denken und den Status quo infrage zu stellen. Dank dieser Regel konnten zahlreiche Innovationen geschaffen werden, darunter die optische Mehrschichtfolie, Cubitron-Schleifkörner, Emphaze AEX Hybrid-Aufbereiter sowie die weltberühmten Post-it-Notes. Das Unternehmen will ein Drittel seines Umsatzes stets mit Neuerfindungen aus den jeweils vergangenen fünf Jahren erwirtschaften und sitzt auf mehr als 25.000 Patenten. Die 15-Prozent-Regel hat sich als Erfolgsrezept für den Nachschub an Ideen bewährt und verbindet geschickt Exploration mit dem effizienten Betrieb des Kerngeschäfts.
Google adaptierte dieses Modell mit seiner 20-Prozent-Zeit, die Mitarbeitern erlaubte, einen Tag pro Woche an eigenen Projekten zu arbeiten. Aus dieser Initiative entstanden einige der erfolgreichsten Google-Produkte: Gmail, das E-Mail-System, das heute weltweit genutzt wird, Google News, der Nachrichtenaggregator, sowie AdSense, das Werbeprogramm, das heute etwa ein Viertel zum gesamten Umsatz beiträgt. Die 20-Prozent-Zeit ermöglichte es Google, kreativer und innovativer zu sein und gleichzeitig das hochprofitable Kerngeschäft der Suchmaschine und Werbeanzeigen zu optimieren. Allerdings zeigt das spätere teilweise Zurückfahren dieses Programms auch die Herausforderungen: Unter CEO Larry Page wurde die strategische Ausrichtung stärker auf wenige erfolgsversprechende Projekte fokussiert, was die freie Projektarbeit einschränkte.
Ein Beispiel für erfolgreiche strukturelle Ambidextrie im Medienbereich ist USA Today unter CEO Tom Curley im Jahr 2000. Curley arbeitete am Ausbau des traditionellen Zeitungsgeschäfts, während er parallel eine tragfähige Organisation für USA Today.com als Online-Newsportal aufbaute. Nach anfänglichen Schwierigkeiten lernte Curley, wie er sein Führungsteam zu besetzen hatte und wie er dieses dazu bringen konnte, sowohl die Printversion der Zeitung als auch die Onlineplattform wertzuschätzen. Die Trennung der Bereiche war wichtig, ebenso wie die gezielte Integration über ein Team, das beides konnte.
Die Harvard Business School bietet ein aktuelles Beispiel für strukturelle Ambidextrie im Bildungsbereich. Der Dekan baut weiter an einer Business School, die in der Vergangenheit verwurzelt ist und zu der Studierende und Dozenten wie jeher an den Campus kommen, um im direkten persönlichen Kontakt zu lernen und zu lehren. Zugleich entwickelt er eine digitale Komponente namens HBX, bei der zukünftige Studierende womöglich nie an den Campus kommen und die Lehrinhalte digital aufbereitet werden. Das Bestreben, Führungskräfte auszubilden, die einen Unterschied in der Welt machen, fungiert als übergreifende Identität, die beide Modi zusammenhält.
Den Erfolgsgeschichten stehen dramatische Misserfolge gegenüber, die die Gefahren mangelnder Ambidextrie illustrieren. Kodak ist zum Synonym für das Scheitern etablierter Unternehmen an technologischen Umbrüchen geworden. Die Ironie liegt darin, dass Kodak 1975 die erste Digitalkamera erfand, die Technologie aber aus Angst vor Kannibalisierung des lukrativen Filmgeschäfts nicht weiterverfolgte. In den 1990er-Jahren investierte CEO George Fisher mehr als zwei Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung für digitale Bildgebung und erwarb 2001 die Foto-Sharing-Website Ofoto. Trotz dieser umfangreichen Investitionen und dem frühen Erkennen des digitalen Wandels scheiterte Kodak letztlich und meldete 2012 Insolvenz an. Die Forschung zeigt, dass Kodaks Scheitern nicht primär auf Trägheit, sondern auf die Schwierigkeit zurückzuführen war, bei hohen Aspirationen und Unsicherheit bezüglich der neuen Technologie sowie einer Illusion der Resilienz des Filmgeschäfts die richtige Balance zu finden. Die häufigen CEO-Wechsel und disparaten Strategien verhinderten, dass Kodak eine kohärente ambidextre Organisation aufbauen konnte.
Nokia und Blackberry erlitten ähnliche Schicksale im Smartphone-Markt. Nokia, zeitweise mit 40 Prozent Marktanteil weltweiter Marktführer, verpasste den Übergang zum Touchscreen-Smartphone und fiel auf unter drei Prozent Marktanteil. Die Forschung zeigt, dass Nokia 2007 bewusst entschied, den neuen Konkurrenten iPhone zu ignorieren und mit dem gewohnten Geschäftsmodell fortzufahren. Blackberry, mit seinem auf Unternehmenskunden fokussierten Geschäftsmodell und der charakteristischen QWERTY-Tastatur, zögerte, sich auf Touchscreen-Technologie und Verbraucheranforderungen einzustellen. Von 85 Millionen Abonnenten auf dem Höhepunkt schrumpfte die Nutzerbasis auf weniger als 25 Millionen. Beide Unternehmen scheiterten daran, Exploration und Exploitation gleichzeitig zu betreiben und ihre Geschäftsmodelle rechtzeitig zu transformieren.
Ein instruktives Beispiel für das politische Scheitern ambidextrer Strategien ist der Fall des französischen Werbekonzerns Havas. Der CEO verfolgte eine proaktive ambidextre Strategie, indem er sowohl traditionelle Werbeanzeigen schalten als auch das Publikum beim Aufbau von Kampagnen mit einbinden wollte. Er wollte Werbung sowohl intern gestalten als auch extern mit dem Publikum, der Crowd, kreieren. Der CEO trennte den neuen Unternehmensbereich strukturell vom traditionellen Unternehmen und stieß verschiedene Formen der gezielten Integration an. Die Strategie und die Struktur waren konzeptionell überzeugend, aber die Einflussnehmer im traditionellen Unternehmenszweig blockierten die Vorhaben des CEO politisch. Die Unfähigkeit des Führungsteams, mit den Spannungen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft umzugehen, führte zum Scheitern des ambidextren Entwurfs.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Warum viele europäische Firmen Digitalisierung zur Kostenfrage machen — nicht zur Zukunftsstrategie
Die Gegenwart: Europäische Unternehmen zwischen Effizienzfalle und Innovationsdruck
Die aktuelle Situation europäischer Unternehmen ist durch ein fundamentales Spannungsfeld gekennzeichnet. Einerseits erfordern globaler Wettbewerbsdruck, schrumpfende Margen und konjunkturelle Unsicherheiten eine konsequente Fokussierung auf Effizienz und Kostenoptimierung im Kerngeschäft. Andererseits zwingt die rasante technologische Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und nachhaltige Technologien, zur kontinuierlichen Exploration neuer Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle.
Die empirischen Daten zeigen, dass europäische Unternehmen diese Balance nur unzureichend meistern. Laut der DIHK-Digitalisierungsumfrage 2023 bewerten Unternehmen ihren Digitalisierungsgrad mit der Schulnote 3,0, was auf mittelmäßige Fortschritte hindeutet. Die Hauptmotive für Digitalisierungsbestrebungen sind flexibles Arbeiten, Qualitätsverbesserung und Kosteneinsparungen, deutlich seltener jedoch die Förderung von Innovationen oder die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Dies deutet auf eine Dominanz der Exploitation gegenüber der Exploration hin.
Für 69 Prozent der mittelständischen Unternehmen ist Geschäftswachstum die wichtigste Motivation für Digitalisierungsmaßnahmen. Unternehmen, die ihre digitale Transformation beschleunigen konnten, haben während der Pandemie eine erhöhte Resilienz gezeigt und konnten teilweise sogar Wachstum verzeichnen. Wer bei der digitalen Transformation zu den Early Adopters gehört, hat eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, seine Geschäftsziele zu erreichen. Diese Befunde unterstreichen die Bedeutung explorativer Aktivitäten für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Gleichzeitig verdeutlichen die Hindernisse die Schwierigkeit der Umsetzung. Zu den größten Herausforderungen zählen der Mangel an Zeit, die hohe Komplexität der digitalen Transformation sowie rechtliche Unsicherheiten, die eine effektive Datennutzung behindern. 58 Prozent der Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen. Die Ressourcenkonkurrenz zwischen Kerngeschäft und Innovationsprojekten, erhöhter Koordinations- und Kommunikationsaufwand sowie hohe Anforderungen an Führungskompetenzen und Change Management stellen zentrale Barrieren dar.
Eine spezifische Herausforderung für europäische Unternehmen ist die fragmentierte Marktstruktur. 60 Prozent der europäischen Exportunternehmen und 74 Prozent der Unternehmen mit Spitzeninnovationen geben an, dass die Marktfragmentierung innerhalb der EU aufgrund unterschiedlicher nationaler Standards ihre Geschäftsmöglichkeiten einschränkt. Dies erschwert die Skalierung explorativer Geschäftsmodelle erheblich. Europäische Unternehmen können den europäischen Binnenmarkt nicht voll nutzen, um die notwendige Größe zu erreichen, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Automobilindustrie illustriert das Dilemma exemplarisch. Für Führungskräfte besteht die Problemstellung, sich gleichzeitig mit dem klassischen, fahrergesteuerten Wagen mit Verbrennungsmotor und dem autonom gesteuerten Auto ohne Motor zu befassen. Die europäische Automobilindustrie trägt sieben Prozent zum BIP der EU bei, erwirtschaftet etwa 170 Milliarden Euro Exporte und beschäftigt rund 13,8 Millionen Menschen. Doch der Übergang zur Elektromobilität und zu softwaredefinierten Fahrzeugen stellt eine existenzielle Transformation dar. McKinsey schätzt, dass im disruptivsten Szenario 440 Milliarden Euro BIP, etwa ein Drittel der Industrie, bis 2035 gefährdet sind. Die Investitionen europäischer Automobilhersteller konzentrieren sich weiterhin stark auf traditionelle Technologien, während nicht-europäische Akteure bei Batterietechnologie, Softwareintegration und autonomem Fahren vorpreschen.
Mittelständische Unternehmen und KMU stehen vor spezifischen Herausforderungen bei der Umsetzung von Ambidextrie. Mit 2,5 Millionen mittelständischen Unternehmen, die rund 42 Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland verantworten, ist dieser Sektor von zentraler Bedeutung. Die Forschung zu Ambidextrie in österreichischen KMU zeigt, dass viele primär auf Effizienz fokussieren, während Innovationsaktivitäten vernachlässigt werden. Eine Studie zu europäischen KMU ergab, dass alle aus dem Ausland stammenden KMU kontextuelle Ambidextrie verwenden, während deutsche KMU eher zu struktureller Ambidextrie tendieren. Dies deutet darauf hin, dass KMU mit kleinerer Unternehmensgröße und Belegschaftszahl keine separate Unternehmenseinheit mit Innovationslabor ausgründen können.
Passend dazu:
- Ambidextrie und Exploration Marketing | Marketing am Wendepunkt: Wie Sie Optimierung und Innovation endlich vereinen (Beta)
Komparative Analyse: Unterschiedliche Wege zur ambidextren Organisation
Die vergleichende Analyse verschiedener Länder, Regionen und Unternehmenstypen offenbart unterschiedliche Strategien und Erfolgsmuster bei der Umsetzung organisationaler Ambidextrie. Diese Unterschiede sind nicht nur technisch-organisatorischer Natur, sondern wurzeln tief in kulturellen, institutionellen und wirtschaftsstrukturellen Besonderheiten.
Die Vereinigten Staaten haben eine ausgeprägte Kultur der strukturellen Ambidextrie entwickelt, die auf einem robusten Ökosystem aus Venture Capital, Risikokapital und einer ausgeprägten Gründerkultur basiert. Große Technologieunternehmen wie Google, Amazon und Microsoft trennen systematisch explorative von exploitativen Einheiten. Google etablierte nicht nur die 20-Prozent-Zeit, sondern gründete auch die Holding Alphabet, die es ermöglicht, hochspekulative Projekte wie Waymo für autonomes Fahren oder Verily für Gesundheitstechnologie strukturell vom Kerngeschäft der Suchmaschine und Werbung zu separieren. Microsoft unter CEO Satya Nadella transformierte die Unternehmenskultur grundlegend, indem es explorative Cloud-Dienste wie Azure parallel zum exploitativen Windows- und Office-Geschäft entwickelte. Die kulturelle Akzeptanz von Misserfolgen, das Motto fail well bei Google, ermöglicht risikoreichere explorative Vorstöße.
China verfolgt einen staatlich gelenkten Ansatz zur Förderung von Ambidextrie, der durch massive öffentliche Investitionen in Zukunftstechnologien und eine enge Verzahnung von staatlichen und privaten Akteuren gekennzeichnet ist. Chinesische Unternehmen investieren aggressiv in Hightech-Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Biotechnologie, während sie gleichzeitig bestehende Geschäftsmodelle mit hoher Effizienz ausbauen. Die chinesische Regierung unterstützt diese Dualität durch industriepolitische Programme, die sowohl die Skalierung etablierter Industrien als auch die Entwicklung disruptiver Technologien fördern.
Deutschland und Mitteleuropa zeigen ein gemischtes Bild. Deutsche Großunternehmen wie Siemens versuchen, ambidextre Strukturen zu etablieren, indem sie dedizierte Einheiten für transformative Innovation schaffen. Siemens Digital Industries hat separate Geschäftseinheiten für zukunftsorientierte Innovation etabliert, die darauf abzielen, Bereiche mit hohem Potenzial zu identifizieren und zu erkunden. Die Herausforderung der Ambidextrie, das Gleichgewicht zwischen der Optimierung des Kerngeschäfts und der Exploration neuer Geschäftsfelder, wird als eine der größten Aufgaben angesehen. Dennoch zeigen die Investitionsmuster, dass deutsche Unternehmen weiterhin stark auf Midtech-Bereiche wie die Automobilindustrie fokussiert bleiben, während in Hightech-Sektoren wie Software und digitale Plattformen zu wenig investiert wird.
Der deutsche Mittelstand, traditionell als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet, kämpft mit der Umsetzung von Ambidextrie aufgrund begrenzter Ressourcen. Mittelständische Unternehmen tendieren zur kontextuellen Ambidextrie, bei der Mitarbeiter je nach Situation zwischen Exploitation und Exploration wechseln, da sie nicht die Mittel haben, separate strukturelle Einheiten aufzubauen. Eine Fallstudie eines deutschen Mittelständlers im Dienstleistungsbereich zeigt, wie durch die Installation eines Think-Tanks zur Ideengenerierung, die Gründung einer Task-Force für strategisches Innovationsmanagement mit weitreichenden Sonderrechten und New-Work-Möglichkeiten sowie die Aufteilung in drei Hauptbereiche, IT-Solutions, Kerngeschäftsnahe Erweiterung und Nachhaltigkeit, organisationale Ambidextrie erfolgreich implementiert werden konnte. Das Ergebnis war ein kompletter Mindset-Change im gesamten Unternehmen sowie eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 11 Prozentpunkte und eine Verlängerung der durchschnittlichen Vertragslaufzeit um drei Monate.
Skandinavische Länder zeichnen sich durch eine ausgeprägte Kultur der kontextuellen Ambidextrie aus, die auf flachen Hierarchien, hoher Mitarbeiterbeteiligung und einer starken Weiterbildungskultur basiert. Die nordischen Unternehmen integrieren explorative Aktivitäten stärker in die reguläre Arbeitsorganisation, anstatt separate Strukturen zu schaffen. Dies wird durch hohe Investitionen in lebenslanges Lernen und eine Kultur des Vertrauens und der Eigenverantwortung ermöglicht.
Ostasiatische Unternehmen, insbesondere aus Japan und Südkorea, verfolgen häufig eine Form der zeitlichen Ambidextrie, bei der Phasen intensiver Optimierung und Effizienzsteigerung mit Phasen strategischer Neuausrichtung und Exploration abwechseln. Toyota ist ein Beispiel für diese Herangehensweise, mit seiner Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Kaizen-Philosophie für Exploitation sowie strategischen Initiativen wie der Entwicklung der Prius-Hybridtechnologie für Exploration.
Die vergleichende Analyse offenbart, dass erfolgreiche ambidextre Organisationen unabhängig von der gewählten Form bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen: eine klare, inspirierende Vision und Identität, die beide Modi zusammenhält; ein Führungsteam, das fähig ist, mit Widersprüchen und Paradoxien umzugehen; ausreichende Ressourcen für explorative Aktivitäten; Mechanismen zur gezielten Integration zwischen Exploitation und Exploration; sowie eine Kultur, die sowohl Effizienz als auch Risikobereitschaft und Experimentierfreude wertschätzt.
Kritische Betrachtung: Grenzen, Risiken und ungelöste Spannungen
Bei aller Attraktivität des Konzepts der organisationalen Ambidextrie darf die kritische Reflexion über Grenzen, Risiken und strukturelle Widersprüche nicht fehlen. Die Umsetzung ambidextrer Strukturen ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden, die in der wissenschaftlichen Diskussion und praktischen Anwendung teilweise unterschätzt werden.
Ein fundamentales Problem liegt in der Ressourcenkonkurrenz zwischen Exploitation und Exploration. Beide Aktivitäten konkurrieren um dieselben begrenzten Ressourcen: Budget, Führungsaufmerksamkeit, Talente und Zeit. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder bei kurzfristigem Erfolgsdruck tendieren Organisationen systematisch dazu, Ressourcen vom explorativen in den exploitativen Bereich umzuschichten, da letzterer schnellere und sicherere Erträge verspricht. Diese Tendenz wird durch bestehende Anreizsysteme verstärkt, die typischerweise kurzfristige finanzielle Kennzahlen belohnen. Die strukturelle Asymmetrie zwischen den schnellen, messbaren Erfolgen der Exploitation und den unsicheren, langfristigen Erträgen der Exploration führt zu einer systematischen Benachteiligung explorativer Aktivitäten.
Die Forderung nach struktureller Trennung von Exploitation und Exploration kann zudem zu organisatorischer Fragmentierung, Silo-Denken und Koordinationsproblemen führen. Die explorative Einheit entwickelt möglicherweise eine Kultur und Arbeitsweise, die so stark vom Kerngeschäft abweicht, dass eine spätere Integration neuer Produkte oder Geschäftsmodelle in die Gesamtorganisation scheitert. Das Beispiel des gescheiterten SAP-Projekts für KMU illustriert dieses Problem: Die in das Kerngeschäft integrierten crossfunktionalen Teams wurden den Gesetzmäßigkeiten, Ansprüchen und Kulturprägungen des Kerngeschäfts unterworfen. Die Unit wurde als Ablenkung und Konkurrenz zum bestehenden Geschäftsmodell gesehen, Gestaltungsfreiheit und Ressourcen-Ausstattung waren entsprechend gering, und das Vorhaben scheiterte.
Ein weiteres kritisches Problem betrifft die politischen Dynamiken innerhalb von Organisationen. Die Etablierung ambidextrer Strukturen verändert bestehende Machtstrukturen und bedroht etablierte Interessengruppen. Das Scheitern des Havas-Projekts zeigt exemplarisch, wie traditionelle Einflussnehmer ambidextre Vorhaben politisch blockieren können, selbst wenn Strategie und Struktur konzeptionell überzeugend sind. In 90 Prozent der Fälle braucht es eine neue Geschäftsleitung, um ambidextre Konzepte umzusetzen, da alteingesessene Führungskräfte nicht in der Lage sind, die Spannungen im Team zu managen. Dies impliziert massive Transitionskosten und potenzielle Kontinuitätsbrüche.
Die Forderung nach einer übergreifenden Identität, die beide Modi zusammenhält, mag konzeptionell elegant erscheinen, ist in der Praxis jedoch häufig schwer umzusetzen. Identitätsbildung ist ein langwieriger, fragiler Prozess, der nicht einfach durch Managementdekrete herbeigeführt werden kann. Zudem können zu abstrakte oder allgemeine Identitätsformulierungen wie keeping plants healthy bei Ciba zwar integrativ wirken, bieten aber möglicherweise zu wenigkonkrete Orientierung für operative Entscheidungen.
Kleine und mittlere Unternehmen stehen vor spezifischen Problemen bei der Umsetzung von Ambidextrie. Die strukturelle Variante ist aufgrund begrenzter Ressourcen oft nicht realisierbar. Die kontextuelle Ambidextrie erfordert jedoch ein außergewöhnlich hohes Maß an Flexibilität und Kompetenz von Führungskräften und Mitarbeitern, die situativ zwischen völlig unterschiedlichen Modi wechseln müssen. Dies überfordert viele Organisationen. Die zeitliche Ambidextrie birgt das Risiko, dass Unternehmen entweder zu lange in der Exploitationsphase verharren und disruptive Entwicklungen verpassen oder zu früh in die Explorationsphase wechseln und bestehende Erträge gefährden.
Ein strukturelles Problem betrifft die Messung und Bewertung ambidextrer Leistungen. Während exploitative Aktivitäten durch konventionelle Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Produktivität und Marktanteil gut erfassbar sind, entziehen sich explorative Aktivitäten weitgehend dieser Messbarkeit. Wie bewertet man den Erfolg explorativer Projekte, die möglicherweise erst in fünf oder zehn Jahren Früchte tragen oder auch scheitern können? Die Unsicherheit und Langfristigkeit explorativer Erträge macht eine rationale Ressourcenallokation zwischen beiden Modi schwierig.
Kritisch zu hinterfragen ist auch die normative Prämisse, dass alle Unternehmen gleichzeitig explorieren und exploitieren müssen. Möglicherweise gibt es Kontexte, in denen eine temporäre Fokussierung sinnvoller ist. Start-ups etwa sind naturgemäß explorationsdominiert und müssen erst lernen, zu exploitieren, wenn sie skalieren. Reife Unternehmen in stabilen Märkten könnten unter Umständen gut beraten sein, sich primär auf Effizienz zu konzentrieren und Exploration durch Akquisitionen, Partnerschaften oder Investitionen in Start-ups externalisieren.
Schließlich stellt sich die Frage, ob das Konzept der organisationalen Ambidextrie nicht teilweise eine idealisierte Beschreibung dessen ist, was erfolgreiche Unternehmen ohnehin tun, ohne dass daraus notwendigerweise präskriptive Handlungsempfehlungen für andere Organisationen ableitbar wären. Die Kausalität zwischen Ambidextrie und Unternehmenserfolg ist nicht eindeutig: Möglicherweise sind erfolgreiche Unternehmen ambidexter, weil sie erfolgreich sind und deshalb die Ressourcen für Exploration haben, nicht umgekehrt.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Aufbruch oder Niedergang: Wie Ambidextrie Europas Zukunft entscheidet
Perspektiven und Szenarien: Europas Zukunft zwischen Aufbruch und Niedergang
Die zukünftige Entwicklung der europäischen Wirtschaft wird maßgeblich davon abhängen, ob und wie es gelingt, die organisationale Ambidextrie auf breiter Front zu implementieren. Dabei lassen sich verschiedene Szenarien skizzieren, die von fundamentalen Annahmen über politische Entscheidungen, Unternehmensstrategien und technologische Entwicklungen abhängen.
Das optimistische Szenario, das als Europäischer Aufbruch bezeichnet werden kann, geht davon aus, dass die Empfehlungen des Draghi-Berichts weitgehend umgesetzt werden. Die EU investiert jährlich 750 bis 800 Milliarden Euro in Innovation, Digitalisierung und die ökologische Wende. Die Kapitalmarktunion wird vollendet, sodass europäische Ersparnisse effizient in risikoreichere, innovative Unternehmen gelenkt werden. Der Binnenmarkt wird vertieft, Fragmentierungen werden abgebaut, und regulatorische Hürden für innovative Unternehmen werden systematisch reduziert. In diesem Szenario etablieren europäische Unternehmen auf breiter Front ambidextre Strukturen: Großunternehmen schaffen dedizierte Innovationseinheiten mit Sonderrechten und hoher Autonomie, die durch gezielte Integrationsmechanismen mit dem Kerngeschäft verbunden sind. Der Mittelstand nutzt digitale Plattformen, Partnerschaften und Allianzen, um trotz begrenzter Ressourcen explorative Aktivitäten zu verfolgen. Die Automobilindustrie gelingt die Transformation zur Elektromobilität und zu softwaredefinierten Fahrzeugen, wobei europäische Hersteller ihre traditionellen Stärken in Engineering und Qualität mit neuen digitalen Kompetenzen verbinden. Bis 2035 ist Europa in Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Quantencomputing und Biotechnologie wieder wettbewerbsfähig. Die Arbeitsproduktivität nähert sich dem US-Niveau an, und Europa etabliert sich als führende Region für nachhaltige Technologien und Circular Economy. Dieses Szenario setzt allerdings voraus, dass tiefgreifende strukturelle Reformen gelingen, politischer Wille nachhaltig erhalten bleibt und Unternehmen bereit sind, kurzfristige Renditen zugunsten langfristiger Transformationen zu opfern.
Das pessimistische Szenario, der Europäische Niedergang, geht davon aus, dass die notwendigen Reformen an nationalen Egoismen, politischem Kleinmut und widerstreitenden Interessen scheitern. Die Investitionslücke bleibt bestehen oder vergrößert sich sogar. Europäische Unternehmen bleiben in der Midtech-Falle gefangen und konzentrieren ihre Investitionen weiterhin auf schrumpfende oder stagnierende Branchen wie die konventionelle Automobilindustrie. Die Fragmentierung des Binnenmarktes verschärft sich durch Renationalisierungstendenzen. Bürokratie und regulatorische Unsicherheit hemmen weiterhin Innovationen. In diesem Szenario scheitern die meisten Versuche, organisationale Ambidextrie zu etablieren, an Ressourcenmangel, politischen Widerständen innerhalb der Organisationen und mangelnder Führungskompetenz. Die europäische Automobilindustrie verliert massiv an Bedeutung, da asiatische und amerikanische Wettbewerber bei Elektromobilität, autonomem Fahren und digitalen Diensten dominieren. Die 440 Milliarden Euro BIP, die McKinsey für gefährdet hält, gehen verloren. Europa entwickelt sich zu einem wirtschaftlichen Museum, das zwar kulturell reich, aber ökonomisch marginalisiert ist. Das Produktivitätswachstum bleibt schwach, der Lebensstandard stagniert oder sinkt, und die geopolitische Bedeutung Europas schwindet. Junge Talente emigrieren in die USA oder nach Asien, wo dynamischere Innovationsökosysteme bessere Karrierechancen bieten.
Das mittlere Szenario, Europas Fragmentierung, geht von einer heterogenen Entwicklung aus. Einige Regionen und Länder, insbesondere in Nordeuropa, gelingt es, ambidextre Strukturen erfolgreich zu etablieren und in Zukunftstechnologien wettbewerbsfähig zu bleiben. Skandinavische Länder, die Niederlande und eventuell Deutschland schaffen es, ihre Innovationssysteme zu reformieren und Großunternehmen wie Siemens, SAP und einige Automobilhersteller transformieren sich erfolgreich. Andere Regionen, insbesondere in Südeuropa, bleiben zurück und sind durch strukturelle Probleme, mangelnde Investitionen und politische Instabilität gekennzeichnet. Die europäische Integration schwächt sich ab, da die Unterschiede in Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu groß werden. Der Binnenmarkt fragmentiert weiter, und unterschiedliche Regulierungssysteme erschweren grenzüberschreitende Geschäfte. Europa entwickelt sich zu einem Flickenteppich aus innovativen Inseln und stagnierenden Regionen, ohne kohärente gemeinsame Strategie.
Ein Disruptionsszenario, das als Technologischer Schock bezeichnet werden kann, würde eintreten, wenn fundamentale technologische Durchbrüche, etwa in der Künstlichen Intelligenz, Quantencomputing oder Biotechnologie, die Wettbewerbslandschaft radikal verändern. Sollten diese Durchbrüche primär außerhalb Europas stattfinden und europäische Unternehmen unfähig sein, schnell zu adaptieren, könnte dies zu einem rapiden Bedeutungsverlust führen. Umgekehrt könnte Europa, wenn es gelingt, bei nachhaltigen Technologien, Wasserstoffwirtschaft oder Circular Economy weltweit führend zu werden, einen neuen komparativen Vorteil etablieren, der die strukturellen Defizite in anderen Bereichen kompensiert.
Die wahrscheinlichste Entwicklung liegt vermutlich zwischen dem mittleren und dem optimistischen Szenario. Die Warnungen des Draghi-Berichts und die zunehmende Wahrnehmung der Wettbewerbskrise haben zu einem gewissen politischen Mobilisierungseffekt geführt. Die EU-Kommission hat mit dem Competitiveness Compass einen strategischen Rahmen vorgelegt, der auf Innovation, Dekarbonisierung und Reduktion von Abhängigkeiten fokussiert. Konkrete Maßnahmen wie der Clean Industrial Deal, die Start-up- und Scale-up-Strategie sowie Initiativen wie AI Continent und Apply AI zeigen, dass die EU ihre Innovationslücke ernst nimmt. Die Frage ist, ob die Umsetzung schnell und konsequent genug erfolgt. Die europäische Geschichte zeigt, dass der Kontinent in Krisenmomenten durchaus zu tiefgreifenden Reformen fähig ist, diese aber häufig zeitverzögert und nach langen Verhandlungen erfolgen. Die Zeit arbeitet jedoch gegen Europa: Jedes weitere Jahr, in dem die Investitionslücke fortbesteht, vergrößert den Rückstand zu den USA und China.
Passend dazu:
- Innovationslabore oder Intrapreneurship: Neuentwicklungen in einen firmengebundenen Startup auslagern – weitere Möglichkeiten?
Strategische Konsequenzen: Handlungsimperative für Politik, Unternehmen und Gesellschaft
Die Analyse der organisationalen Ambidextrie als Lösungsansatz für die Wettbewerbskrise europäischer Unternehmen führt zu konkreten strategischen Implikationen für verschiedene Akteursgruppen.
Für politische Entscheidungsträger ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag. Die Vollendung der Kapitalmarktunion muss höchste Priorität erhalten, um die erheblichen europäischen Ersparnisse effizient in Wachstum und Innovation zu lenken. Die Fragmentierung des Binnenmarktes muss durch Harmonisierung von Standards, Abbau bürokratischer Hürden und Vereinfachung von Regulierungen überwunden werden. Massive öffentliche und private Investitionen in Forschung und Entwicklung sind erforderlich, wobei der Fokus stärker auf Hightech-Bereiche und Sprunginnovationen gerichtet werden muss. Die Förderung von Unternehmensgründungen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Risikokapital sind zentral, um ein dynamischeres Innovationsökosystem zu schaffen. Bildungspolitik muss kontinuierliche Weiterbildung und die Entwicklung digitaler Kompetenzen in den Mittelpunkt stellen, um Qualifikationsdefizite zu überwinden. Industriepolitische Maßnahmen sollten gezielt Schlüsseltechnologien wie Halbleiter, Künstliche Intelligenz und nachhaltige Technologien fördern, ohne in protektionistischen Dirigismus zu verfallen. Die Balance zwischen notwendiger Regulierung für Verbraucherschutz und Datenschutz einerseits und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen andererseits muss neu justiert werden.
Für Unternehmenslenker, insbesondere in etablierten Großunternehmen, ist die Botschaft eindeutig: Ambidextrie ist keine Option, sondern eine Überlebensbedingung. Die strukturelle Trennung von Exploitation und Exploration mit gezielter Integration muss konsequent umgesetzt werden. Dies erfordert den Aufbau dedizierter Innovationseinheiten mit ausreichender Autonomie, eigenem Budget und Schutz vor der Dominanz des Kerngeschäfts. Gleichzeitig müssen Mechanismen der gezielten Integration etabliert werden, um Synergien zu nutzen und einen Transfer erfolgreicher explorativer Projekte in die Gesamtorganisation zu ermöglichen. Die Entwicklung einer übergreifenden Unternehmensidentität, die beide Modi zusammenhält und legitimiert, ist zentral. Führungsteams müssen in der Fähigkeit geschult werden, mit Widersprüchen und Paradoxien umzugehen. In vielen Fällen wird dies einen partiellen oder vollständigen Austausch der Führungsmannschaft erfordern. Anreizsysteme müssen so gestaltet werden, dass sie sowohl kurzfristige exploitative Erfolge als auch langfristige explorative Wertschöpfung belohnen. Die Kultur muss sowohl Effizienz und Disziplin als auch Risikobereitschaft, Experimentierfreude und Fehlertoleranz wertschätzen. Partnerschaften, Joint Ventures und Kooperationen können helfen, Zugang zu neuen Technologien und Märkten zu erlangen, ohne alle Kompetenzen intern aufbauen zu müssen.
Für mittelständische Unternehmen ergeben sich spezifische Handlungsempfehlungen. Da strukturelle Ambidextrie aufgrund begrenzter Ressourcen oft nicht realisierbar ist, sollte der Fokus auf kontextueller Ambidextrie oder auf strategischen Partnerschaften liegen. Die gezielte Schaffung von Freiräumen für Mitarbeiter, nach dem Vorbild der 15-Prozent-Regel von 3M oder der 20-Prozent-Zeit von Google, ermöglicht explorative Aktivitäten ohne massive strukturelle Umbauten. Die Teilnahme an Innovationsnetzwerken, Clustern und Plattformen kann Zugang zu Technologien, Wissen und Partnern schaffen. Digitalisierung sollte nicht primär als Kostensenkungsprogramm, sondern als Enabler für neue Geschäftsmodelle verstanden werden. Die systematische Weiterbildung der Belegschaft in digitalen Kompetenzen und agilen Arbeitsmethoden ist entscheidend. Investitionen in Forschung und Entwicklung sollten trotz kurzfristiger Ergebnisdrucks aufrechterhalten oder sogar erhöht werden.
Für Investoren und Kapitalgeber ergibt sich die Notwendigkeit, langfristigere Perspektiven einzunehmen und explorative Investitionen zu unterstützen, auch wenn diese kurzfristig keine Erträge liefern. Die Entwicklung von Bewertungsmetriken, die ambidextre Fähigkeiten von Unternehmen erfassen, könnte helfen, zukunftsfähige von rückwärtsgewandten Organisationen zu unterscheiden. Venture Capital und Private Equity sollten verstärkt in europäische Innovationsprojekte fließen, was wiederum attraktive Rahmenbedingungen und eine leistungsfähige Exit-Infrastruktur erfordert.
Für Bildungseinrichtungen bedeutet dies, dass Curricula stärker auf die Entwicklung von Ambidextrie-Kompetenzen ausgerichtet werden müssen. Führungskräfte müssen lernen, mit Widersprüchen umzugehen, unterschiedliche Kulturen zu managen und strategische Paradoxien produktiv zu nutzen. Die Integration von Design Thinking, agilem Management und traditionellen Managementdisziplinen in der Ausbildung ist erforderlich.
Für die Gesellschaft insgesamt ergibt sich die Herausforderung, einen Kulturwandel zu vollziehen, der sowohl Leistung und Effizienz als auch Innovation und Risikobereitschaft wertschätzt. Eine Kultur, die Scheitern ausschließlich negativ konnotiert, wird die für Exploration notwendige Experimentierfreude ersticken. Das Silicon-Valley-Motto fail fast, fail often muss nicht eins zu eins übernommen werden, aber eine konstruktivere Fehlerkultur wäre förderlich.
Die zentrale Erkenntnis lautet: Organisationale Ambidextrie ist kein Patentrezept, das einfach übernommen werden kann, sondern ein anspruchsvolles, kontextabhängiges Managementkonzept, dessen erfolgreiche Umsetzung fundamentale Veränderungen in Führung, Kultur, Struktur und Anreizsystemen erfordert. Die europäischen Unternehmen und die Politik stehen vor der Wahl: Entweder gelingt die Transformation zur ambidextren Organisation auf breiter Front, oder Europa wird im globalen Innovationswettlauf weiter zurückfallen und seine wirtschaftliche Bedeutung sukzessive verlieren. Die Entscheidung, die in den kommenden Jahren getroffen wird, wird die Zukunft des Kontinents für Jahrzehnte prägen. Die Uhr tickt, denn jedes Jahr, das ohne entschlossenes Handeln verstreicht, vergrößert den Rückstand zu den dynamischeren Wirtschaftsräumen in Nordamerika und Asien. Die organisationale Ambidextrie bietet einen vielversprechenden konzeptionellen Rahmen für diese Transformation, aber ihr Erfolg hängt von der konsequenten Umsetzung durch mutige Führungskräfte, weitsichtige Politiker und eine aufgeschlossene Gesellschaft ab.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten