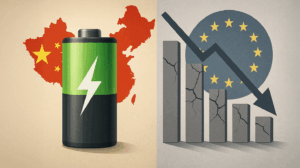Europas verpasste Rohstoffwende: Wie systematisches Politikversagen die Energiewende gefährdet
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 24. November 2025 / Update vom: 24. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Europas verpasste Rohstoffwende: Wie systematisches Politikversagen die Energiewende gefährdet – Bild: Xpert.Digital
Die systematische Unterschätzung geopolitischer Risiken zugunsten kurzfristiger Kostenoptimierung
Schlimmer als die Gas-Krise: Warum Europas neue Abhängigkeit existenzbedrohend ist
### Der ungenutzte Schatz im Norden: Warum Europa seine gigantischen Rohstoff-Vorkommen ignoriert ### Milliarden-Fonds ohne Wirkung: Die Chronologie eines staatlichen Totalversagens bei der Rohstoffwende ### Recycling-Anlagen stehen still: Das absurde Scheitern der deutschen Rohstoff-Strategie ###
Es wirkt wie ein fatales Déjà-vu der Geschichte, doch die Dimensionen sind weitaus bedrohlicher: Während Europa noch immer mit den Nachwehen der russischen Energiekrise kämpft, steuert der Kontinent sehenden Auges in die nächste, noch gravierendere Abhängigkeitsfalle.
Die Energiewende, das Herzstück der europäischen Zukunftsstrategie, hängt am seidenen Faden – und das eine Ende dieses Fadens hält China fest in der Hand. Ob Elektroautos, Windkraftanlagen oder moderne Waffensysteme: Ohne Seltene Erden steht die moderne Industrie still. Doch während Peking seit Jahrzehnten Fakten schafft, Marktanteile von über 90 Prozent bei der Magnetproduktion sichert und Preise als geopolitische Waffe einsetzt, verharrt Europa in einer gefährlichen Mischung aus Naivität und Bürokratie.
Die vorliegende Analyse deckt die anatomischen Schwachstellen einer verfehlten Industriepolitik auf. Sie zeigt, warum riesige Vorkommen in Skandinavien ungenutzt im Boden schlummern, wieso hochmoderne Recycling-Anlagen in Sachsen-Anhalt stillstehen müssen und weshalb staatliche Milliardenfonds bislang ins Leere laufen. Es ist die Geschichte eines angekündigten Systemversagens, bei dem kurzfristige Kostenoptimierung über langfristige Sicherheit gestellt wurde – mit dem Risiko, dass die europäische Rohstoffwende scheitert, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.
Passend dazu:
- Die Warnung eines Rohstoffhändlers: Wie die Kontrolle über Seltene Erden Europas Industrie in die Knie zwingt
Wenn politische Kurzfristigkeit auf geopolitische Realitäten trifft
Deutschland und Europa verfügen über erhebliche Vorkommen an Seltenen Erden, doch anstatt diese strategischen Ressourcen zu erschließen, verharrt die Politik seit mehr als einem Jahrzehnt in einer Abwartehaltung, die zunehmend existenzbedrohende Züge annimmt. Die kritische Abhängigkeit von chinesischen Rohstofflieferungen hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, das die russische Gasabhängigkeit bei weitem übertrifft. Diese Analyse beleuchtet die ökonomischen Mechanismen, strukturellen Versäumnisse und geopolitischen Fehleinschätzungen, die Europa in diese prekäre Lage gebracht haben.
Die Dimension des Problems lässt sich an konkreten Zahlen ablesen. Deutschland importierte im Jahr 2024 etwa 5200 Tonnen Seltene Erden, wovon 65,5 Prozent direkt aus China stammten. Bei einigen Elementen liegt die Abhängigkeit noch deutlich höher: Lanthanverbindungen, die unter anderem für Akkus benötigt werden, kamen 2024 zu 76,3 Prozent aus der Volksrepublik. Diese Zahlen offenbaren nur die Spitze des Eisbergs, denn sie erfassen lediglich die direkten Importe. Berücksichtigt man, dass China etwa 87 bis 92 Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazitäten kontrolliert und 90 Prozent der globalen Magnetproduktion beherrscht, wird das wahre Ausmaß der Abhängigkeit sichtbar. Selbst Seltene Erden, die formal aus Österreich oder Estland importiert werden, sind häufig chinesischen Ursprungs und wurden lediglich in Europa weiterverarbeitet.
Die ökonomische Anatomie einer strategischen Fehlentscheidung
Die Entwicklung dieser Abhängigkeit folgt einem Muster, das sich in der Wirtschaftsgeschichte wiederholt: die systematische Unterschätzung geopolitischer Risiken zugunsten kurzfristiger Kostenoptimierung. Nach 2010, als China erstmals seine Exportquoten für Seltene Erden drastisch reduzierte und damit Japan politisch unter Druck setzte, erlebten die Weltmärkte eine heftige Preisexplosion. Die Preise für Neodym und Dysprosium vervielfachten sich damals innerhalb weniger Monate. Diese Krise hätte als Weckruf dienen müssen. Tatsächlich führte sie zu einem kurzen Aufflackern explorativer Aktivitäten: Weltweit suchten Unternehmen nach alternativen Lagerstätten, und die Bundesregierung verabschiedete 2010 ihre erste Rohstoffstrategie. Doch als die Preise 2012 wieder sanken, ebbte das Interesse ebenso schnell ab wie es gekommen war.
Diese Volatilität ist kein Zufall, sondern ein bewusst genutztes Instrument chinesischer Wirtschaftspolitik. China kann durch staatliche Subventionen und strategische Reserven die globalen Preise für Seltene Erden manipulieren. Sinken die Preise, werden alternative Projekte außerhalb Chinas unwirtschaftlich und müssen aufgegeben werden. Steigen die Preise, profitiert China von seinen gesicherten Marktanteilen. Dieser Mechanismus funktioniert besonders effektiv, weil die Erschließung neuer Minen extrem kapitalintensiv ist und zwischen zehn und fünfzehn Jahren dauert. Kein privates Unternehmen kann solche Investitionszyklen ohne staatliche Absicherung gegen Preisschwankungen von bis zu tausend Prozent durchhalten.
Die ökonomische Logik hinter Chinas Dominanz erschließt sich aus mehreren Faktoren. Erstens begann die Volksrepublik bereits in den 1950er Jahren mit der Entwicklung von Verfahren zur Rückgewinnung von Seltenen Erden als Nebenprodukt beim Eisenerzabbau. Der legendäre Ausspruch Deng Xiaopings aus dem Jahr 1987, der Nahe Osten habe Öl, China habe Seltene Erden, markiert den Beginn einer konsequenten strategischen Ausrichtung. Zweitens ermöglichten minimale Umwelt- und Sozialstandards extrem niedrige Produktionskosten. Die Region um Bayan Obo an der Grenze zur Mongolei, die weltgrößte Mine für Seltene Erden, gehört heute zu den am stärksten verschmutzten Orten der Welt. Hochgiftige Säuren versickern direkt im Boden, radioaktives Thorium und Uran werden freigesetzt, und riesige Absetzbecken mit toxischem Klärschlamm vergiften Grundwasser und Flüsse. Die sozialen und ökologischen Kosten werden externalisiert, während China die ökonomischen Vorteile internalisiert.
Drittens sicherte sich China systematisch die Patente für Abbau- und Weiterverarbeitungstechnologien. Heute verfügt die Volksrepublik nicht nur über die Rohstoffe, sondern auch über das technologische Know-how, das für die gesamte Wertschöpfungskette unerlässlich ist. Diese vertikale Integration schafft Abhängigkeiten, die weit über den reinen Rohstoffbezug hinausgehen. Selbst wenn Europa eigene Minen erschließen würde, bliebe es zunächst auf chinesische Verarbeitungstechnologien angewiesen.
Passend dazu:
- China und das Neijuan der systematischen Überinvestitionen: Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle
Europas schlummernde Schätze: Potenzial ohne Perspektive
Die Ironie der Situation liegt darin, dass Europa keineswegs rohstoffarm ist. Die geologischen Voraussetzungen für eine teilweise Selbstversorgung sind durchaus gegeben, doch sie werden nicht genutzt. Das eklatanteste Beispiel ist die Lagerstätte bei Kiruna im Norden Schwedens. Das staatliche Bergbauunternehmen LKAB schätzt die Vorkommen auf mehr als zwei Millionen Tonnen Seltenerdoxide, manche Geologen gehen sogar von über drei Millionen Tonnen aus. Dies wäre das mit Abstand größte Vorkommen in Europa und könnte theoretisch bis zu 18 Prozent des jährlichen EU-Bedarfs decken. Die Lagerstätte ist zudem bereits gut erschlossen, da LKAB dort seit Jahrzehnten Eisenerz abbaut. Dennoch wird LKAB nach eigenen Angaben frühestens in acht bis zehn Jahren mit dem kommerziellen Abbau beginnen. Zunächst muss 2026 eine Testanlage in Betrieb gehen, die das Verfahren zur Förderung erprobt. Dann folgen langwierige Genehmigungsverfahren, der Bau von Aufbereitungsanlagen und die Klärung von Umweltauswirkungen. Die Seltenen Erden bleiben für LKAB ein Nebenprodukt, das durch die Eisenerzförderung querfinanziert wird.
Ähnlich gelagert ist die Situation in Norwegen, wo im Süden des Landes nach neuesten Schätzungen sogar das größte europäische Vorkommen liegen könnte. Das Unternehmen Rare Earths Norway spricht von Mengen, die das schwedische Vorkommen übertreffen. Doch auch hier befinden sich die Projekte in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Unter dem Meeresboden vor der norwegischen Küste werden zudem weitere große Mengen vermutet, darunter bis zu 38 Millionen Tonnen Kupfer und 1,7 Millionen Tonnen Cer. Die Förderung unter dem Meeresboden ist jedoch technisch extrem anspruchsvoll, ökologisch hochproblematisch und wirtschaftlich ungewiss.
Selbst in Deutschland existieren relevante Vorkommen. Die Lagerstätte Storkwitz bei Delitzsch in Sachsen wurde bereits in den 1970er Jahren von DDR-Geologen entdeckt, als diese nach Uran suchten. Damals schätzte man die möglichen Mengen auf bis zu 136.000 Tonnen Seltene Erden. Neuere Untersuchungen kamen zu konservativeren Schätzungen von etwa 20.000 bis 40.000 Tonnen an Seltenerdverbindungen. 2012 begannen neue Probebohrungen, um das Vorkommen nach internationalen Standards zu bewerten. Doch die Ergebnisse waren ernüchternd: Die Konzentration der Seltenen Erden liegt mit etwa 0,48 Prozent zu niedrig, und die Lagerstätte erstreckt sich über mehrere hundert Meter in die Tiefe, was den Abbau extrem aufwendig macht. 2017 erklärten die beteiligten Unternehmen das Projekt für unwirtschaftlich und gaben die Abbaurechte zurück. Storkwitz bleibt ein Symbol für das deutsche Dilemma: Die Rohstoffe sind vorhanden, aber unter den aktuellen Marktbedingungen nicht rentabel zu fördern.
Passend dazu:
Der Teufelskreis der Marktverzerrung
Hier offenbart sich das Kernproblem: Der Markt für Seltene Erden ist fundamental dysfunktional. Die Preise sind nicht nur extrem volatil, sie spiegeln auch nicht die tatsächlichen strategischen Werte dieser Rohstoffe wider. China kann durch Subventionen, Exportbeschränkungen und Marktmanipulation jederzeit Projekte außerhalb seiner Grenzen unrentabel machen. Ein privates Unternehmen, das in eine Mine in Europa investiert, trägt ein enormes wirtschaftliches Risiko. Die Vorlaufkosten sind immens, die Amortisationszeiten lang, und während der gesamten Projektlaufzeit besteht die Gefahr, dass China die Preise so weit drückt, dass sich der Betrieb nicht mehr lohnt.
Genau diese Dynamik verhindert systematisch den Aufbau europäischer Kapazitäten. Es handelt sich um ein klassisches Marktversagen, bei dem die strategischen externen Effekte der Rohstoffabhängigkeit nicht in die Preise einkalkuliert werden. Die Kosten einer unterbrochenen Versorgung, die Risiken geopolitischer Erpressung, die Auswirkungen auf industrielle Wertschöpfungsketten – all dies findet in den aktuellen Marktpreisen keine Berücksichtigung. Ökonomen würden von einem Koordinationsproblem sprechen: Jeder einzelne Akteur handelt individuell rational, wenn er die günstigsten chinesischen Rohstoffe kauft, aber kollektiv führt dieses Verhalten zu einer suboptimalen Situation, in der ganze Industriezweige verwundbar werden.
Die chinesischen Exportbeschränkungen, die im April 2025 verhängt wurden und sieben wichtige Seltene Erden betrafen, haben diese Problematik schlagartig sichtbar gemacht. Plötzlich explodierten die Preise: Neodym verteuerte sich innerhalb weniger Monate um etwa 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Dysprosium um fast 30 Prozent. Bei einigen schweren Seltenen Erden, die besonders knapp sind, verdoppelten sich die Preise teilweise. Deutsche Automobilhersteller und Zulieferer schlugen Alarm. Branchenvertreter warnten, dass die Lagerbestände in vier bis sechs Wochen aufgebraucht sein könnten und dann Produktionsstopps drohen würden. Die Automobilindustrie benötigt Seltene Erden für Permanentmagnete in Elektromotoren, für Sensoren, für Katalysatoren und zahlreiche weitere Komponenten. Ein durchschnittlicher Elektromotor enthält etwa 600 Gramm Neodym, hinzu kommen weitere Seltene Erden wie Dysprosium für die Temperaturbeständigkeit der Magnete.
Zwar lenkte China im Oktober 2025 im Rahmen einer handelspolitischen Entspannung mit den USA ein und setzte einige Exportkontrollen für ein Jahr aus. Doch Experten betrachten dies lediglich als taktische Verschnaufpause. Die grundsätzliche Bereitschaft Chinas, Rohstoffe als geopolitisches Druckmittel einzusetzen, bleibt bestehen. Dies ist keine theoretische Gefahr, sondern bewährte Praxis: Bereits 2010 nutzte China Exportbeschränkungen im territorialen Streit mit Japan, und auch in den aktuellen Handelskonflikten mit den USA dienen Seltene Erden als strategische Waffe.
Passend dazu:
Recycling als brachliegende Alternative
Angesichts dieser prekären Versorgungslage erscheint Recycling als naheliegender Ausweg. Tatsächlich stecken in Europa erhebliche Mengen an Seltenen Erden in ausgedienten Produkten: alte Festplatten, ausgemusterte Windkraftanlagen, defekte Elektromotoren, stillgelegte MRT-Geräte. Die EU hat mit dem Critical Raw Materials Act das Ziel ausgegeben, bis 2030 mindestens 25 Prozent des Bedarfs an strategischen Rohstoffen durch Recycling zu decken. Technisch ist dies durchaus machbar, und einzelne Pionierunternehmen zeigen, dass es funktionieren kann.
Das Unternehmen Heraeus Remloy in Bitterfeld betreibt seit Mai 2024 Europas größte Recyclinganlage für Seltenerden-Magnete. Die Kapazität liegt bei 600 Tonnen pro Jahr und könnte mittelfristig auf 1200 Tonnen verdoppelt werden. Das entspräche fast zwei Prozent des europäischen Jahresbedarfs. Die Technologie ist ausgereift: Alte Magnete werden sortiert, eingeschmolzen und zu feinem Pulver verarbeitet, aus dem sich neue Magnetmaterialien mit der gleichen Qualität wie aus Primärrohstoffen herstellen lassen. Der Energieaufwand liegt um 80 Prozent niedriger als bei der Gewinnung aus Erzen, und die CO2-Bilanz ist entsprechend besser. Drei Jahre lang hat das Unternehmen dafür Altmagnete gesammelt, insgesamt 350 Tonnen. In den Lagerhallen von Bitterfeld stapeln sich die Fässer mit dem wertvollen Material.
Doch die Anlage steht viele Stunden am Tag still. Die Nachfrage ist zwar vorhanden, beinahe jeder Autohersteller hat Interesse bekundet. Aber die Abnehmer warten ab, bis ihre Lagerbestände an primären Rohstoffen aufgebraucht sind. Solange chinesische Seltene Erden verfügbar und vermeintlich günstig sind, besteht kein unmittelbarer Anreiz, auf recyceltes Material umzusteigen. Dies offenbart ein weiteres Paradox: Selbst bei funktionierenden Recyclingtechnologien fehlt es an verbindlichen Abnahmezusagen und Quoten. Der EU-Rechtsrahmen legt nicht fest, dass die recycelten Rohstoffe aus Europa stammen müssen. Tatsächlich wird auch Recycling zunehmend in Asien durchgeführt. Selbst europäische Unternehmen exportieren Altmaterial nach China, wo es aufbereitet und dann als recycelte Seltene Erden nach Europa zurückverkauft wird.
Die globale Recyclingquote für Seltene Erden liegt derzeit bei weniger als einem Prozent. Experten halten langfristig Quoten von 15 bis 50 Prozent für erreichbar, doch dies erfordert massive Investitionen, verbindliche regulatorische Vorgaben und eine systematische Sammlung von Altgeräten. Derzeit schlummern unzählige elektronische Geräte in Schubladen und Abstellräumen, weil es keine flächendeckenden Rücknahmesysteme gibt. Windkraftanlagen werden nach 20 bis 25 Jahren zurückgebaut, und ihre Magnete ließen sich verhältnismäßig gut recyceln. Doch eine systematische Erfassung und Verwertung dieser Ressourcen existiert bislang nicht.
Unternehmensvertreter fordern deshalb verbindliche Quoten. Magnete, die in der EU verkauft werden, müssten zu einem bestimmten Mindestanteil aus europäischem Recyclingmaterial bestehen. Dies würde die Planungssicherheit erhöhen, Investitionen in Recyclingkapazitäten rentabel machen und die strategische Unabhängigkeit stärken. Die Mehrkosten pro Fahrzeug oder Windkraftanlage wären minimal. Doch solche Vorgaben fehlen bislang.
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Vom Gasfiasko zu den Seltenen Erden – Wiederholt sich die Geschichte?
Politisches Versagen als Muster
Die Frage, warum Europa trotz wiederholter Warnungen und erkennbarer Risiken nicht entschieden gehandelt hat, lässt sich nicht monokausal beantworten. Es handelt sich um eine Kombination aus institutionellem Versagen, fehlgeleiteten Anreizstrukturen und grundlegenden Fehleinschätzungen über die Natur globaler Märkte.
Die deutsche Rohstoffstrategie von 2010 war primär darauf ausgerichtet, Handelshemmnisse abzubauen und deutschen Unternehmen den Zugang zu internationalen Rohstoffmärkten zu erleichtern. Nachhaltigkeitskriterien und strategische Eigenständigkeit spielten eine untergeordnete Rolle. Kritiker warfen der Strategie damals vor, sie diene in erster Linie der Interessenvertretung der Industrie und vernachlässige entwicklungspolitische, menschenrechtliche und ökologische Aspekte. Diese Kritik war berechtigt, aber sie übersah ein noch grundlegenderes Problem: Die Strategie beruhte auf der Annahme, dass offene Märkte und Freihandel automatisch zu sicheren Lieferketten führen. Diese Annahme erwies sich als fundamental falsch, sobald staatliche Akteure Rohstoffe als geopolitische Instrumente einsetzten.
Nach der Preiskrise von 2010 gab es durchaus Aktivitäten: Explorationsunternehmen wurden gegründet, Testbohrungen durchgeführt, Machbarkeitsstudien erstellt. Doch als die Preise wieder sanken, erlahmte das Interesse. Entscheidend ist, dass der Staat sich weitgehend zurückhielt. Anders als Japan, das sich nach 2010 mit staatlichen Mitteln an der Erschließung der Mount-Weld-Mine in Australien beteiligte und damit seinen Importanteil aus China von über 90 auf unter 60 Prozent senken konnte, vertraute Europa auf private Investoren und Marktkräfte. Diese Zurückhaltung erwies sich als strategischer Fehler.
Auch die USA reagierten nach den jüngsten Lieferengpässen entschlossen. Die Trump-Administration beteiligte sich direkt an Bergbauunternehmen, investierte Milliarden in Minen und Verarbeitungsanlagen in Australien und schloss strategische Partnerschaften mit Japan und Saudi-Arabien. Das US-Verteidigungsministerium finanziert Projekte zur Sicherung seltener Erden mit militärischer Relevanz. Diese unamerikanisch anmutende Industriepolitik zeigt, wie ernst die strategische Dimension inzwischen genommen wird.
Europa hingegen blieb lange bei symbolischen Maßnahmen. Der Critical Raw Materials Act von 2024 setzt zwar ambitionierte Ziele, aber die Umsetzung verläuft schleppend. Bis 2030 sollen zehn Prozent der strategischen Rohstoffe aus europäischem Bergbau stammen, 40 Prozent aus europäischer Verarbeitung und 25 Prozent aus Recycling. Zudem soll die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferland auf maximal 65 Prozent begrenzt werden. Doch diese Zielvorgaben sind unverbindlich, und konkrete Instrumente zu ihrer Durchsetzung fehlen weitgehend.
Im Herbst 2024 legte die Bundesregierung einen Rohstofffonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro auf. Über die staatliche Förderbank KfW sollen Rohstoffprojekte im In- und Ausland mit Eigenkapitalbeteiligungen zwischen 50 und 150 Millionen Euro unterstützt werden. Projekte müssen sich auf kritische Rohstoffe konzentrieren und zur Versorgung der deutschen und europäischen Wirtschaft beitragen. Fast 50 Unternehmen haben Anträge gestellt. Doch ein Jahr nach der Gründung des Fonds ist noch kein einziger Euro geflossen. Der interministerielle Ausschuss Rohstoffe, der die Entscheidungen treffen muss, hat bislang kein einziges Projekt genehmigt. Die Mittel des Fonds wurden zudem im Haushalt 2025 drastisch gekürzt: Die Risikoabsicherung sank von 272,9 Millionen Euro auf 98,7 Millionen Euro, ein Rückgang um fast 64 Prozent. Im November 2025 kündigte das Bundeswirtschaftsministerium an, sich an der Förderung Seltener Erden in Australien mit bis zu 100 Millionen Euro zu beteiligen. Doch ob und wann diese Mittel tatsächlich fließen, bleibt abzuwarten.
Wissenschaftler wie Jens Gutzmer, Direktor des Helmholtz-Instituts für Ressourcentechnologie, haben wiederholt darauf hingewiesen, dass bei dysfunktionalen Märkten der Staat nicht einfach zusehen kann. Notwendig seien feste Abnahmezusagen zu garantierten Preisen, ähnlich wie bei den Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien in den 2000er Jahren. Nur so könnten Minen und Recyclingunternehmen die Planungssicherheit erhalten, die für langfristige Investitionen erforderlich ist. Zudem müssten strategische Reserven aufgebaut werden, wie sie viele andere Nationen bereits besitzen. Deutschland verfügt über keine nennenswerten Lagerbestände an kritischen Rohstoffen. Im Krisenfall wären die Reserven innerhalb weniger Wochen erschöpft.
Passend dazu:
- Chinas Strategie offenbart das Versagen westlicher Wirtschaftspolitik am Beispiel der Batteriespeicher
Die Kosten der Abhängigkeit
Die ökonomischen und strategischen Kosten der Rohstoffabhängigkeit lassen sich kaum exakt beziffern, aber sie sind erheblich. Auf der unmittelbaren Ebene stehen Preisrisiken. Jede Verteuerung von Seltenen Erden verteuert Elektromotoren, Windkraftanlagen, Elektronikprodukte und zahlreiche weitere Güter. Die Preissteigerungen von 2025 werden sich in den kommenden Jahren in höheren Produktpreisen niederschlagen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen beeinträchtigen.
Gravierender sind jedoch die strategischen Risiken. Die Abhängigkeit schränkt den politischen Handlungsspielraum ein. Europa kann sich keine harten Sanktionen gegen China leisten, selbst wenn geopolitische Konflikte dies erfordern würden. Die Androhung von Lieferstopps genügt, um Europa zur Zurückhaltung zu zwingen. Dies betrifft nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch sicherheitspolitische Fragen. Seltene Erden sind unerlässlich für Waffensysteme, Radaranlagen, Präzisionsmunition, Kampfflugzeuge und Drohnen. Die NATO hat Ende 2024 eine Liste von zwölf verteidigungskritischen Rohstoffen veröffentlicht, darunter mehrere Seltene Erden. Im Konfliktfall wäre Europa auf chinesische Lieferungen angewiesen, um seine Rüstungsindustrie am Laufen zu halten. Diese Konstellation ist absurd und gefährlich zugleich.
Zudem drohen konkrete Produktionsausfälle. Im Frühjahr 2025 warnten Zulieferer und Autohersteller vor Engpässen. Das Unternehmen ZF Friedrichshafen erklärte, man sei in vielen Werken kurz vor dem Betriebsstillstand. Ohne die benötigten Magnete könnten keine Stoßdämpfer, keine Lenksysteme, keine Elektroantriebe produziert werden. Volkswagen, BMW und Mercedes bestätigten zwar, dass die Produktion derzeit noch laufe, aber die Lage sei angespannt. Die Automobilindustrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ein längerer Produktionsstopp hätte verheerende Folgen für Beschäftigung, Wertschöpfung und internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Auch die Energiewende ist unmittelbar betroffen. Offshore-Windkraftanlagen benötigen pro Megawatt Leistung etwa 500 bis 600 Kilogramm Permanentmagnete, die wiederum erhebliche Mengen an Neodym und Dysprosium enthalten. Ohne sichere Versorgung mit diesen Rohstoffen stockt der Ausbau der Windenergie. Im August 2025 legten das Bundeswirtschaftsministerium und die europäische Windindustrie eine Roadmap vor, die vorsieht, bis 2030 dreißig Prozent und bis 2035 die Hälfte der Permanentmagnete aus resilienten, also nicht-chinesischen Quellen zu beziehen. Doch diese Ziele sind ambitioniert, und konkrete Maßnahmen zu ihrer Umsetzung bleiben vage.
Ein Systemversagen mit Ansage
Die Situation, in der sich Europa befindet, ist kein schicksalhaftes Unglück, sondern das Ergebnis systematischer politischer Fehlentscheidungen. Es handelt sich um ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie kurzfristige Kostenminimierung langfristig zu existenziellen Abhängigkeiten führt. Die Parallelen zur Energiepolitik der 2000er und 2010er Jahre sind offensichtlich: Damals baute Deutschland seine Gasabhängigkeit von Russland massiv aus, weil russisches Gas billig und bequem verfügbar war. Die geopolitischen Risiken wurden systematisch unterschätzt oder ignoriert. Als 2022 Russland die Gaslieferungen kappte, stand Europa vor einer akuten Versorgungskrise, die nur durch enorme finanzielle Anstrengungen und glückliche Umstände abgewendet werden konnte.
Bei den Seltenen Erden wiederholt sich dieses Muster, nur dass die Abhängigkeit noch größer und die Alternativen noch knapper sind. Im Gegensatz zu Gas, das sich notfalls durch Flüssiggasimporte aus anderen Regionen ersetzen lässt, gibt es bei Seltenen Erden kaum kurzfristige Ausweichmöglichkeiten. Die wenigen Minen außerhalb Chinas decken nur einen Bruchteil der globalen Nachfrage, und neue Projekte benötigen Jahre bis zur Inbetriebnahme.
Die Verantwortung für diese Situation liegt nicht bei einzelnen Politikern oder Regierungen, sondern in systemischen Defiziten. Erstens fehlt es an einer langfristigen strategischen Planung, die über Legislaturperioden hinausreicht. Rohstoffpolitik ist per Definition langfristig, doch politische Entscheidungsprozesse sind kurzfristig orientiert. Zweitens dominiert ein naiver Glaube an die Selbstregulierungskraft von Märkten. Märkte funktionieren bei vielen Gütern gut, aber bei strategischen Rohstoffen versagen sie systematisch, weil externe Effekte und geopolitische Risiken nicht eingepreist werden. Drittens mangelt es an institutioneller Koordination. Rohstoffpolitik liegt in der Zuständigkeit mehrerer Ministerien, deren Interessen nicht immer deckungsgleich sind. Das Wirtschaftsministerium fokussiert auf Versorgungssicherheit, das Finanzministerium auf Haushaltskonsolidierung, das Umweltministerium auf Nachhaltigkeit, das Außenministerium auf diplomatische Beziehungen. Diese Fragmentierung führt zu Verzögerungen, Kompromissen und halbherzigen Lösungen.
Passend dazu:
- Taiwans Seltene-Erden-Unabhängigkeit: Strategische Neupositionierung in der globalen Rohstoffgeopolitik
Ansätze für eine Wende – noch ist es nicht zu spät
Trotz der düsteren Ausgangslage ist die Situation nicht aussichtslos. Europa verfügt über die technologischen, finanziellen und institutionellen Ressourcen, um seine Rohstoffversorgung auf eine stabilere Basis zu stellen. Doch dies erfordert einen fundamentalen Politikwechsel und die Bereitschaft, erhebliche Mittel in den Aufbau eigenständiger Kapazitäten zu investieren.
Erstens muss die Erschließung europäischer Lagerstätten mit staatlicher Unterstützung forciert werden. Die schwedischen, norwegischen und anderen europäischen Vorkommen müssen schneller entwickelt werden, und zwar mit direkter staatlicher Beteiligung an den Risiken. Feste Abnahmezusagen zu garantierten Mindestpreisen würden private Investoren ermutigen und langfristige Planungssicherheit schaffen. Die Genehmigungsverfahren, die derzeit bis zu 15 Jahre dauern, müssen drastisch beschleunigt werden, ohne dabei Umwelt- und Sozialstandards zu opfern.
Zweitens muss das Recycling durch verbindliche Quoten und finanzielle Anreize massiv ausgebaut werden. Hersteller von Magneten und magnetbasierten Produkten sollten verpflichtet werden, einen steigenden Anteil recycelter Materialien zu verwenden. Sammelstellen für Altgeräte müssen flächendeckend eingerichtet werden, und die Rückführung von Seltenen Erden aus Elektroschrott muss wirtschaftlich attraktiv gemacht werden. Langfristig sind Recyclingquoten von 30 bis 50 Prozent erreichbar, wenn entsprechende Anreize gesetzt werden.
Drittens müssen strategische Reserven angelegt werden. Deutschland und Europa benötigen Lagerbestände, die im Krisenfall mehrere Monate überbrücken können. Diese Reserven kosten Geld, aber sie sind eine Versicherung gegen geopolitische Schocks. Andere Länder wie Japan und die USA verfügen längst über solche Reserven.
Viertens sollten internationale Partnerschaften diversifiziert werden. Projekte in Australien, Kanada, Brasilien und anderen Ländern mit stabilen politischen Systemen und rechtsstaatlichen Strukturen sollten gefördert werden. Die jüngst angekündigte Beteiligung Deutschlands an einem australischen Projekt ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Volumen von 100 Millionen Euro ist angesichts der Dimension des Problems bescheiden.
Fünftens müssen Forschung und Entwicklung intensiviert werden. Alternative Materialen, die Seltene Erden ersetzen können, müssen gefördert werden. Einige Automobilhersteller wie BMW haben bereits Elektromotoren entwickelt, die ohne Seltenerden-Magnete auskommen. Solche Innovationen sollten breit unterstützt werden. Gleichzeitig muss in effizientere Gewinnungs- und Recyclingtechnologien investiert werden.
Sechstens ist eine kohärente europäische Industriepolitik erforderlich. Die Zersplitterung in nationale Alleingänge schwächt Europa. Nur gemeinsam verfügt die EU über die Finanzkraft und den Binnenmarkt, um eine eigenständige Rohstoffpolitik aufzubauen. Die 47 strategischen Projekte, die die EU-Kommission im März 2025 ausgewählt hat, sind ein Anfang, aber die Umsetzung muss beschleunigt werden.
All dies kostet Geld, viel Geld. Aber die Kosten der Untätigkeit sind noch höher. Jeder Tag, an dem Europa seine Abhängigkeit nicht reduziert, erhöht die Verwundbarkeit und verringert den politischen Handlungsspielraum. Die Rohstofffrage ist keine technische Detailfrage, sondern eine Schlüsselfrage für die industrielle Zukunft und die geopolitische Souveränität Europas. Ob Europa diese Herausforderung meistert, wird sich in den kommenden Jahren entscheiden.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier: