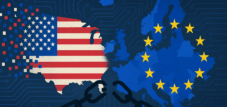Europas Rohstoffwende und der RESourceEU-Plan – Ein Kontinent am Scheideweg: Europas Aufholjagd gegen die Zeit
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 26. Oktober 2025 / Update vom: 26. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Europas Rohstoffwende – Ein Kontinent am Scheideweg: Europas Aufholjagd gegen die Zeit – Bild: Xpert.Digital
Europas Achillesferse: Der Wettlauf um die Rohstoffe der Zukunft - Der riskante Versuch, Chinas Monopol zu brechen
Wenn strategische Autonomie zur ökonomischen Notwendigkeit wird: Warum der EU-Plan zur Diversifizierung kritischer Rohstoffe scheitern könnte, bevor er beginnt
Die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 26. Oktober 2025 markiert einen Wendepunkt in der europäischen Wirtschaftspolitik. Mit dem RESourceEU-Plan will Europa seine existenzielle Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffimporten durchbrechen. Doch die Geschichte wirtschaftlicher Transformationen lehrt: Zwischen politischem Willen und ökonomischer Realität klafft oft ein Abgrund. Die EU steht vor der Herausforderung, innerhalb weniger Jahre eine Versorgungsstruktur aufzubauen, die China über Jahrzehnte systematisch entwickelt hat. Die Frage lautet nicht mehr, ob Europa handeln muss, sondern ob es bereits zu spät ist.
Passend dazu:
- Die Warnung eines Rohstoffhändlers: Wie die Kontrolle über Seltene Erden Europas Industrie in die Knie zwingt
Anatomie einer Verwundbarkeit: Europas Lebensadern in Chinas Hand
Die Ankündigung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Oktober 2025, einen umfassenden Plan zur Abkehr von chinesischen Rohstoffimporten zu entwickeln, ist keine isolierte wirtschaftspolitische Entscheidung. Sie ist das späte Eingeständnis einer strukturellen Fehlentwicklung, die über Jahrzehnte entstand und nun das Fundament der europäischen Wirtschaft bedroht. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 98 Prozent der in Europa benötigten Seltenen Erden stammen aus chinesischen Importen, bei Seltenerdmagneten, die für Elektromotoren und Windkraftanlagen unverzichtbar sind, liegt die Abhängigkeit bei über 90 Prozent. Deutschland importiert zwei Drittel seiner Seltenen Erden direkt aus China, europaweit liegt der Anteil bei 46 Prozent.
Diese Abhängigkeit erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette. China kontrolliert nicht nur 70 Prozent des weltweiten Abbaus, sondern dominiert mit 85 bis 90 Prozent die Raffinierung und mit über 90 Prozent die Produktion nachgelagerter Produkte wie Permanentmagnete. Bei der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge ist das Bild noch dramatischer: China produziert mehr als 98 Prozent der Lithium-Eisenphosphat-Aktivmaterialien und kontrolliert durch Eigentumsanteile an ausländischen Minen 29 Prozent der globalen Lithiumproduktion und 32 Prozent der Nickelproduktion.
Die strategische Dimension dieser Abhängigkeit wurde im Oktober 2024 überdeutlich, als China seine Exportkontrollen für Seltene Erden massiv verschärfte. Zu den bereits im April kontrollierten sieben Seltenerdmetallen kamen fünf weitere Elemente hinzu, darunter Holmium, Erbium, Thulium, Europium und Ytterbium. Damit unterliegen nun zwölf der siebzehn Seltenerdmetalle chinesischer Exportkontrolle. Die Genehmigungspflicht gilt bereits bei einem Metallgehalt von nur 0,1 Prozent, was praktisch alle relevanten Industrieprodukte erfasst. Westliche Regierungen interpretieren diese Maßnahmen als direkte Reaktion auf US-Handelszölle und als Druckmittel im geopolitischen Wettbewerb.
Für die europäische Industrie sind die Konsequenzen unmittelbar spürbar. Ohne Seltene Erden und kritische Rohstoffe gibt es keine Energiewende, keine Digitalisierung und keine Verteidigungsautonomie. Eine moderne Windkraftanlage mit zehn Megawatt Leistung benötigt zwei Tonnen Neodym. In jedem Elektroauto stecken etwa 450 Gramm Seltenerdmetalle für Permanentmagnete sowie durchschnittlich zwölf Kilogramm Lithium, vier Kilogramm Kobalt und 39 Kilogramm Nickel in der Batterie. Die EU-Nachfrage nach Seltenen Erden wird sich bis 2030 versechsfachen, bei Lithium um das Zwölffache steigen. Diese Bedarfssteigerung trifft auf eine Angebotsstruktur, die von einem einzigen Land kontrolliert wird.
Die wirtschaftliche Dimension übertrifft das Energiethema bei weitem. Während Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine Abhängigkeit von russischer Energie binnen zwei Jahren drastisch reduzieren konnte, importierte die EU zwischen 2022 und 2025 dennoch fossile Brennstoffe im Wert von über 200 Milliarden Euro aus Russland. Bei kritischen Rohstoffen ist eine vergleichbare Diversifizierung ungleich schwieriger, weil China nicht nur Lieferant, sondern auch Verarbeiter und Technologieführer ist. Die EU gibt jährlich knapp 100 Milliarden Euro für fossile Energieimporte aus, doch die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen bedroht Industriezweige mit einem Vielfachen dieser Summe: Automobilindustrie, Verteidigung, Luftfahrt, Elektronik und erneuerbare Energien zusammen repräsentieren einen erheblichen Teil der europäischen Wirtschaftsleistung.
Der RESourceEU-Plan, den von der Leyen nach dem Vorbild des erfolgreichen REPowerEU-Programms gestalten will, sieht eine Kombination aus Recycling, Diversifizierung der Lieferquellen und Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten vor. Partnerschaften mit der Ukraine, Australien, Kanada, Chile, Kasachstan, Usbekistan und Grönland sollen die chinesische Dominanz brechen. Die Herausforderung ist immens: Es geht nicht um den Ersatz eines Lieferanten durch einen anderen, sondern um den Aufbau kompletter Wertschöpfungsketten, die China über Jahrzehnte systematisch entwickelt hat. Die Analyse muss klären, ob dieser Plan realistische Erfolgsaussichten hat oder ob Europa sich in eine neue Form der Abhängigkeit begibt.
Vom kalifornischen Monopol zum chinesischen Imperium: Die Geschichte einer globalen Machtverschiebung
Die heutige chinesische Dominanz bei kritischen Rohstoffen ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen strategischen Planung. Die Geschichte beginnt paradoxerweise nicht in China, sondern in den Vereinigten Staaten. Bis in die 1980er Jahre dominierten die USA den Weltmarkt für Seltene Erden. Die Mountain Pass Mine in Kalifornien produzierte zwischen 1965 und 1995 den Großteil der weltweiten Seltenerdmetalle und lieferte 70 Prozent der globalen Versorgung. Die Mine wurde von Molycorp betrieben, einem Unternehmen, das zum Synonym für amerikanische Rohstoffsicherheit wurde.
Der Niedergang begann in den 1990er Jahren aus zwei Gründen. Erstens verursachte die Mine erhebliche Umweltschäden. Zwischen 1996 und 1998 kam es zu mehreren Leckagen radioaktiver und schwermetallhaltiger Abwässer, die zu kostspieligen Auflagen und schließlich 2002 zur Schließung führten. Zweitens hatte China systematisch eine Parallelelindustrie aufgebaut, die westliche Produzenten durch niedrigere Preise aus dem Markt drängte. Der chinesische Vorteil beruhte auf drei Säulen: laxere Umweltauflagen, staatliche Subventionen und deutlich niedrigere Arbeitskosten. Während deutsche Arbeitskräfte etwa 45 US-Dollar pro Stunde kosteten, lagen chinesische Löhne bei nur 7 US-Dollar. Über 99 Prozent der börsennotierten chinesischen Unternehmen erhielten direkte staatliche Zuschüsse, die nach konservativen Schätzungen drei- bis viermal höher lagen als westliche Subventionen.
Die strategische Wende erfolgte in den 1990er Jahren unter Deng Xiaoping, der erkannte, dass Seltene Erden ein politisches Machtinstrument werden könnten. China verfügte über etwa 37 Prozent der weltweiten Reserven, hauptsächlich in der Bayan-Obo-Mine in der Inneren Mongolei. Diese Lagerstätte enthält 8 bis 12 Prozent Seltenerdoxide in höchster Konzentration weltweit. Durch massive Investitionen und systematischen Wissensaufbau gelang es China, nicht nur die Förderung, sondern auch die Verarbeitung zu dominieren. Das Land hält heute zahlreiche Patente für Trennverfahren und gilt als Technologieführer bei der Raffinierung.
Die Konsolidierung der chinesischen Marktmacht erfolgte in mehreren Phasen. Zwischen 2005 und 2011 senkte China seine Exportquoten drastisch, was 2010 zur sogenannten Seltene-Erden-Krise führte. Die Preise für Neodym und Dysprosium vervielfachten sich, als China zeitweise Lieferstopps verhängte, insbesondere gegenüber Japan nach einem territorialen Konflikt. Nach einer Klage vor der Welthandelsorganisation hob China 2015 die formellen Exportquoten auf, behielt aber durch Exportsteuern, inländische Produktionsquoten und strategische Reserven faktisch die Kontrolle. Im Jahr 2021 erfolgte eine weitere Konsolidierung durch die Gründung der China Rare Earth Group, die mehrere staatliche Bergbauunternehmen bündelte und die Branche unter direkte Regierungskontrolle stellte.
Parallel dazu sicherte sich China durch Investitionen in ausländische Minen weltweite Kontrolle über die gesamte Lieferkette. Bei Lithium halten chinesische Unternehmen wie Tianqi Lithium 29 Prozent der globalen Produktion, obwohl 74 Prozent des weltweiten Lithiums aus Australien und Chile stammen. In Indonesien, dem größten Nickelproduzenten, kontrollieren chinesische Firmen wie Tsingshan 86 Prozent der Produktion, obwohl lokale Unternehmen weniger als fünf Prozent halten. Im Kongo, der 68 Prozent des weltweiten Kobalts fördert, teilen sich China und Europa die Kontrolle mit jeweils 47 Prozent.
Die europäische Passivität über Jahrzehnte beruhte auf der Illusion billiger und stabiler Lieferketten. Europäische Unternehmen lagerten die umweltschädliche Förderung nach China aus und profitierten von niedrigen Preisen. Diese Strategie funktionierte, solange China als verlässlicher Lieferant agierte. Die strategische Wende Pekings unter Xi Jinping ab 2012 änderte diese Kalkulation fundamental. China begann, kritische Rohstoffe als geopolitisches Druckmittel einzusetzen, zunächst subtil durch Quotenregelungen, später durch explizite Exportkontrollen.
Die EU erkannte die Problematik erstmals 2011 mit der ersten Liste kritischer Rohstoffe. Diese Liste wuchs von 14 Rohstoffen im Jahr 2011 auf 34 im Jahr 2023. Der 2020 veröffentlichte Critical Raw Materials Action Plan war ein erster Versuch strukturierter Gegenwehr. Doch erst der Critical Raw Materials Act von 2023, der im Mai 2024 in Kraft trat, setzte verbindliche Ziele: Bis 2030 sollen mindestens 10 Prozent des EU-Bedarfs aus eigenem Abbau, 40 Prozent aus europäischer Verarbeitung und 25 Prozent aus Recycling stammen. Zudem dürfen höchstens 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs aus einem einzigen Drittland kommen.
Die historische Analyse zeigt: Europas Abhängigkeit ist das Ergebnis bewusster wirtschaftspolitischer Entscheidungen über Jahrzehnte. China nutzte westliche Kurzsichtigkeit, um systematisch eine Monopolstellung aufzubauen. Der Versuch, diese Struktur binnen weniger Jahre umzukehren, gleicht dem Versuch, ein in Jahrzehnten gewachsenes Ökosystem über Nacht zu ersetzen. Die Frage ist nicht, ob Europa unabhängiger werden muss, sondern ob die Zeit dafür noch reicht.
Die Logik der Dominanz: Warum der Rohstoffmarkt anders funktioniert
Die Marktstruktur bei kritischen Rohstoffen unterscheidet sich fundamental von konventionellen Rohstoffmärkten. Während bei Erdöl oder Eisenerz multiple Anbieter existieren und Substitution möglich ist, herrscht bei Seltenen Erden und strategischen Metallen eine Quasi-Monopolstruktur. China kontrolliert nicht nur die Förderung, sondern die gesamte Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Endprodukt. Diese vertikale Integration schafft Abhängigkeiten, die sich nicht durch einfache Diversifizierung auflösen lassen.
Die ökonomischen Treiber dieser Struktur sind vielfältig. Der wichtigste Faktor sind Skaleneffekte in der Verarbeitung. Die Trennung und Raffinierung von Seltenerdoxiden ist ein komplexer chemischer Prozess, der erhebliche Kapitalinvestitionen und spezifisches Know-how erfordert. China hat über Jahrzehnte nicht nur Produktionskapazitäten aufgebaut, sondern auch Verfahren optimiert und Patente gesichert. Westliche Unternehmen, die heute in den Markt eintreten wollen, müssen diesen Wissensvorsprung aufholen, während sie gegen subventionierte chinesische Konkurrenz antreten.
Ein zweiter Treiber sind die Umweltkosten. Die Gewinnung von Seltenen Erden ist einer der umweltschädlichsten Bergbauprozesse überhaupt. Zur Extraktion werden große Mengen hochgiftiger Säuren verwendet, es entstehen radioaktive Abfälle durch die Freisetzung von Thorium und Uran, und es bleiben giftige Schlämme zurück. In der Bayan-Obo-Region in der Inneren Mongolei haben Umweltschäden katastrophale Ausmaße erreicht. Ein riesiges Auffangbecken mit schwach radioaktiv verseuchtem Klärschlamm liegt nur zehn Kilometer vom Gelben Fluss entfernt und sickert mit 300 Metern pro Jahr in Richtung des Flusses. Ganze Landstriche sind unbewohnbar geworden, Grundwasser ist verseucht, und die Desertifizierung der mongolischen Steppen schreitet voran. Die UN nannte Baotou 2024 als eine der 50 am stärksten verschmutzten Regionen der Welt.
Diese Umweltkosten erklärt Chinas Kostenvorteil. Während westliche Länder strenge Umweltauflagen haben, die den Abbau verteuern oder unmöglich machen, akzeptierte China diese Externalisierung. Der soziale Preis wird von der lokalen Bevölkerung getragen, insbesondere von mongolischen Nomaden, deren Lebensgrundlage zerstört wurde. Diese Kostenstruktur macht es für westliche Produzenten nahezu unmöglich, wettbewerbsfähig zu sein, ohne entweder Umweltstandards zu senken oder massive Subventionen zu erhalten.
Ein dritter Faktor ist die nachfrageseitige Entwicklung. Der Bedarf an kritischen Rohstoffen steigt exponentiell durch zwei Megatrends: die Energiewende und die Digitalisierung. Eine moderne Zehn-Megawatt-Offshore-Windkraftanlage benötigt zwei Tonnen Neodym. Die EU will bis 2030 ihre Windkraftkapazität massiv ausbauen. Bei einem durchschnittlichen Bedarf von 0,2 Tonnen Neodym pro Megawatt installierter Leistung bedeutet jede Gigawatt zusätzlicher Windkraft 200 Tonnen Neodym-Bedarf. Bei Elektrofahrzeugen ist die Dynamik ähnlich. Eine 60-kWh-Batterie enthält fünf Kilogramm Lithium, fünf Kilogramm Kobalt, 39 Kilogramm Nickel und fünf Kilogramm Mangan. Die EU strebt bis 2035 ein faktisches Verbot von Verbrennungsmotoren an. Das bedeutet Millionen von Elektrofahrzeugen zusätzlich, jedes mit einem Rohstoffbedarf, der ein Vielfaches eines Verbrenners beträgt.
Die Akteure in diesem Markt haben asymmetrische Interessen. Auf chinesischer Seite steht ein koordinierter staatlicher Akteur, der langfristig plant und Rohstoffe als Machtinstrument einsetzt. Die Konsolidierung der Branche in sechs großen staatlichen Konzernen seit 2021 unterstreicht diese Strategie. Auf europäischer Seite dominieren private Unternehmen mit Quartalshorizonten und Rentabilitätsdruck. Der Aufbau eigener Minen und Raffinationskapazitäten ist kapitalintensiv, riskant und dauert Jahre bis Jahrzehnte. Investoren fordern Renditen, die unter aktuellen Marktbedingungen schwer erreichbar sind. Der Staat muss daher als Risikoabsicherer und Finanzier auftreten, was politisch umstritten und fiskalisch belastend ist.
Die Marktmechanismen verschärfen diese Asymmetrie. China kann durch Exportbeschränkungen und Quotenregelungen Preise manipulieren. Zwischen 2010 und 2011 vervielfachten sich die Preise für Seltenerdmetalle, als China die Exporte drosselte. Solche Volatilität macht Investitionen in westliche Produktionskapazitäten riskanter. Ein Unternehmen, das heute in eine Mine oder Raffinerie investiert, muss damit rechnen, dass China morgen die Preise senkt, um den Wettbewerber auszuschalten. Diese Strategie hat bereits mehrfach funktioniert. Molycorp, der Betreiber der Mountain Pass Mine, ging 2015 bankrott, nachdem China nach Ende der Preiskrise 2011 die Exportquoten lockerte und die Preise einbrachen.
Der strategische Hebel, den die EU mit dem Critical Raw Materials Act geschaffen hat, versucht diese Marktmechanismen zu durchbrechen. Die Festlegung von Richtwerten für heimische Förderung, Verarbeitung und Recycling soll Planungssicherheit schaffen. Die Begrenzung auf maximal 65 Prozent Abhängigkeit von einem Land ist ein politisches Signal. Doch wirtschaftlich greifen diese Vorgaben nur, wenn gleichzeitig Investitionsanreize, Finanzierungsinstrumente und Risikoabsicherungen geschaffen werden. Der RESourceEU-Plan muss daher über die Diversifizierung von Lieferanten hinausgehen und die gesamte Wertschöpfungskette neu aufbauen. Die Frage ist, ob die EU die dafür notwendigen Ressourcen, den politischen Willen und die Zeit hat.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Wie Europa seine Rohstoff-Abhängigkeit von China wirklich brechen kann
Jenseits der Importstatistik: Die verborgenen Tiefen der europäischen Abhängigkeit
Die quantitative Analyse der aktuellen Versorgungslage offenbart die Dimension der Herausforderung. Deutschland importierte 2024 insgesamt 5.200 Tonnen Seltene Erden im Wert von 64,7 Millionen Euro, das entspricht einem Rückgang von 12,6 Prozent gegenüber 2023. Von dieser Menge stammten 65,5 Prozent direkt aus China, was 3.400 Tonnen entspricht. Zweitwichtigstes Herkunftsland war Österreich mit 23,2 Prozent, gefolgt von Estland mit 5,6 Prozent. Diese Statistik ist jedoch irreführend, denn in Österreich und Estland werden Seltene Erden lediglich weiterverarbeitet, die ursprüngliche Herkunft ist statistisch nicht nachweisbar, dürfte aber großteils ebenfalls China sein.
Auf EU-Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild. Die gesamte EU importierte 2024 12.900 Tonnen Seltene Erden im Wert von 101 Millionen Euro. 46,3 Prozent stammten aus China, 28,4 Prozent aus Russland und 19,9 Prozent aus Malaysia. Die Abhängigkeit von Russland ist angesichts des Ukraine-Krieges politisch inakzeptabel, und Malaysia verarbeitet ebenfalls hauptsächlich chinesische Rohstoffe über das Unternehmen Lynas. Die reale chinesische Kontrolle liegt also deutlich über den offiziellen Importstatistiken.
Bei bestimmten Elementen ist die Abhängigkeit noch extremer. Lanthanverbindungen, die für Akkus benötigt werden, kamen 2024 zu 76,3 Prozent aus China. Neodym, Praseodym und Samarium, die für Dauermagneten in Elektromotoren unverzichtbar sind, wurden nahezu vollständig aus China importiert. Diese Elemente sind nicht substituierbar; ohne sie kann keine moderne Windkraftanlage und kein Elektrofahrzeug gebaut werden.
Die Importmengen sind zwar absolut gesehen überschaubar, doch ihre strategische Bedeutung ist immens. Der mengenmäßige Höchststand der letzten zehn Jahre lag 2018 bei 9.700 Tonnen für Deutschland. Der Rückgang auf 5.200 Tonnen 2024 spiegelt nicht etwa erfolgreiche Diversifizierung wider, sondern eher konjunkturelle Schwäche und Produktionsprobleme in der europäischen Industrie. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass die EU-Nachfrage nach Seltenen Erden bis 2030 um das Sechsfache steigen wird, bei Lithium um das Zwölffache und bei Kobalt um das Fünffache. Diese Bedarfssteigerung trifft auf eine Angebotsstruktur, die nahezu vollständig von China kontrolliert wird.
Die Herausforderungen gehen über Import-Export-Statistiken hinaus. Ein zentrales Problem ist der Mangel an eigener Verarbeitungskapazität. Europa verfügt über praktisch keine Anlagen zur Trennung und Raffinierung von Seltenerdoxiden. Die einzigen nennenswerten Kapazitäten außerhalb Chinas finden sich in kleinen Pilotanlagen in Estland und punktuell in Frankreich, die jedoch mengenmäßig irrelevant sind. Der Aufbau solcher Anlagen dauert Jahre und erfordert Milliarden-Investitionen. Selbst wenn Europa alternative Lieferländer wie Australien oder Kanada findet, müssten die Rohstoffe zur Verarbeitung nach China geschickt werden, was die Abhängigkeit nur verlagert, aber nicht löst.
Ein zweites Problem ist das Recycling. Derzeit werden nur etwa ein Prozent der Seltenen Erden recycelt. Die Gründe sind technischer und ökonomischer Natur. Permanentmagnete sind in Endprodukten fest verbaut und schwer zu demontieren. Die chemische Aufbereitung zur Rückgewinnung der Metalle ist aufwändig und teuer. Viele Produkte, die hohe Konzentrationen an Seltenen Erden enthalten, wie Batterien von Elektroautos und Magnete in Windkraftanlagen, sind noch in Gebrauch und Jahre davon entfernt, ausgemustert zu werden. Ein effektives Recyclingsystem könnte langfristig 25 Prozent des EU-Bedarfs decken, doch der Aufbau dauert Jahrzehnte.
Die Diversifizierung der Lieferquellen, die im RESourceEU-Plan vorgesehen ist, stößt auf praktische Grenzen. Die Ukraine verfügt über bedeutende Vorkommen an Lithium, Graphit, Titan und 22 der 30 von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffe. Doch viele Lagerstätten liegen in umkämpften Gebieten im Osten des Landes, und die Infrastruktur ist durch russische Angriffe zerstört. Grönland besitzt eines der größten Vorkommen schwerer Seltener Erden weltweit, doch die Lagerstätten befinden sich fernab jeder Infrastruktur, teilweise unter Gletschern. Die Erschließungskosten werden auf bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, und bisher ist keine einzige Mine in Betrieb.
Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, und die EU hat 2023 eine strategische Rohstoffpartnerschaft geschlossen. Doch die industrielle Kooperation bleibt hinter den Erwartungen zurück. Chile strebt höhere lokale Wertschöpfung an und will nicht nur Rohstofflieferant sein. Die EU muss daher in chilenische Verarbeitungskapazitäten investieren, was Zeit und Kapital bindet. Australien fördert 53 Prozent des weltweiten Lithiums, doch chinesische Unternehmen kontrollieren 29 Prozent der Produktion durch Beteiligungen an australischen Minen. Die Diversifizierung verlagert die Abhängigkeit also teilweise nur von der Förderungs- zur Eigentumsebene.
Die aktuelle Lage ist zugespitzt durch Chinas jüngste Exportkontrollen vom Oktober 2024. Die Genehmigungspflicht bei einem Metallgehalt von nur 0,1 Prozent erfasst praktisch alle relevanten Industrieprodukte. Unternehmen müssen sensible Informationen mit chinesischen Behörden teilen, bevor sie eine Ausfuhrgenehmigung erhalten. Diese Prozedur dauert Monate und schafft massive Unsicherheit. Europäische Autohersteller und Zulieferer warnen bereits vor Produktionskürzungen. Die Preise für Dysprosium, Terbium und Yttrium haben auf dem Spotmarkt Rekordniveaus erreicht.
Die quantitative Bestandsaufnahme zeigt: Europa befindet sich in einer Situation strategischer Verwundbarkeit, die sich kurzfristig nicht auflösen lässt. Selbst bei sofortigem und entschlossenem Handeln dauert es Jahre, bis neue Minen erschlossen, Verarbeitungskapazitäten aufgebaut und Recyclingsysteme etabliert sind. Die Ziele des Critical Raw Materials Act für 2030 sind ambitioniert, die Realität zeigt jedoch, dass der Aufbau heimischer Kapazitäten langsamer voranschreitet als geplant.
Passend dazu:
- Seltene Erden: Chinas Rohstoff-Dominanz – Mit Recycling, Forschung und neue Minen raus aus der Rohstoff-Abhängigkeit?
Von Kalifornien bis Kiew: Ein Blick auf die globalen Schauplätze des Rohstoffkampfes
Die Erfahrungen der USA mit dem Wiederaufbau eigener Rohstoffkapazitäten bieten wichtige Lehren für Europa. Die Mountain Pass Mine in Kalifornien ist das zentrale Beispiel. Nach der Schließung 2002 und dem Bankrott von Molycorp 2015 übernahm 2017 das Unternehmen MP Materials die Mine. Mit Unterstützung chinesischer Investoren, insbesondere des staatlichen Unternehmens Shenghe Resources, gelang die Wiederinbetriebnahme. Bis 2022 produzierte die Mine 42.000 Tonnen Seltenerdoxide jährlich, dreimal so viel wie unter Molycorp. 2024 erreichte die Produktion über 45.000 Tonnen und deckte etwa 15,8 Prozent der weltweiten Nachfrage.
Der Erfolg war jedoch an eine Abhängigkeit von China geknüpft. Etwa 80 Prozent der Produktion wurden als Konzentrat nach China zur Weiterverarbeitung exportiert, weil in den USA keine Raffinierungskapazitäten existierten. Shenghe Resources hielt eine Beteiligung von acht Prozent und war gleichzeitig der Hauptabnehmer. Als China 2025 steile Zölle und neue Exportrestriktionen verhängte, stoppte MP Materials alle Lieferungen nach China und investierte fast eine Milliarde US-Dollar in den Aufbau eigener Verarbeitungsanlagen. Das Unternehmen gründete zudem ein Joint Venture mit Saudi-Arabiens Ma’aden, um sich vom chinesischen Markt zu lösen.
Die Lehre aus diesem Fall ist ambivalent. Einerseits zeigt Mountain Pass, dass der Wiederaufbau eigener Förderkapazitäten möglich ist, wenn ausreichend Kapital und politischer Wille vorhanden sind. Andererseits verdeutlicht die Episode, dass Förderung allein nicht ausreicht. Ohne eigene Verarbeitungskapazitäten bleibt die Abhängigkeit von China bestehen. Der Aufbau dieser Kapazitäten dauert Jahre und verschlingt Milliarden. Zudem bleibt die Umweltfrage ungelöst. Die Mountain Pass Mine steht weiterhin unter strenger Beobachtung wegen potenzieller Umweltrisiken, insbesondere der Entsorgung radioaktiver Abfälle und der Wasserverschmutzung.
Die USA haben zudem durch den Inflation Reduction Act von 2022 massive Subventionen für kritische Rohstoffe geschaffen. Das Gesetz sieht einen Produktionszuschuss von zehn Prozent der Kosten für kritische Mineralien vor, bei Batteriezellen sogar 35 US-Dollar pro Kilowattstunde. Für Elektrofahrzeuge gibt es Steuergutschriften bis zu 7.500 US-Dollar, aber nur wenn 40 Prozent der Batterierohstoffe aus Nordamerika oder Freihandelsländern stammen, mit schrittweiser Erhöhung auf 80 Prozent bis 2027. Ab 2025 dürfen kritische Mineralien nicht mehr aus China, Russland oder anderen “foreign entities of concern” stammen. Diese Regelung zwingt US-Hersteller zur Diversifizierung, schafft aber auch Handelskonflikte mit Europa, da europäische Produzenten benachteiligt werden.
Der Vergleich mit Australien zeigt eine andere Strategie. Australien ist der weltgrößte Lithiumproduzent mit 53 Prozent der globalen Förderung. Das Land hat jedoch keine nennenswerte eigene Verarbeitungsindustrie. 74 Prozent des weltweiten Lithiums stammen aus Australien und Chile, doch chinesische und US-amerikanische Unternehmen halten die größten Anteile an der Produktion. Australien profitiert von den Rohstoffexporten, bleibt aber in der Wertschöpfungskette auf der untersten Stufe. Die EU hat 2024 eine strategische Rohstoffpartnerschaft mit Australien geschlossen, die die gesamte Wertschöpfungskette von Exploration über Abbau bis Verarbeitung umfasst. Doch bisher sind konkrete Projekte rar.
Lynas, ein australisches Unternehmen, ist der einzige nennenswerte Produzent außerhalb Chinas für leichte Seltene Erden. Das Unternehmen betreibt Minen in Australien und eine Trennanlage in Malaysia. Lynas erhält massive Unterstützung vom US-Verteidigungsministerium, das 30 Millionen US-Dollar für eine Separationsanlage für leichte Seltene Erden in Texas zugesagt hat. 2023 gelang Lynas als erstes nicht-chinesisches Unternehmen die kommerzielle Herstellung eines schweren Seltenerdmetalls. Dieser Erfolg zeigt, dass Durchbrüche möglich sind, aber nur mit erheblicher staatlicher Förderung und über lange Zeiträume.
Chile bietet Einblicke in die Komplexität von Rohstoffpartnerschaften. Die EU schloss 2023 ein Memorandum of Understanding mit Chile über eine strategische Rohstoffpartnerschaft. Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent weltweit und verfügt über 25 Prozent der globalen Kupferproduktion. Die Partnerschaft sieht wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, Infrastrukturausbau und gemeinsame Joint Ventures vor. Im November 2024 wurde eine Roadmap mit konkreten Projekten vereinbart. Doch die Umsetzung stockt. Chile fordert höhere lokale Wertschöpfung und will nicht nur Rohstofflieferant bleiben. Die EU muss daher in chilenische Verarbeitungskapazitäten investieren, was Synergien zwischen Rohstoffen, erneuerbaren Energien und Wasserstoff erfordert. Zudem konkurriert die EU mit China und den USA um Zugang zu chilenischen Ressourcen.
Die Ukraine stellt einen Sonderfall dar. Das Land verfügt über eines der größten Lithiumvorkommen Europas und über 22 der 30 von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffe. Die geschätzten Lithiumreserven betragen etwa 500.000 Tonnen, doch die Förderung steht kriegsbedingt still. Viele Lagerstätten befinden sich in den umkämpften Regionen Saporischschja und Donezk, die teilweise unter russischer Kontrolle stehen. Die Ukraine könnte nach Kriegsende eine Schlüsselrolle für die europäische Rohstoffversorgung spielen und aus Verkaufserlösen den Wiederaufbau finanzieren. Doch dies setzt einen raschen Frieden, massive Investitionen in Infrastruktur und Verarbeitungskapazitäten sowie jahrelange Aufbauarbeit voraus. Kurzfristig ist die Ukraine keine Lösung für Europas Rohstoffproblem.
Die Global Gateway Initiative der EU versucht, durch Investitionen in Afrika und Lateinamerika Rohstoffpartnerschaften aufzubauen. Die EU hat seit 2021 14 strategische Rohstoffpartnerschaften geschlossen, unter anderem mit Australien, Kanada, Chile, der Ukraine, Grönland, der Demokratischen Republik Kongo und Sambia. Diese Partnerschaften umfassen Rohstoffverarbeitung, Forschung, Infrastrukturausbau und Nachhaltigkeitsstandards. Doch die Umsetzung ist langsam, und bisher sind nur wenige Roadmaps öffentlich verfügbar. Die EU konkurriert zudem mit Chinas Belt and Road Initiative, die über Jahre hinweg massive Investitionen in afrikanische Infrastruktur getätigt hat.
Die Fallstudien zeigen: Der Aufbau eigener Rohstoffkapazitäten ist möglich, erfordert aber massive staatliche Unterstützung, langjährige Investitionen und strategische Geduld. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act Milliarden mobilisiert, die EU muss ähnliche Instrumente schaffen. Die Diversifizierung der Lieferquellen funktioniert nur, wenn gleichzeitig Verarbeitungskapazitäten aufgebaut werden. Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern sind notwendig, aber komplex und zeitaufwändig. Die Konkurrenz mit China und den USA um Zugang zu Ressourcen verschärft sich. Europa muss beweisen, dass es ein verlässlicher Partner ist, der nicht nur Rohstoffe kauft, sondern echte Entwicklungszusammenarbeit betreibt.
Die Sollbruchstellen im Plan: Zeit, Geld und ungelöste Zielkonflikte
Die ambitionierten Ziele des RESourceEU-Plans treffen auf eine Reihe struktureller Hindernisse und ungeklärter Zielkonflikte. Das erste Problem ist zeitlicher Natur. Der Critical Raw Materials Act setzt Richtwerte für 2030, also in fünf Jahren. Diese Zeitspanne ist unrealistisch kurz für den Aufbau kompletter Wertschöpfungsketten. Die Erschließung einer neuen Mine dauert durchschnittlich zehn bis fünfzehn Jahre von der Exploration bis zur Produktion. Der Bau von Raffinierungsanlagen benötigt fünf bis zehn Jahre. Genehmigungsverfahren in Europa sind notorisch langwierig. Selbst wenn heute alle politischen Entscheidungen getroffen würden, kämen die ersten Mengen heimischer Produktion frühestens Mitte der 2030er Jahre auf den Markt. Die Ziele für 2030 sind daher eher als politisches Signal denn als realistische Planung zu verstehen.
Das zweite Problem ist finanzieller Natur. Die EU-Kommission schätzt, dass die Umsetzung des Critical Raw Materials Act bis 2027 zusätzliche Investitionen von 210 Milliarden Euro erfordert. Diese Summe soll teils aus EU-Mitteln, teils aus nationalen Budgets und hauptsächlich aus privaten Investitionen stammen. Doch private Investoren sind zurückhaltend, solange China jederzeit durch Preis- und Quotenmanipulation neue Minen unrentabel machen kann. Das Beispiel Molycorp zeigt, wie schnell Investitionen vernichtet werden können. Ohne staatliche Risikoabsicherung, Absatzgarantien und langfristige Subventionen werden private Investitionen nicht im notwendigen Umfang fließen. Die EU konkurriert zudem mit den USA, wo der Inflation Reduction Act mit 400 Milliarden US-Dollar massive Anreize schafft.
Das dritte Problem ist der Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Rohstoffgewinnung. Die Förderung von Seltenen Erden ist extrem umweltschädlich. In China haben Jahrzehnte des Abbaus in der Inneren Mongolei zu ökologischen Katastrophen geführt. Radioaktive Schlämme verseuchen Grundwasser, Flüsse und Böden. Die Frage ist, ob Europa bereit ist, ähnliche Umweltschäden zu akzeptieren, oder ob strengere Standards die Produktion verteuern und unrentabel machen. Grönland hat beispielsweise 2021 den Uranabbau verboten, was auch Projekte für Seltene Erden betrifft, die oft mit radioaktivem Thorium vergesellschaftet sind. Die Balance zwischen Rohstoffsicherheit und Umweltschutz ist politisch hochumstritten.
Das vierte Problem ist die Recycling-Illusion. Der Critical Raw Materials Act setzt auf 25 Prozent Recyclingquote bis 2030. Doch derzeit liegt die Quote bei etwa einem Prozent. Die Technologien für effizientes Recycling von Seltenen Erden existieren zwar im Labormaßstab, sind aber kommerziell nicht etabliert. Viele Produkte, die hohe Konzentrationen enthalten, sind noch Jahre in Betrieb. Selbst wenn ab sofort alle ausgedienten Windkraftanlagen und Elektroautos recycelt würden, stünde erst in zehn bis zwanzig Jahren eine nennenswerte Menge zur Verfügung. Recycling ist langfristig essentiell, löst aber das kurzfristige Versorgungsproblem nicht.
Das fünfte Problem ist die Konkurrenz um Rohstoffe. Europa steht im globalen Wettbewerb mit China, den USA und anderen Industrieländern. China konsumiert bereits heute 87 Prozent der weltweit geförderten Seltenen Erden, 35 Prozent des Nickels, über 50 Prozent des Lithiums und des Kobalts. Diese Nachfrage wird weiter steigen, weil China massiv in Elektromobilität und erneuerbare Energien investiert. Die USA sichern sich durch den Inflation Reduction Act bevorzugten Zugang zu nordamerikanischen Rohstoffen und Freihandelspartnern. Europa hat weniger Hebel. Die Global Gateway Initiative versucht, durch Infrastrukturinvestitionen in Afrika und Lateinamerika Rohstoffpartnerschaften aufzubauen. Doch China hat dort über Jahre massive Vorleistungen erbracht. Die Belt and Road Initiative hat Milliarden in afrikanische Infrastruktur investiert und enge Beziehungen aufgebaut. Europa muss beweisen, dass es ein besserer Partner ist, was Zeit und Geld erfordert.
Das sechste Problem ist politischer Natur. Die Diversifizierung von China zu anderen Lieferanten wie der Ukraine, Grönland oder afrikanischen Staaten schafft neue Abhängigkeiten und geopolitische Verwicklungen. Grönland ist Teil Dänemarks, strebt aber mehr Autonomie an. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt Interesse an Grönland geäußert und militärischen Druck nicht ausgeschlossen. Die Ukraine ist Kriegsgebiet, ihre Rohstoffvorkommen sind teilweise unter russischer Kontrolle. Partnerschaften mit autokratischen Regimen in Afrika und Zentralasien werfen ethische Fragen auf, ähnlich wie bei der bisherigen China-Abhängigkeit. Die EU riskiert, von einer Abhängigkeit in die nächste zu geraten, ohne grundlegende Kontrolle über die Lieferketten zu gewinnen.
Das siebte Problem ist die Frage der Verteidigungsfähigkeit. Kritische Rohstoffe sind nicht nur für Klimatechnologien, sondern auch für Rüstungsgüter essentiell. Elektromotoren in Drohnen, Elektronik in Raketen, Legierungen in Triebwerken, alles benötigt Seltene Erden, Titan, Nickel, Kobalt und andere strategische Metalle. Die Abhängigkeit von China bedroht die europäische Verteidigungsautonomie. Im Konfliktfall könnte China Lieferungen stoppen und Europa strategisch erpressen. Der RESourceEU-Plan muss daher auch eine verteidigungspolitische Dimension haben, was die Komplexität und die erforderlichen Investitionen weiter erhöht.
Die Debatte über den richtigen Weg ist kontrovers. Befürworter einer offensiven Strategie fordern massive staatliche Investitionen, Subventionen und notfalls auch protektionistische Maßnahmen wie Importzölle auf chinesische Verarbeitungsprodukte. Kritiker warnen vor einer Eskalation von Handelskonflikten, die Europa insgesamt schaden könnten, weil China als Absatzmarkt für europäische Produkte wegbricht. Die Automobilindustrie ist hin- und hergerissen: Sie benötigt einerseits sichere Rohstofflieferungen, ist aber andererseits auf den chinesischen Markt angewiesen. Ein Handelskrieg würde europäische Hersteller in eine Zwickmühle bringen.
Eine weitere Kontroverse betrifft die Rolle des Staates versus Marktmechanismen. Liberale Ökonomen argumentieren, dass staatliche Lenkung und Subventionen zu Ineffizienzen und Fehlinvestitionen führen. Sie plädieren für marktwirtschaftliche Lösungen und warnen vor einer Renaissance der Planwirtschaft. Pragmatiker entgegnen, dass Marktmechanismen bei strategischen Rohstoffen versagt haben, weil China selbst kein Marktteilnehmer, sondern ein staatlicher Akteur ist. Ohne staatliche Gegensteuerung bleibt Europa chancenlos. Der Critical Raw Materials Act ist ein Kompromiss, der Zielvorgaben setzt, aber die Umsetzung weitgehend dem Markt überlässt. Ob dieser Mittelweg funktioniert, ist offen.
Die kritische Würdigung zeigt: Der RESourceEU-Plan ist notwendig, aber mit erheblichen Risiken behaftet. Die Zeitfenster sind zu knapp, die Kosten immens, die Zielkonflikte ungelöst. Ohne entschlossenes Handeln bleibt Europa verwundbar, doch unüberlegtes Handeln könnte die Situation verschärfen. Die Balance zwischen Rohstoffsicherheit, Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und geopolitischer Klugheit zu finden, ist die zentrale Herausforderung.
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Fragmentierung oder Zusammenarbeit? Die geopolitische Wette um kritische Rohstoffe
Fünf Wege in die Zukunft: Mögliche Szenarien für Europas Rohstoffversorgung
Die Entwicklung der nächsten Jahre wird von mehreren Szenarien bestimmt, die sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern in Teilen überlappen können. Das erste Szenario ist die schrittweise Diversifizierung mit begrenztem Erfolg. In diesem Fall gelingt es der EU, ihre Abhängigkeit von China graduell zu reduzieren, aber nicht zu überwinden. Neue Partnerschaften mit Australien, Kanada, Chile und der Ukraine liefern zusätzliche Rohstoffmengen, doch die Verarbeitung bleibt großteils in China. Europa baut eigene Raffinierungskapazitäten auf, die bis Mitte der 2030er Jahre etwa 20 bis 30 Prozent des Bedarfs decken. Recycling erreicht bis 2035 eine Quote von 15 Prozent. Insgesamt sinkt die Abhängigkeit von China von aktuell über 90 Prozent auf etwa 50 bis 60 Prozent bis 2035. Dies wäre ein Teilerfolg, lässt Europa aber weiterhin verwundbar.
Das zweite Szenario ist die technologische Disruption durch Substitution. Forschung und Entwicklung könnten Durchbrüche bei Materialien erzielen, die Seltene Erden teilweise oder vollständig ersetzen. Bei Permanentmagneten gibt es Ansätze, Neodym durch Ferrit oder andere Verbindungen zu substituieren, allerdings mit Leistungseinbußen. Bei Batterien könnte der Trend zu Natrium-Ionen-Batterien oder Feststoffbatterien gehen, die weniger oder andere kritische Rohstoffe benötigen. Solche Innovationen könnten die Nachfrage nach bestimmten Elementen senken und die Abhängigkeit von China strukturell reduzieren. Allerdings sind diese Technologien noch nicht marktreif, und der Übergang dauert Jahrzehnte. Zudem schafft jede neue Technologie oft neue Abhängigkeiten von anderen Materialien.
Das dritte Szenario ist die geopolitische Eskalation mit Lieferunterbrechungen. China könnte im Konfliktfall, etwa um Taiwan, Exportverbote für kritische Rohstoffe verhängen. Dies würde die europäische Industrie kurzfristig lahmlegen. Produktionsketten für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Elektronik würden zusammenbrechen. Die wirtschaftlichen Schäden wären immens, ähnlich wie beim Öl-Embargo der 1970er Jahre. Dieses Szenario ist der Albtraum für europäische Planer und der Haupttreiber hinter dem RESourceEU-Plan. Die EU muss Notfallreserven aufbauen und Lagerhaltung organisieren, was hohe Kosten verursacht und praktisch schwierig ist, weil viele Rohstoffe als Zwischenprodukte eingeführt werden, die nicht lagerfähig sind.
Das vierte Szenario ist die erfolgreiche strategische Autonomie. In diesem optimistischen Fall gelingt der EU ein umfassender Umbau der Rohstoffversorgung. Eigene Minen in Skandinavien, Grönland und Mitteleuropa werden erschlossen, Verarbeitungskapazitäten massiv ausgebaut, Recycling etabliert und internationale Partnerschaften konsolidiert. Bis 2040 deckt Europa 40 Prozent seines Bedarfs aus eigener Förderung und Verarbeitung, 30 Prozent aus Recycling und nur noch 30 Prozent aus Importen, die breit diversifiziert sind. Dieses Szenario erfordert jedoch politischen Willen, enorme Investitionen und Zeit. Es setzt voraus, dass Europa bereit ist, Umweltkosten zu akzeptieren, Subventionen zu zahlen und langfristig zu planen. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios ist angesichts der politischen Fragmentierung der EU und der kurzen Zeitfenster gering, aber nicht unmöglich.
Das fünfte Szenario ist die regionale Fragmentierung der Weltwirtschaft. Die Konkurrenz zwischen den USA, China und Europa um Rohstoffe führt zu wirtschaftlichen Blöcken, die jeweils eigene Lieferketten aufbauen. Die USA sichern sich Nordamerika, Teile Lateinamerikas und ausgewählte Pazifik-Partner. China kontrolliert Asien, Teile Afrikas und den Nahen Osten. Europa versucht, mit Afrika, Lateinamerika und der Ukraine zusammenzuarbeiten. Diese Fragmentierung reduziert die Effizienz der Weltwirtschaft, erhöht Kosten und verlangsamt die Energiewende. Sie schafft aber auch stabilere, wenn auch teurere Lieferketten innerhalb jedes Blocks. Dieses Szenario ist eine realistische Entwicklung, die bereits in Ansätzen sichtbar ist.
Potenzielle Disruptionen können diese Szenarien überlagern oder beschleunigen. Eine erste Disruption wäre ein rascher Friedensschluss in der Ukraine mit westlicher Unterstützung für den Wiederaufbau. Die Ukraine könnte binnen zehn Jahren zu einem wichtigen Rohstofflieferanten für Europa werden. Eine zweite Disruption wäre ein Regimewechsel in China oder eine fundamentale Neuausrichtung der chinesischen Politik, etwa eine Öffnung des Rohstoffmarktes oder umgekehrt eine noch stärkere Abschottung. Beides würde die europäische Strategie fundamental verändern. Eine dritte Disruption wäre ein technologischer Durchbruch bei Energiespeicherung oder Transport, der die Nachfrage nach Seltenen Erden strukturell senkt.
Die Zeitdimension ist entscheidend. Die 2020er Jahre sind die kritische Phase. Wenn Europa bis 2030 keine substantiellen Fortschritte macht, wird die Abhängigkeit von China zementiert, weil die Nachfrage exponentiell steigt. Die nächsten fünf Jahre entscheiden über die strategische Autonomie für die nächsten Jahrzehnte. Das REPowerEU-Modell zeigt, dass Europa bei ausreichendem Druck schnell handeln kann. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine reduzierte die EU ihre Gasimporte aus Russland von 47 Prozent 2019 auf unter 20 Prozent 2024. Dieser Erfolg beruhte auf Diversifizierung, LNG-Importen, Energieeinsparungen und beschleunigtem Ausbau erneuerbarer Energien. Der RESourceEU-Plan muss ähnliche Dynamik entfachen.
Die Rolle der Technologie ist ambivalent. Einerseits könnten Durchbrüche bei Substitution, Recycling oder Effizienz die Nachfrage senken. Andererseits treibt jede neue Technologie wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputer oder fortschrittliche Rüstungssysteme den Bedarf an spezifischen Rohstoffen. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche erhöht die Abhängigkeit von kritischen Metallen. Europa kann sich nicht aus der Abhängigkeit herauswachsen, sondern muss aktiv Alternativen aufbauen.
Die internationale Dimension ist zentral. Die EU kann das Problem nicht allein lösen. Kooperation mit gleichgesinnten Partnern wie den USA, Kanada, Australien und Japan ist essentiell. Ein “Critical Raw Materials Club”, den die EU vorgeschlagen hat, könnte gemeinsame Standards, Forschung und Notfallreserven koordinieren. Zugleich muss die EU mit China im Dialog bleiben, um Eskalationen zu vermeiden. Die Balance zwischen Konfrontation und Kooperation ist heikel, aber notwendig.
Der Ausblick ist gemischt. Europa hat die Herausforderung erkannt und erste Schritte unternommen. Der Critical Raw Materials Act, der RESourceEU-Plan und die Rohstoffpartnerschaften sind Instrumente, die greifen können. Doch die Zeit ist knapp, die Kosten hoch und die Zielkonflikte ungelöst. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine graduelle Diversifizierung mit begrenztem Erfolg, die Europa verwundbarer zurücklässt als nötig, aber weniger abhängig als heute. Die strategische Autonomie wird ein langfristiges Projekt über Jahrzehnte, nicht Jahre. Europa muss lernen, mit Unsicherheit zu leben und Risiken aktiv zu managen.
Zeit zu handeln: Imperative für Politik, Wirtschaft und Investoren
Die Ankündigung des RESourceEU-Plans markiert einen überfälligen Paradigmenwechsel in der europäischen Wirtschaftspolitik. Jahrzehntelang profitierte Europa von der Illusion stabiler und günstiger Rohstofflieferungen aus China. Diese Illusion ist zerbrochen. Die chinesischen Exportbeschränkungen vom Oktober 2024 sind keine temporäre Maßnahme, sondern Teil einer langfristigen Strategie, kritische Rohstoffe als geopolitisches Machtinstrument einzusetzen. Europa steht vor der Wahl zwischen strategischer Autonomie und dauerhafter Verwundbarkeit.
Die Analyse zeigt: Der Weg zur Unabhängigkeit ist steinig, kostspielig und langwierig. Die Ziele des Critical Raw Materials Act für 2030 sind ambitioniert, aber nicht unrealistisch, wenn jetzt entschlossen gehandelt wird. Die zehn Prozent heimische Förderung, 40 Prozent europäische Verarbeitung und 25 Prozent Recycling sind erreichbar, erfordern aber Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe, politischen Konsens über Jahrzehnte und die Bereitschaft, Umweltkosten und soziale Verwerfungen zu akzeptieren. Die Diversifizierung auf maximal 65 Prozent Abhängigkeit von einem Land ist ein sinnvoller Richtwert, der Resilienz ohne Autarkie-Illusion schafft.
Die strategischen Implikationen für politische Entscheidungsträger sind klar. Erstens muss die Finanzierung gesichert werden. Die EU benötigt ein Rohstoff-Investitionsprogramm ähnlich dem Inflation Reduction Act der USA, mit Subventionen, Risikoabsicherungen und Absatzgarantien für private Investoren. Die 210 Milliarden Euro, die die Kommission schätzt, sind ein Minimum, nicht ein Maximum. Zweitens müssen Genehmigungsverfahren drastisch beschleunigt werden. Der Critical Raw Materials Act sieht 27 Monate für Abbaulizenzen und 15 Monate für Verarbeitungs- und Recyclinganlagen vor. Diese Fristen müssen eingehalten werden, was Reformen in nationalen Bergbaugesetzen und Umweltauflagen erfordert. Drittens muss Recycling als strategische Priorität behandelt werden. Produktdesign muss von vornherein auf Recyclingfähigkeit ausgerichtet werden, Sammlungssysteme etabliert und Forschung in Recyclingtechnologien massiv gefördert werden.
Für Unternehmensführer ergeben sich ebenfalls Handlungsnotwendigkeiten. Die Zeiten stabiler und günstiger Rohstoffpreise sind vorbei. Unternehmen müssen ihre Lieferketten diversifizieren, strategische Vorräte aufbauen und in die Entwicklung rohstoffarmer oder rohstoffsubstituierender Technologien investieren. Langfristige Lieferverträge mit nicht-chinesischen Produzenten sollten gesichert werden, auch wenn sie teurer sind. Die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern in Pre-Competitive-Konsortien für Rohstoffbeschaffung und Recycling kann Skaleneffekte schaffen und Risiken teilen.
Für Investoren bietet die Rohstoffwende Chancen und Risiken. Unternehmen, die Bergbau, Raffinierung oder Recycling betreiben, werden von der Nachfrage profitieren, tragen aber auch hohe regulatorische und operative Risiken. Technologieunternehmen, die Substitutionslösungen entwickeln, könnten Durchbrüche erzielen oder an technischen Grenzen scheitern. Die politische Dimension macht Investitionen in kritische Rohstoffe komplexer als in anderen Sektoren. Staatliche Förderungen und Regulierungen können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Die langfristige Bedeutung des Themas kann nicht überschätzt werden. Kritische Rohstoffe sind das Fundament der Energiewende, der Digitalisierung und der Verteidigungsfähigkeit. Ohne sichere Versorgung scheitert die europäische Klimapolitik, die digitale Souveränität bleibt Illusion und die strategische Autonomie unerreichbar. Die Abhängigkeit von China ist existenziell bedrohlicher als die Abhängigkeit von russischer Energie, weil Substitution schwieriger und die Nachfrage strukturell steigend ist.
Der historische Vergleich mit früheren Rohstoffkrisen lehrt, dass Transformationen möglich sind, aber Zeit brauchen. Die Ölkrisen der 1970er Jahre führten zur Diversifizierung der Energieversorgung, zu Effizienzsteigerungen und zum Aufbau strategischer Reserven. Der Prozess dauerte Jahrzehnte. Die Krise der Halbleiterversorgung während der Covid-Pandemie führte zu Investitionen in europäische Chipfabriken, deren Wirkung erst in den 2030er Jahren sichtbar wird. Die Rohstoffwende folgt demselben Muster: Die Entscheidungen von heute bestimmen die Versorgungssicherheit von morgen.
Die geopolitische Dimension macht die Herausforderung komplexer. Europa muss gleichzeitig mit China konkurrieren, kooperieren und konfrontieren. Ein totaler Bruch ist weder möglich noch wünschenswert, weil China Absatzmarkt, Technologiepartner und Rohstofflieferant bleibt. Die Balance zwischen Abhängigkeitsreduktion und konstruktiver Beziehung ist die zentrale diplomatische Aufgabe der nächsten Dekade. Der RESourceEU-Plan ist nicht als Kriegserklärung an China zu verstehen, sondern als Versicherungspolice gegen strategische Erpressung.
Die abschließende Bewertung fällt ambivalent aus. Der RESourceEU-Plan ist notwendig, überfällig und in seinen Grundzügen richtig. Die Kombination aus Diversifizierung, Recycling, heimischer Produktion und internationalen Partnerschaften ist der einzige Weg zu mehr Resilienz. Doch die Umsetzung steht noch aus. Die Geschichte ist voll von gut gemeinten Plänen, die an politischem Widerstand, finanziellen Engpässen oder technischen Hindernissen scheiterten. Europas Erfolg hängt davon ab, ob der politische Wille über Legislaturperioden hinweg Bestand hat, ob die notwendigen Investitionen getätigt werden und ob die Bevölkerung bereit ist, höhere Kosten und Umweltbelastungen zu akzeptieren.
Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend. Wenn Europa bis 2030 keine substantiellen Fortschritte macht, wird die chinesische Dominanz zementiert. Die Energiewende wird teurer, langsamer und abhängiger von einem Land, das Rohstoffe als Waffe einsetzt. Die strategische Autonomie bleibt unerreichbar. Doch wenn Europa jetzt entschlossen handelt, kann die Abhängigkeit graduell reduziert werden. Vollständige Unabhängigkeit ist weder möglich noch nötig. Resilienz durch Diversifizierung ist das realistische Ziel. Der RESourceEU-Plan ist der erste Schritt auf einem langen Weg. Ob Europa diesen Weg bis zum Ende geht, entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit des Kontinents.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen