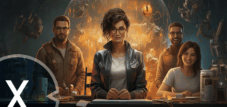“Digital by Default” in der EU soll bei der Entbürokratisierung helfen – Die digitale Verwaltungsrevolution
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 18. Oktober 2025 / Update vom: 18. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

‘Digital by Default’ in der EU soll bei der Entbürokratisierung helfen – Die digitale Verwaltungsrevolution – Bild: Xpert.Digital
Digital statt Papier: Die EU revolutioniert die Produktdokumentation
Der Paradigmenwechsel: Was “Digital by Default” für Europa bedeutet
Die Europäische Union steht vor einem entscheidenden Paradigmenwechsel in der Produktdokumentation. Mit der Annahme des Omnibus-IV-Pakets durch den Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten im September 2025 hat die EU den Grundstein für eine umfassende Digitalisierung der Produktinformation gelegt. Der Grundsatz “Digital by Default” soll künftig die bestehenden physischen Anforderungen an Dokumentationen und Gebrauchsanleitungen ersetzen. Diese Entscheidung ist weit mehr als eine technische Anpassung bestehender Vorschriften – sie markiert einen fundamentalen Wandel im Verhältnis zwischen Herstellern, Verbrauchern und regulatorischen Anforderungen.
Das verabschiedete Paket zielt darauf ab, 20 verschiedene EU-Produktrichtlinien im Rahmen der Binnenmarktregeln zu digitalisieren und in Bezug auf gemeinsame Spezifikationen anzupassen. Die zentralen Änderungen umfassen die Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung, digitale Austauschprozesse zwischen nationalen Behörden und Wirtschaftsakteuren sowie die Erlaubnis für Hersteller, Gebrauchsanweisungen ausschließlich in digitaler Form bereitzustellen. Ergänzt wird dies durch die Einführung eines digitalen Kontaktpunkts für Unternehmen, der die Kommunikation mit Behörden vereinfachen soll.
Die Relevanz dieser Entwicklung erstreckt sich über mehrere Dimensionen. Aus wirtschaftlicher Perspektive verspricht die Digitalisierung erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen. Die EU-Kommission kalkuliert, dass europäische Unternehmen durch das gesamte Omnibus-Paket zusätzliche 400 Millionen Euro einsparen können. Aus ökologischer Sicht trägt die Maßnahme zur Ressourcenschonung bei, da der Papierverbrauch in der industriellen Dokumentation erheblich ist. Gleichzeitig wirft die Initiative grundlegende Fragen zur digitalen Teilhabe, zum Verbraucherschutz und zur Barrierefreiheit auf.
Die dänische Ministerin für europäische Angelegenheiten, Marie Bjerre, begrüßte die Einigung im Namen der Ratspräsidentschaft mit den Worten, dass zu viele europäische Unternehmen zu viel Zeit mit der Bewältigung komplexer Vorschriften verbringen würden. Diese Aussage verdeutlicht die politische Dimension der Reform: Die Entbürokratisierung wird als zentrales Element zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Der vorliegende Artikel analysiert diese Entwicklung systematisch, beleuchtet ihre historischen Wurzeln, technischen Mechanismen und praktischen Auswirkungen und unterzieht sie einer kritischen Bewertung hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken.
Vom E-Government zum digitalen Produkt: Der Weg zur heutigen Reform
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und regulatorischer Prozesse ist kein plötzliches Phänomen, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung. Die Wurzeln des E-Government in Europa reichen bis in die 1990er Jahre zurück, als erste Initiativen zur elektronischen Verwaltung entstanden. Ein Meilenstein war die Lissabon-Strategie des Europäischen Rates im Jahr 2000, die das Ziel formulierte, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.
Die Malmöer Erklärung von 2009 bildete einen weiteren entscheidenden Wendepunkt. In dieser Erklärung verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten, potenzielle Mitglieder der EU und die EFTA-Staaten darauf, die Transparenz staatlichen Handelns zu erhöhen, den Zugang zu öffentlichen Informationen zu erleichtern und die Partizipation am staatlichen Handeln zu verbessern. Diese Verpflichtung bildete die Grundlage für die europäische E-Government-Strategie, die im E-Government Aktionsplan 2011-2015 und in der Digitalen Agenda für Europa festgeschrieben wurde.
In Deutschland wurde das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, kurz E-Government-Gesetz, im August 2013 verabschiedet. Dieses Gesetz verpflichtete die Verwaltung unter anderem dazu, einen elektronischen Zugang zu eröffnen, und erleichterte das Erbringen elektronischer Nachweise sowie die elektronische Bezahlung in Verwaltungsverfahren. Parallel dazu entwickelten sich in verschiedenen Mitgliedstaaten nationale Initiativen zur Digitalisierung. Dänemark nahm dabei häufig eine Vorreiterrolle ein. Mit der Einführung von MitID und dem Vorgängersystem gibt es in Dänemark heute praktisch keinen Briefverkehr und praktisch keine Behördengänge mehr.
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie schuf weitere europarechtliche Rahmenbedingungen zur Entwicklung nationaler E-Government-Lösungen. Neben der Vereinfachung von Verwaltungsverfahren und der Etablierung eines einheitlichen Ansprechpartners wurde hier auch die Einführung der elektronischen Verfahrensabwicklung vereinbart. Diese Entwicklungen legten den Grundstein für die spätere Ausweitung digitaler Standards auf den Produktbereich.
Im Kontext der Produktdokumentation spielte die Entwicklung internationaler Standards eine zentrale Rolle. Die Norm IEC 61406 (DIN SPEC 91406) legte die Technologie für die Identifikation von physischen Objekten mithilfe digitaler Typenschilder und UIDs (Unique Identifier) fest. Die VDI Richtlinie 2770 definierte, wie Herstellerinformationen hinsichtlich Eigenschaft, Struktur, Umfang, Inhalt und Datenformat auszusehen haben. Diese Standards bildeten die technische Grundlage für die digitale Produktdokumentation, die später in gesetzliche Anforderungen übersetzt wurde.
Die COVID-19-Pandemie wirkte als Katalysator für die Digitalisierung. Sie offenbarte die Schwächen papierbasierter Systeme und verdeutlichte die Notwendigkeit digitaler Alternativen. In diesem Kontext intensivierte die EU ihre Bemühungen um Entbürokratisierung und Digitalisierung. Die Europäische Kommission kündigte 2024 eine Simplifizierungsagenda an, die mehrere Omnibus-Pakete umfasst. Das Omnibus-IV-Paket, das die Digitalisierung der Produktdokumentation regelt, ist Teil dieser umfassenderen Strategie zur Reduzierung bürokratischer Belastungen und zur Harmonisierung des digitalen Rahmenwerks.
Die Bausteine der Reform: Von QR-Codes bis zum Cyber Resilience Act
Das Omnibus-IV-Paket basiert auf mehreren technischen und rechtlichen Mechanismen, die im Zusammenspiel die Digitalisierung der Produktdokumentation ermöglichen. Der erste zentrale Baustein ist die rechtliche Verankerung des Prinzips “Digital by Default”. Dieses Prinzip kehrt die bisherige Praxis um: Während bisher Papierdokumente die Regel und digitale Versionen die Ausnahme waren, sollen künftig digitale Dokumente der Standard sein. Nur in begründeten Ausnahmefällen müssen Unternehmen anderen Firmen, Kunden in der Verwaltung oder Verbrauchern Druckmaterial zur Verfügung stellen.
Die Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung bildet einen weiteren wesentlichen Baustein. Die EU-Konformitätserklärung ist ein zwingend notwendiges Dokument, mit dem Hersteller oder ihre bevollmächtigten Vertreter erklären, dass ihre Produkte den EU-Anforderungen entsprechen. Mit der Unterzeichnung der Konformitätserklärung übernehmen sie die volle Verantwortung dafür, dass ihr Produkt dem geltenden EU-Recht entspricht. Die Digitalisierung dieser Erklärung ermöglicht eine schnellere Verbreitung, leichtere Aktualisierung und effizientere Überprüfung durch Marktüberwachungsbehörden.
Ein drittes Element sind die digitalen Austauschprozesse zwischen nationalen Behörden und Wirtschaftsakteuren. Diese Prozesse basieren auf standardisierten Schnittstellen und Datenformaten, die eine nahtlose Kommunikation ermöglichen sollen. Die bereits erwähnte VDI Richtlinie 2770 spielt hier eine zentrale Rolle, indem sie definiert, wie Herstellerinformationen strukturiert sein müssen, damit sie zwischen verschiedenen Akteuren ausgetauscht werden können. Die Daten werden im XML-Format erstellt und in definierten Dokumentationscontainern abgelegt.
Die Erlaubnis für Hersteller, Gebrauchsanweisungen ausschließlich in digitaler Form bereitzustellen, wird durch technische Lösungen unterstützt. Eine gängige Methode ist die Verwendung von QR-Codes, die direkt am Produkt angebracht werden. Diese QR-Codes ermöglichen es Nutzern, mit einem Smartphone oder Tablet direkt auf die digitale Dokumentation zuzugreifen. Die Dokumentation kann auf einer Cloud-Plattform gespeichert sein, die vom Hersteller oder vom Kunden betrieben wird. Diese Lösung bietet den Vorteil, dass die Dokumentation jederzeit aktualisiert werden kann, ohne dass physische Dokumente ausgetauscht werden müssen.
Der digitale Kontaktpunkt für Unternehmen soll als zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation mit Behörden dienen. Dieses Konzept ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Vereinfachung der Verwaltungsinteraktion. Die Idee ist, dass Unternehmen nicht mehr mit einer Vielzahl verschiedener Behörden einzeln kommunizieren müssen, sondern alle Anfragen und Meldungen über einen zentralen Punkt abwickeln können.
Parallel zum Omnibus-IV-Paket sind weitere regulatorische Entwicklungen zu beachten, die die Digitalisierung der Produktdokumentation beeinflussen. Der Cyber Resilience Act (CRA), der im Dezember 2024 in Kraft getreten ist, führt umfassende Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen ein. Für diese Produkte ist eine EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung erforderlich, um die Einhaltung der Anforderungen zu belegen. Die Verbindung zwischen der Digitalisierung der Dokumentation und den Cybersicherheitsanforderungen ist offensichtlich: Wenn Dokumentation ausschließlich digital bereitgestellt wird, müssen die Systeme, über die sie zugänglich ist, gegen Cyberangriffe geschützt sein.
Ein weiterer Baustein ist die Anpassung der Unternehmenskategorisierung. Das Omnibus-IV-Paket führt die Kategorie der Small Mid-Caps (SMCs) ein, die Unternehmen mit mehr als 249 und weniger als 750 Mitarbeitenden umfasst, sofern sie entweder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und weniger als 150 Millionen Euro erwirtschaften oder eine Bilanzsumme von über 43 Millionen Euro und weniger als 129 Millionen Euro aufweisen. Diese neue Kategorie profitiert von bestimmten Erleichterungen, etwa im Bereich des Datenschutzes. So soll die Ausnahme von der Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DSGVO, die bisher für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern galt, auf Unternehmen mit bis zu 750 Mitarbeitern ausgeweitet werden.
Zwischen Rat und Parlament: Der aktuelle Stand des Gesetzgebungsverfahrens
Im Oktober 2025 befindet sich die Initiative zur Digitalisierung der Produktdokumentation in einer entscheidenden Phase. Der Rat der Europäischen Union hat am 25. September 2025 seine Position zum Omnibus-IV-Paket verabschiedet. Das Europäische Parlament muss nun seinen eigenen Standpunkt erarbeiten, bevor die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission beginnen können. Diese Verhandlungen werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 starten und sich bis 2026 ziehen.
Die Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten soll laut Ratsposition auf 24 Monate verlängert werden. Dies bedeutet, dass nach Verabschiedung der endgültigen Richtlinie die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Für Unternehmen ergibt sich daraus ein klarer Zeitplan: Sie müssen ihre Systeme und Prozesse entsprechend anpassen, um ab dem Stichtag die digitale Bereitstellung von Dokumentationen als Standard zu gewährleisten.
Der aktuelle Kontext ist geprägt von einer intensiven Debatte über die Balance zwischen Bürokratieabbau und Verbraucherschutz. Der Ministerrat hat die Stoßrichtung im Wesentlichen beibehalten, aber Klarstellungen zum Zugang zu digital verfügbaren Informationen vorgenommen. Um den Verbraucherschutz zu gewährleisten, müssen sicherheitsrelevante Informationen weiter in Papierform verfügbar sein, wenn die Gefahr eines ernsten Schadens für Konsumenten besteht. Diese Einschränkung ist von zentraler Bedeutung, da sie verhindert, dass kritische Sicherheitsinformationen ausschließlich digital bereitgestellt werden.
In der Wirtschaft herrscht überwiegend Zustimmung zu den Digitalisierungsplänen. Der Bitkom, der Digitalverband Deutschlands, hat die Initiative grundsätzlich begrüßt und darauf hingewiesen, dass die Flut neuer EU-Vorgaben für mehr regulatorische Komplexität in der digitalen Wirtschaft gesorgt hat. Die Wirtschaft erhofft sich von der Digitalisierung nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch Effizienzgewinne durch schnellere Prozesse und bessere Durchsuchbarkeit von Dokumenten.
Die technische Umsetzung ist in vielen Branchen bereits weit fortgeschritten. Unternehmen wie KSB im Pumpenbau haben bereits vor Jahren begonnen, ihre Produkte mit QR-Codes auszustatten, die den Zugang zu digitalen Zwillingen ermöglichen. Diese digitalen Zwillinge enthalten alle Daten rund um Auslegung, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung sowie Hinweise zu Wartung und Instandhaltung. Im Laufe des Lebenszyklus können diese Informationen erweitert werden. Solche Systeme entsprechen bereits weitgehend den Anforderungen, die das Omnibus-IV-Paket stellen wird.
Die Verbindung zur Industrie 4.0 ist offensichtlich. Die Digitalisierung der Produktdokumentation ist ein Baustein der umfassenderen Vision einer vollständig vernetzten Produktionsumgebung. In einer intelligenten Fabrik sollten alle Informationen zu Anlagenkomponenten jederzeit digital abrufbar sein. Die regulatorische Vorgabe zur digitalen Dokumentation verstärkt diesen Trend und schafft Anreize für Investitionen in entsprechende Infrastrukturen.
Parallel zur Digitalisierung der Produktdokumentation laufen weitere Digitalisierungsinitiativen der EU. Das digitale Omnibus-Paket, das für Ende 2025 angekündigt wurde, zielt auf die Vereinfachung bestehender Digitalvorschriften in den Bereichen Daten, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz ab. Die EU-Kommission plant etwa eine Überarbeitung der KI-Verordnung, um deren Anwendung in der Praxis zu erleichtern. Im Datenrecht sollen das Daten-Governance-Gesetz, die Verordnung über den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten sowie die Richtlinie über offene Daten stärker verzahnt werden. Diese verschiedenen Initiativen verstärken sich gegenseitig und bilden ein kohärentes Gesamtbild einer digitalisierten europäischen Wirtschaft.
Die Digitalisierung in Aktion: Anwendungsbeispiele aus der Industrie
Die praktische Umsetzung der digitalen Produktdokumentation lässt sich anhand mehrerer konkreter Beispiele illustrieren. Das erste Beispiel stammt aus dem Maschinenbau. Der Pumpenhersteller KSB hat ein System nach IEC 61406 (DIN SPEC 91406) implementiert, bei dem jede Pumpe einen individuellen QR-Code erhält, der direkt auf dem Produkt angebracht ist. Dieser QR-Code enthält einen Unique Identifier (UID) und öffnet einen Link zum digitalen Zwilling des Produkts. Der digitale Zwilling beinhaltet ab Werk alle relevanten Daten: technische Spezifikationen, Auslegungsparameter, Installationsanleitungen, Bedienungshinweise sowie Wartungs- und Instandhaltungsinformationen.
Die Vorteile dieses Systems sind vielfältig. Techniker können vor Ort mit ihrem Smartphone oder Tablet direkt auf die aktuellste Version der Dokumentation zugreifen, ohne schwere Ordner mitführen zu müssen. Die Dokumentation ist immer auf dem neuesten Stand, da sie zentral gepflegt wird. Wenn ein Hersteller eine Aktualisierung vornimmt, etwa weil ein neues Wartungsverfahren entwickelt wurde, steht diese Information sofort allen Nutzern zur Verfügung. Im Laufe des Lebenszyklus können weitere Informationen hinzugefügt werden, beispielsweise Zustandsdaten von Sensoren oder Berichte über durchgeführte Wartungen. So entsteht eine vollständige digitale Dokumentation der gesamten Lebensgeschichte des Produkts.
Ein zweites Beispiel stammt aus der Entsorgungsindustrie. Ein Unternehmen, das mit der Entsorgung gefährlicher Werkstücke befasst ist, hat ein QR-Code-basiertes System zur Prozesssteuerung eingeführt. Die Werkstücke durchlaufen mehrstufige Prozesse, bei denen sie in ihre Einzelbestandteile zerlegt und schließlich vernichtet werden. Die Variantenvielfalt ist hoch, und aus Sicherheits- und Abrechnungsgründen muss jeder Prozessschritt einzeln nachgewiesen werden. Das neue System ermöglicht ein Tracking der Werkstücke in Echtzeit. Jedes Werkstück erhält einen QR-Code, der an verschiedenen Stationen im Prozess gescannt wird. Dadurch ist jederzeit bekannt, wo sich welches Werkstück befindet und welche Bearbeitungsschritte bereits durchgeführt wurden.
Die Messungen in der Anlaufphase zeigten eine Senkung der Kosten für die Nachweisführung zwischen 20 und 30 Prozent. Hinzu kommen qualitative Vorteile wie die deutlich verbesserte Sicherheitslage in der Entsorgung. Die Verfolgbarkeit in Echtzeit ermöglicht es, schnell auf Probleme zu reagieren und die Abläufe kontinuierlich zu optimieren. Dieses Beispiel zeigt, dass die Digitalisierung der Dokumentation nicht nur den Zugang zu Informationen erleichtert, sondern auch grundlegende Verbesserungen in der Prozesssteuerung ermöglicht.
Ein drittes Beispiel betrifft die Pharmaindustrie, wo die Dokumentation besonders streng reguliert ist. Hier müssen Hersteller umfangreiche Dossiers über ihre Produkte führen, die alle Aspekte von der Entwicklung über die Produktion bis zur Anwendung abdecken. Die Digitalisierung dieser Dossiers ermöglicht es Behörden, Zulassungen schneller zu erteilen, da die Informationen strukturiert und durchsuchbar vorliegen. Änderungen an der Dokumentation können effizient verfolgt werden, da Versionierungssysteme automatisch dokumentieren, wann welche Änderung von wem vorgenommen wurde. Dies erhöht die Transparenz und erleichtert Audits.
In der Praxis stellt sich jedoch auch die Frage, wie Unternehmen den Übergang von papierbasierter zu digitaler Dokumentation bewältigen. Ein Ansatz ist die sukzessive Digitalisierung. Unternehmen beginnen mit neuen Produkten, die ab einem bestimmten Stichtag mit digitaler Dokumentation ausgeliefert werden. Für bestehende Produkte werden die Papierdokumente nach und nach digitalisiert. Spezialisierte Dienstleister bieten Scan-Services an, bei denen komplette Produktionsanlagen oder einzelne Handbücher digitalisiert und strukturiert werden. Die Kosten für die Erstellung eines digitalisierten Handbuchs mit 100 Seiten liegen bei etwa 5 Euro pro Seite. Für die Konvertierung von 30 voll gefüllten Ordnern einer technischen Anlage in eine strukturierte digitale Dokumentation fallen Kosten von etwa 600 Euro pro Ordner an.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Digital by Default: Wer profitiert – und wer bleibt ausgeschlossen?
Hürden und Bedenken: Eine kritische Analyse der Digitalisierungspläne
Trotz der offensichtlichen Vorteile der Digitalisierung gibt es berechtigte Bedenken und Kontroversen, die eine differenzierte Betrachtung erfordern. Ein zentrales Problem ist die digitale Spaltung. Nicht alle Bevölkerungsgruppen haben gleichermaßen Zugang zu digitalen Technologien oder die Fähigkeit, diese zu nutzen. Ältere Menschen, Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Menschen im ländlichen Raum, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen sind besonders gefährdet, von digitalen Angeboten ausgeschlossen zu werden.
Untersuchungen zur digitalen Teilhabe zeigen, dass die Digitalisierung für ältere Menschen zu einem gesellschaftlichen Problem werden kann, wenn Zugangsbarrieren nicht beseitigt werden. Die Alltagsrelevanz der Digitalisierung nimmt zu, da immer mehr öffentliche Dienstleistungen und Informationen ausschließlich online vorgehalten werden. Wenn auch Produktdokumentationen nur noch digital verfügbar sind, kann dies dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen Produkte nicht mehr sicher nutzen können, weil sie keinen Zugang zu den Gebrauchsanleitungen haben.
Die im Omnibus-IV-Paket vorgesehene Ausnahme, dass sicherheitsrelevante Informationen weiter in Papierform verfügbar sein müssen, wenn die Gefahr eines ernsten Schadens für Konsumenten besteht, mildert dieses Problem nur teilweise. Zum einen ist die Definition dessen, was als ernster Schaden gilt, auslegungsbedürftig. Zum anderen betrifft die Regelung nur sicherheitsrelevante Informationen, nicht aber andere wichtige Inhalte wie Bedienungsanleitungen oder Wartungshinweise.
Ein zweites Problem betrifft die Abhängigkeit von funktionierender Infrastruktur. Digitale Dokumentation setzt voraus, dass Nutzer Zugang zum Internet haben und über ein funktionsfähiges Endgerät verfügen. In Notfallsituationen, etwa bei Stromausfällen, kann der Zugang zu digitaler Dokumentation eingeschränkt oder unmöglich sein. Stromausfälle können zu Datenverlusten führen, insbesondere wenn Server und Speichersysteme nicht durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen geschützt sind. Bei Unternehmen, die keine ausreichenden Backup-Systeme unterhalten, kann ein Stromausfall dazu führen, dass kritische Dokumentationen vorübergehend oder dauerhaft unzugänglich werden.
Die Cybersicherheit stellt eine weitere Herausforderung dar. Wenn Dokumentation ausschließlich digital bereitgestellt wird, entstehen neue Angriffsvektoren für Cyberkriminelle. Ein Hackerangriff auf die Systeme eines Herstellers könnte dazu führen, dass Dokumentationen manipuliert oder gelöscht werden. Der Cyber Resilience Act adressiert diese Risiken durch umfassende Cybersicherheitsanforderungen, aber die Umsetzung dieser Anforderungen erfordert erhebliche Investitionen und Expertise.
Datenschutzrechtliche Bedenken sind ebenfalls relevant. Wenn Nutzer auf digitale Dokumentationen zugreifen, können dabei personenbezogene Daten erfasst werden, etwa IP-Adressen, Zeitpunkte des Zugriffs oder Nutzerverhalten. Hersteller könnten diese Daten für verschiedene Zwecke nutzen, etwa für Marketing oder zur Produktverbesserung. Ohne klare Regelungen und wirksame Kontrollmechanismen besteht die Gefahr eines Missbrauchs. Die vorgesehenen Änderungen an der DSGVO, die die Dokumentationspflichten für KMU und SMCs reduzieren sollen, könnten paradoxerweise die Transparenz und Rechenschaftspflicht im Umgang mit personenbezogenen Daten verringern.
Aus Sicht von Verbraucherschutzorganisationen besteht die Gefahr, dass die Vereinfachung der Dokumentationspflichten auf Kosten des Verbraucherschutzes geht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich kritisch zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierungsagenda geäußert und betont, dass Vereinfachungen nicht auf Kosten des Verbraucherschutzes gehen dürfen. Konkret wird befürchtet, dass die Reduzierung bürokratischer Anforderungen dazu führen könnte, dass wichtige Informationen nicht mehr oder nur unzureichend bereitgestellt werden.
Die Kostenfrage ist differenziert zu betrachten. Während Unternehmen von Einsparungen bei Druck und Versand profitieren, entstehen neue Kosten für die Entwicklung und den Betrieb digitaler Systeme. Die Digitalisierung eines Unternehmens kann erhebliche Investitionen erfordern. Einfache Projekte beginnen bei etwa 5000 Euro, aufwendigere Digitalisierungsprojekte können 25000 Euro oder mehr kosten. Die laufenden Betriebskosten für Hosting, Wartung und Support kommen hinzu. Für kleine und mittlere Unternehmen können diese Kosten eine erhebliche Belastung darstellen, auch wenn sie langfristig durch Effizienzgewinne kompensiert werden sollen.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Lesbarkeit und Nutzbarkeit digitaler Dokumentationen. Nicht alle Nutzer empfinden es als komfortabel, Anleitungen auf kleinen Bildschirmen zu lesen. Bei komplexen Produkten, die ausführliche Dokumentationen erfordern, kann die Navigation durch umfangreiche digitale Dokumente schwieriger sein als das Durchblättern eines gedruckten Handbuchs. Die Qualität der digitalen Benutzererfahrung hängt stark von der Gestaltung der digitalen Plattformen ab. Schlecht gestaltete Systeme können die Akzeptanz bei den Nutzern untergraben.
Was kommt als Nächstes? Trends von KI bis zum Digitalen Produktpass
Die Digitalisierung der Produktdokumentation ist Teil eines umfassenderen Trends, der in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen wird. Ein zentraler Trend ist die Weiterentwicklung des Digitalen Produktpasses. Der Digitale Produktpass soll langfristig die Konformitätserklärung ersetzen und Produktinformationen sowie Konformitätsnachweise effizient und leicht zugänglich bereitstellen. Er wird die Rückverfolgbarkeit verbessern und den Überblick über die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen erleichtern. Dies soll die Produktsicherheit weiter erhöhen und die Verwaltung der Nachweise vereinfachen.
Der Digitale Produktpass wird voraussichtlich nicht nur Dokumentationen enthalten, sondern auch Daten zur Nachhaltigkeit des Produkts, etwa Informationen über verwendete Materialien, Energieverbrauch im Produktionsprozess und Recyclingfähigkeit. Diese Informationen werden für Verbraucher, Behörden und Recyclingunternehmen gleichermaßen relevant sein. Die EU-Kommission arbeitet an der Ausgestaltung entsprechender Standards, die voraussichtlich in den kommenden Jahren schrittweise eingeführt werden.
Ein weiterer Trend ist die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz in Dokumentationssysteme. KI-gestützte Assistenten könnten Nutzern helfen, die für sie relevanten Informationen schnell zu finden, indem sie natürlichsprachige Anfragen verarbeiten und kontextabhängige Antworten liefern. Statt manuell durch lange Handbücher zu suchen, könnten Nutzer einfach fragen: “Wie warte ich die Pumpe?” und würden die entsprechenden Anweisungen präsentiert bekommen. Solche Systeme könnten auch mehrsprachige Übersetzungen in Echtzeit bereitstellen, was die grenzüberschreitende Nutzung von Produkten erleichtert.
Die Entwicklung von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Technologien eröffnet neue Möglichkeiten für interaktive Dokumentationen. Statt zweidimensionale Zeichnungen oder Videos anzuschauen, könnten Nutzer dreidimensionale Modelle des Produkts in AR betrachten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt auf das reale Produkt projiziert bekommen. Dies könnte besonders bei komplexen Wartungs- oder Reparaturarbeiten hilfreich sein. Mehrere Unternehmen experimentieren bereits mit solchen Lösungen, und mit zunehmender Verbreitung von AR-fähigen Geräten wie Smart Glasses dürfte die Akzeptanz steigen.
Die europäische Digitalisierungsagenda wird sich voraussichtlich weiter intensivieren. Das für Ende 2025 angekündigte digitale Omnibus-Paket wird weitere Vereinfachungen im Bereich der digitalen Gesetzgebung bringen. Die EU-Kommission plant einen umfassenden Digital Fitness Check, mit dem die Wechselwirkungen der zahlreichen neuen Gesetze geprüft und weiterer Vereinfachungsbedarf ermittelt werden soll. Dies deutet darauf hin, dass die Digitalisierung nicht als einmaliges Projekt, sondern als kontinuierlicher Prozess verstanden wird.
Im Bereich der Cybersicherheit sind weitere Verschärfungen zu erwarten. Die Erfahrungen mit dem Cyber Resilience Act werden zeigen, wo Nachbesserungsbedarf besteht. Es ist wahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Sicherheit digitaler Dokumentationssysteme im Laufe der Zeit steigen werden, insbesondere wenn Sicherheitsvorfälle auftreten. Die Europäische Agentur für Cybersicherheit (ENISA) wird eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entwicklung von Standards und der Überwachung der Implementierung spielen.
Die Trilogverhandlungen zum Omnibus-Paket I, die Änderungen an der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) betreffen, laufen parallel und werden voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen werden die Rahmenbedingungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung prägen und könnten auch Auswirkungen auf die Produktdokumentation haben, etwa wenn Nachhaltigkeitsinformationen in die digitalen Produktpässe integriert werden müssen.
Ein potenzieller Umbruch könnte durch technologische Entwicklungen im Bereich der dezentralen Systeme ausgelöst werden. Blockchain-Technologie könnte genutzt werden, um manipulationssichere digitale Dokumentationen zu erstellen, bei denen jede Änderung transparent nachvollziehbar ist. Dies würde das Vertrauen in digitale Dokumentationen erhöhen und könnte besonders in stark regulierten Branchen wie der Pharma- oder Luftfahrtindustrie relevant werden.
Die Entwicklung der europäischen digitalen Identität (eIDAS 2.0) wird die Grundlage für sichere digitale Transaktionen schaffen. Bis Herbst 2026 sind alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, ihren Bürgern digitale Brieftaschen bereitzustellen, in denen Dokumente wie der Personalausweis oder der Führerschein in elektronischer Form gespeichert werden können. Diese Infrastruktur könnte auch für die Authentifizierung beim Zugriff auf geschützte Produktdokumentationen genutzt werden, etwa wenn bestimmte Informationen nur autorisierten Fachkräften zugänglich sein sollen.
Die ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung werden zunehmend in den Fokus rücken. Während die Einsparung von Papier positiv ist, verursacht die digitale Infrastruktur selbst einen erheblichen Energieverbrauch. Rechenzentren, die Cloud-Dienste bereitstellen, gehören zu den größten Stromverbrauchern. Die Frage, wie die Digitalisierung ökologisch nachhaltig gestaltet werden kann, wird in der öffentlichen Debatte an Bedeutung gewinnen. Dies könnte zu Forderungen nach energieeffizienten Systemen und der Nutzung erneuerbarer Energien für Rechenzentren führen.
Fazit: Chancen, Risiken und der europäische Weg
Die Entscheidung der EU, das Prinzip “Digital by Default” für Produktdokumentationen einzuführen, markiert einen Wendepunkt in der europäischen Wirtschaftsregulierung. Die Analyse hat gezeigt, dass diese Entwicklung aus einer jahrzehntelangen Tradition der E-Government-Initiativen erwächst und Teil einer umfassenderen Digitalisierungs- und Entbürokratisierungsagenda ist. Die technischen Mechanismen, von QR-Codes über Cloud-Plattformen bis hin zu standardisierten Datenformaten, sind weitgehend ausgereift und werden bereits von innovativen Unternehmen eingesetzt.
Die praktischen Vorteile der Digitalisierung sind evident. Unternehmen profitieren von Kosteneinsparungen, Effizienzgewinnen und verbesserten Möglichkeiten zur Aktualisierung und Pflege der Dokumentationen. Nutzer erhalten Zugang zu stets aktuellen Informationen, die durchsuchbar und multimedial angereichert sein können. Die Umwelt profitiert von der Reduktion des Papierverbrauchs, auch wenn die ökologischen Auswirkungen der digitalen Infrastruktur berücksichtigt werden müssen.
Gleichzeitig sind die Herausforderungen und Risiken nicht zu unterschätzen. Die digitale Spaltung droht bestimmte Bevölkerungsgruppen zu benachteiligen, wenn nicht wirksame Maßnahmen zur Förderung der digitalen Teilhabe ergriffen werden. Die Abhängigkeit von funktionierender Infrastruktur und die Cybersicherheitsrisiken erfordern erhebliche Investitionen in robuste Systeme. Datenschutzrechtliche Fragen müssen sorgfältig adressiert werden, um Missbrauch zu verhindern. Die Balance zwischen Bürokratieabbau und Verbraucherschutz muss gewahrt werden.
Die Ausnahme für sicherheitsrelevante Informationen, die weiterhin in Papierform verfügbar sein müssen, ist ein wichtiger Schutzmechanismus, der jedoch klar definiert und konsequent umgesetzt werden muss. Die Aufsichtsbehörden werden eine zentrale Rolle bei der Überwachung der Implementierung spielen. Es wird entscheidend sein, dass sie über ausreichende Ressourcen und Kompetenzen verfügen, um ihre Aufgaben effektiv wahrzunehmen.
Die zukünftige Entwicklung wird von mehreren Faktoren abhängen. Technologische Innovationen, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Augmented Reality, werden neue Möglichkeiten für intuitive und nutzerfreundliche Dokumentationen eröffnen. Die europäische Regulierung wird sich weiterentwickeln, und der Digital Fitness Check wird zeigen, wo weitere Anpassungen notwendig sind. Die Erfahrungen mit der Implementierung des Omnibus-IV-Pakets werden wertvolle Erkenntnisse liefern, die in zukünftige Regelungen einfließen können.
Aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet, spiegelt die Digitalisierung der Produktdokumentation einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel wider. Die Frage ist nicht mehr, ob die Digitalisierung kommt, sondern wie sie gestaltet wird. Die Entscheidung für “Digital by Default” ist eine bewusste Weichenstellung in Richtung einer digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Weichenstellung birgt immense Chancen für Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit. Sie erfordert aber auch ein Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken und die Bereitschaft, diese proaktiv zu adressieren.
Die europäische Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung unterscheidet sich von den Ansätzen anderer Weltregionen durch den starken Fokus auf Regulierung und Standards. Während andere Regionen oft auf Selbstregulierung der Wirtschaft setzen, verfolgt die EU einen Ansatz, der klare rechtliche Rahmenbedingungen schafft. Dies kann zu höherer Rechtssicherheit führen, birgt aber auch die Gefahr der Überregulierung. Der Erfolg des Ansatzes wird sich daran messen lassen, ob es gelingt, Innovation zu fördern, ohne die berechtigten Interessen von Verbrauchern und vulnerable Gruppen zu vernachlässigen.
Die dänische Ratspräsidentschaft hat die Digitalisierung und den Bürokratieabbau zu Prioritäten erklärt. Das Motto “Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt” bringt zum Ausdruck, dass die EU sich in einem globalen Wettbewerb behaupten muss. Die Digitalisierung der Produktdokumentation ist ein Baustein in einer umfassenderen Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Diese Strategie muss jedoch inklusiv sein und alle Bevölkerungsgruppen mitnehmen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Einführung von “Digital by Default” bei Produktdokumentationen ein ambitioniertes und weitreichendes Vorhaben ist, das sorgfältig implementiert werden muss. Der Erfolg wird davon abhängen, ob es gelingt, die technischen, rechtlichen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen und ein System zu schaffen, das den Bedürfnissen aller Stakeholder gerecht wird. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die EU mit diesem Ansatz tatsächlich ein wettbewerbsfähigeres Europa schafft, ohne dabei die Werte zu vernachlässigen, auf denen die europäische Integration basiert.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier: