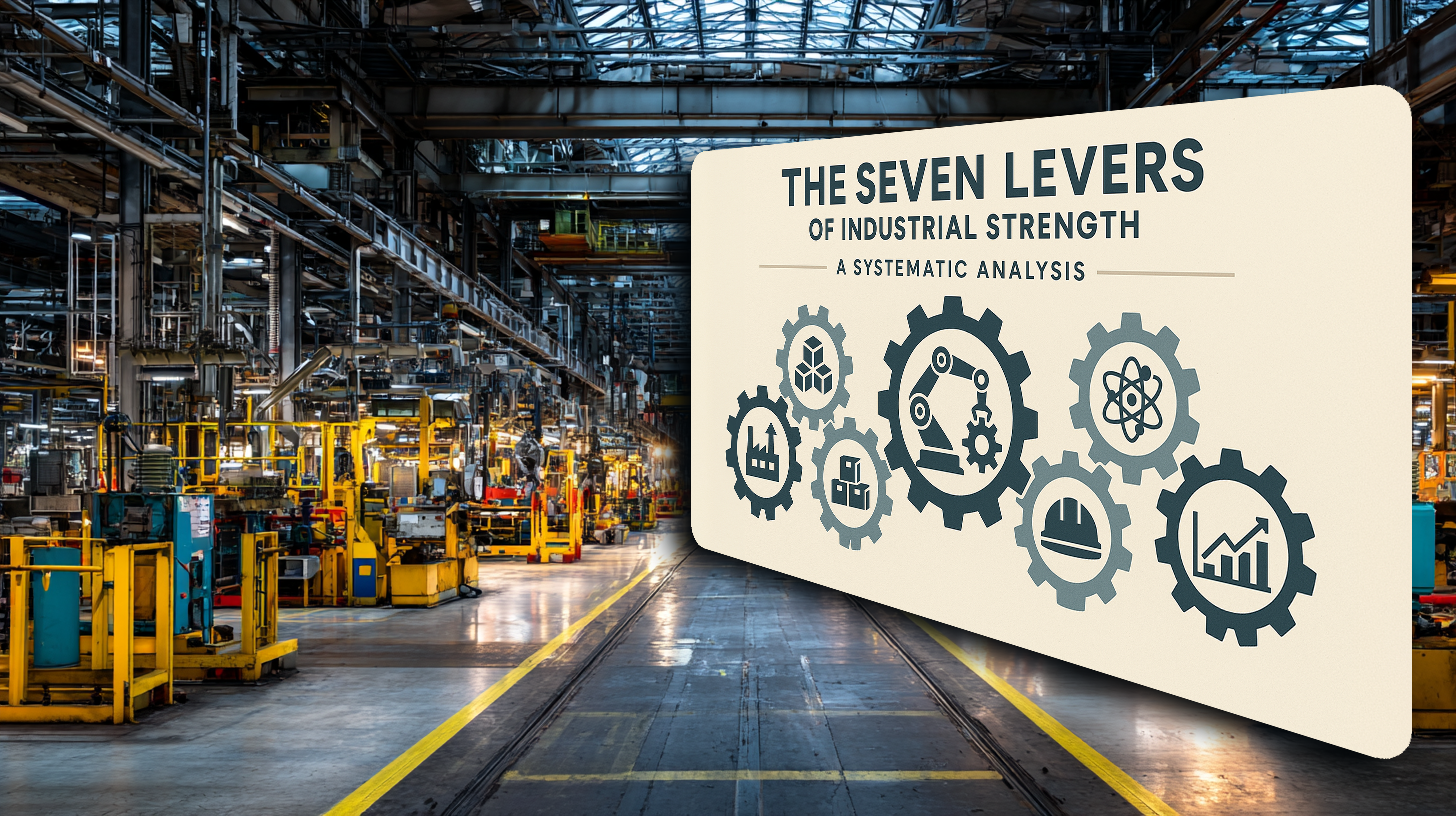
Die Autoindustrie ist im Panikmodus: Europas industrielle Zeitenwende – Wenn Abhängigkeiten zur existenziellen Bedrohung werden – Bild: Xpert.Digital
Vom Just-in-Time-Traum zum Alptraum: Die Achillesferse der EU-Industrie
Strategische Autonomie statt Preiskampf – Europas Chance in der Krise
Am 8. Oktober 2025 bricht die Illusion europäischer Industriestärke zusammen. Ein abrupter Lieferstopp des Halbleiterproduzenten Nexperia, ausgelöst durch eine geopolitische Eskalation zwischen den USA und China, legt binnen Tagen die europäische Automobilindustrie lahm. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz warnen vor drohenden Werksstillständen, Lieferketten reißen, und simple Cent-Artikel werden zum hundertfachen Preis gehandelt. Die Krise legt die Achillesferse des Kontinents schonungslos offen: eine über Jahrzehnte gewachsene, existenzielle Abhängigkeit von globalen Lieferketten und der Fertigung in Fernost. Das Mantra der „Just-in-Time“-Effizienz erweist sich über Nacht als strategische Katastrophe.
Inmitten dieses Panikmodus erhebt eine Stimme eine fundamentale Kritik, die den Kern des Problems trifft. Jana Tischler von Baier & Michels, einem Zulieferer der Würth-Gruppe, bringt die Misere auf den Punkt: Europa habe sich in einem ruinösen Preiskampf selbst geschwächt. „Man feilscht oft um jeden Cent und drückt Preise bis zum Anschlag, nur um sich dann zu wundern, wenn am Ende Wertschöpfung, Know-how und Unabhängigkeit verloren gehen“, so ihre Analyse. Es ist eine Anklage gegen eine kurzsichtige Einkaufspolitik, die langfristige Resilienz für kurzfristige Ersparnisse geopfert hat.
Mehr dazu hier:
Doch Tischler belässt es nicht bei der Diagnose. Ihr Unternehmen widersetzt sich dem vorherrschenden Narrativ von Deindustrialisierung und Standortflucht mit einer kraftvollen Geste: einer Investition von 20 Millionen Euro in eine hochinnovative neue Produktionsstätte am deutschen Standort Ober-Ramstadt. Anstatt die Produktion ins Ausland zu verlagern, setzt Baier & Michels auf technologischen Vorsprung, faire Kalkulation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Diese Entscheidung ist mehr als nur der Bau einer neuen Fabrik. Sie ist ein Gegenentwurf, der die entscheidende Frage unserer Zeit aufwirft: Wie kann Europa seine industrielle Stärke zurückgewinnen? Jana Tischlers Beispiel dient als Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Analyse der sieben entscheidenden Hebel – von strategischer Autonomie bei Schlüsseltechnologien über die Abkehr von reiner Effizienzlogik bis hin zu einem radikalen Bürokratieabbau. Es ist die Suche nach einem neuen Gleichgewicht zwischen globaler Vernetzung und unverzichtbarer Souveränität, bevor andere über Europas wirtschaftliches Schicksal entscheiden.
Der Moment der Wahrheit: Als eine Exportkontrolle die Produktion lahmlegt
Der achte Oktober zweitausendfünfundzwanzig wird in die Annalen der europäischen Industriegeschichte eingehen als jener Tag, an dem die Illusion zerbrach. An diesem Mittwoch wurden die Lieferungen von Nexperia, einem weitgehend unbekannten niederländischen Halbleiterproduzenten, abrupt gestoppt. Was folgte, war keine graduelle Verschlechterung, sondern ein ökonomischer Schock vergleichbar mit den Folgen der Fukushima-Katastrophe von zweitausendelf. Binnen weniger Tage leerten sich die Lager der Großhändler, Halbleiter-Broker verkauften winzige Bauteile, die normalerweise unter zehn Cent kosten, zum hundertfachen Preis. Deutschlands größter Autozulieferer Bosch drosselte in seinem portugiesischen Werk Braga die Produktion und verkürzte Arbeitszeiten. Am Standort Salzgitter drohte Kurzarbeit. Honda halbierte in kanadischen Werken die Produktionsmengen und stellte in Mexiko Fertigungslinien still. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz warnten vor unmittelbar bevorstehenden Werksstillständen.
Passend dazu:
- Der Chip-Schock: Wenn ein Bauteil Europas Industrie lahmlegt – Europas Halbleiterindustrie am Scheideweg
Die Krise offenbarte eine fundamentale Verwundbarkeit des europäischen Wirtschaftsmodells. Nexperia kontrolliert etwa vierzig Prozent des Weltmarktes für diskrete Halbleiter, jene unscheinbaren Dioden, Transistoren und Schutzelemente, die in Steuergeräten Signale verarbeiten, Spannungen regeln und Sensoren ansprechen. Diese Bauteile repräsentieren keine Spitzentechnologie, keine Nanometer-Fertigung modernster Prozessoren. Sie sind das industrielle Äquivalent zu Schrauben und Muttern, technisch simpel, aber absolut unverzichtbar. Ein durchschnittliches Automobil benötigt hunderte solcher Komponenten. Ohne sie bleibt selbst die ausgefeilteste Produktionslinie stehen.
Die Ursache der Versorgungskrise liegt in einer geopolitischen Eskalationsspirale. Im September zweitausendfünfundzwanzig erweiterte das US-amerikanische Handelsministerium die Reichweite seiner Entity List durch eine neue Affiliates Rule. Diese Regelung besagt, dass Unternehmen, die zu mindestens fünfzig Prozent von gelisteten Entitäten kontrolliert werden, automatisch denselben Exportkontrollen unterliegen. Nexperia war zweitausendneunzehn vom chinesischen Technologiekonzern Wingtech übernommen worden. Wingtech wiederum war im Dezember zweitausendvierundzwanzig auf die Entity List gesetzt worden wegen angeblicher Risiken für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Einen Tag nach Inkrafttreten der verschärften Regel am neunundzwanzigsten September aktivierte die niederländische Regierung das selten angewandte Warenbeschaffungsgesetz aus der Ära des Kalten Krieges und übernahm die Kontrolle über Nexperia. Die Begründung lautete, man müsse die Kontinuität und Sicherung kritischen technologischen Wissens auf niederländischem und europäischem Boden gewährleisten.
Pekings Reaktion ließ keine vierundzwanzig Stunden auf sich warten. Das chinesische Handelsministerium verhängte umfassende Exportbeschränkungen für Nexperia-Produkte aus den chinesischen Fertigungsstandorten. Da der überwiegende Teil der Nexperia-Halbleiter in China produziert wird, traf diese Maßnahme die globale Automobilindustrie mit voller Wucht. Die Bestände europäischer und nordamerikanischer Hersteller reichten nach Branchenangaben nur noch für wenige Wochen. Die Suche nach alternativen Lieferanten gestaltete sich schwierig. Zwar existieren grundsätzlich andere Hersteller diskreter Halbleiter, doch deren Kapazitäten können den Ausfall eines Unternehmens mit vierzig Prozent Marktanteil nicht kurzfristig kompensieren. Der Aufbau zusätzlicher Fertigungskapazitäten würde Monate dauern, eine Zeitspanne, die der hochgetakteten Just-in-Time-Produktion moderner Automobilfabriken nicht zur Verfügung steht.
Ende Oktober verschärfte sich die Lage weiter. Nexperia stellte die Lieferung von Wafern, den dünnen Siliziumscheiben, die als Ausgangsmaterial für Halbleiter dienen, an sein Montage- und Testwerk im chinesischen Dongguan ein. Als Begründung nannte Interimschef Stefan Tilger in einem Schreiben an Kunden, das lokale Management habe sich nicht an seine Zahlungsverpflichtungen gehalten. Ob diese Begründung die tatsächlichen Motive vollständig abbildet oder ob hier komplexere Machtkämpfe zwischen europäischem Management und chinesischem Eigentümer ausgetragen werden, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Die unmittelbare Konsequenz jedoch ist eindeutig: Die gesamte Lieferkette droht zu reißen.
Die europäischen Handelsverbände schlugen Alarm. Die European Automobile Manufacturers Association betonte, ohne diese Chips könnten europäische Zulieferer die Teile und Komponenten nicht bauen, die Fahrzeughersteller benötigen. Man finde sich plötzlich in einer alarmierenden Situation wieder und benötige schnelle und pragmatische Lösungen von allen beteiligten Ländern. Sigrid de Vries, Generaldirektorin des Verbands, warnte, es könne Monate dauern, alternative Lieferanten zu finden, während die derzeitigen Vorräte nur noch wenige Wochen reichten. John Bozzella, Chef der amerikanischen Alliance for Automotive Innovation, formulierte es noch drastischer: Wenn die Lieferung von Automobilchips nicht schnell wieder aufgenommen werde, werde dies die Autoproduktion in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern stören und Ausstrahleffekte auf andere Industrien haben. Es sei so bedeutsam.
Passend dazu:
Die Architektur der Abhängigkeit: Wie Europa seine industrielle Autonomie verlor
Die Nexperia-Krise ist kein isoliertes Ereignis, sondern symptomatisch für strukturelle Fehlentwicklungen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Europa produziert heute nur noch acht bis neun Prozent der weltweit hergestellten Mikrochips. Diese extreme Konzentration der Halbleiterfertigung in Asien und Nordamerica ist das Ergebnis bewusster unternehmerischer und politischer Entscheidungen der vergangenen dreißig Jahre. Während Europa in Forschung und Entwicklung investierte, lagerte es systematisch die Fertigung aus. Das schien in einer Welt stabiler geopolitischer Verhältnisse und reibungslos funktionierender globaler Lieferketten rational. Die Produktionskosten in Asien waren niedriger, die Skalierungseffekte größer, die Spezialisierung effizienter.
Doch diese Rechnung beruhte auf Prämissen, die sich als trügerisch erwiesen haben. Sie setzte voraus, dass geopolitische Stabilität eine Konstante sei. Sie ging davon aus, dass Handelsbeziehungen primär nach ökonomischen Kriterien gestaltet würden. Sie unterstellte, dass kritische Abhängigkeiten keine politischen Druckmittel darstellen. Alle drei Annahmen haben sich in den vergangenen fünf Jahren als fundamental falsch erwiesen.
Die COVID-Pandemie zwischen zweitausendneunzehn und zweitausenddreiundzwanzig demonstrierte erstmals die Fragilität global verteilter Wertschöpfungsketten. Als China im Frühjahr zweitausendneunzehn seine Produktionsstätten herunterfuhr, brachen Lieferketten zusammen, die über Jahrzehnte gewachsen waren. Die Blockade des Suezkanals durch das Containerschiff Ever Given im März zweitausendeinundzwanzig legte innerhalb von Tagen das Ausmaß der Verwundbarkeit maritimer Handelsrouten offen. Gut neunzig Prozent aller Güter werden über die Weltmeere transportiert, zumeist in Containern. Im Jahr zweitausendvierundzwanzig erreichte das globale Containervolumen einhundertdreiundachtzig Komma zwei Millionen TEU, ein Wachstum von sechs Komma zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Drei Monate überschritten jeweils sechzehn Millionen TEU, ein historischer Rekord. Die Krise im Roten Meer führte zu Umleitungen um Afrika und ließ die globale Nachfrage nach TEU-Meilen um einundzwanzig Prozent steigen.
Die Abhängigkeit von China erstreckt sich weit über Halbleiter hinaus. China dominiert die weltweite Produktion und Verarbeitung kritischer Rohstoffe. Bei Seltenen Erden, die in Schlüsseltechnologien wie Smartphones, Elektromotoren, Halbleitern und Turbinen verwendet werden, kontrolliert China mehr als sechzig Prozent der globalen Förderung. Noch dramatischer ist die Situation bei der Verarbeitung: Hier liegt Chinas Marktanteil bei über neunzig Prozent. Obwohl Seltene Erden geologisch auch in Brasilien, Indien und Australien vorkommen, hat China durch jahrzehntelange systematische Investitionen in Raffineriekapazitäten eine Quasi-Monopolstellung aufgebaut. Die Gewinnung ist kostspielig, umweltschädlich und erfordert erheblichen Wasser- und Energieeinsatz. China nahm diese Kosten in Kauf und schuf damit strategische Machtpositionen.
Bei Lithium für Batterien, bei Kobalt, bei Nickel, bei Solarzellen zeigt sich dasselbe Muster. Die Abhängigkeit gilt auch für Halbleiter selbst und für Batterien. Während Europa über eigene Vorkommen vieler dieser Rohstoffe verfügt, fehlen die Raffineriekapazitäten. Die Fähigkeit, Rohmaterialien in verwertbare Industriegüter zu transformieren, wurde systematisch nach Asien verlagert. Das größte Risiko besteht dabei in der Verarbeitungs- oder Raffinationsphase, nicht bei der Rohstoffförderung selbst.
Diese Konstellation verschafft China erhebliche geopolitische Hebelwirkung. Als die niederländische Regierung im September zweitausendfünfundzwanzig die Kontrolle über Nexperia übernahm, reagierte Peking binnen Stunden. Die Botschaft war unmissverständlich: Wer europäische Interessen gegen chinesische Unternehmen durchsetzt, dessen Industrie wird den Preis zahlen. Das chinesische Handelsministerium formulierte es explizit: Die unzulässige Intervention der niederländischen Regierung in interne Unternehmensangelegenheiten habe zum derzeitigen Chaos der globalen Produktions- und Lieferketten geführt.
Europa reagierte besorgt, aber weitgehend hilflos. EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen erklärte nach einem Treffen mit Nexperia, es sei offensichtlich, dass Europas Lieferkette nicht über die erforderliche Widerstandsfähigkeit verfüge. Man müsse die notwendigen Lehren daraus ziehen. Konkret bedeute dies, dass Bevorratung und Diversifizierung der Versorgung für die Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung seien. Investitionen in die Versorgungssicherheit seien mit Kosten verbunden, aber der Preis, den man für mangelnde Widerstandsfähigkeit zahlen müsse, sei noch höher.
Diese Einsicht ist richtig, kommt aber spät. Jahrzehntelang galt in Europa die Just-in-Time-Philosophie als Goldstandard effizienter Produktion. Toyota hatte dieses Konzept in den siebziger Jahren eingeführt mit dem Ziel, Lagerkosten durch Minimierung von Beständen zu reduzieren und Waren nur dann zu empfangen, wenn sie im Produktionsprozess benötigt werden. In stabilen Umgebungen reduziert Just-in-Time tatsächlich Abfall und erhöht betriebliche Agilität. Es verlangt jedoch präzise Koordination zwischen Lieferanten, Herstellern und Spediteuren. Jede Störung in der Lieferkette führt unmittelbar zu Produktionsverzögerungen.
In einer fragilen Weltordnung erweist sich diese extreme Effizienzorientierung als Achillesferse. Wie verwundbar Just-in-Time-Systeme sind, demonstriert ein Einkaufsmanager eines deutschen Autozulieferers drastisch: Auf einen Schlag seien die Lieferungen von Nexperia gestoppt worden, das sei wie bei Fukushima gewesen. Binnen weniger Tage seien die Chip-Lager von Großhändlern leergelaufen. Halbleiter-Broker würden die Teile nun zu Höchstpreisen verkaufen, teils zum hundertfachen des früheren Preises. Die Lage sei sehr ernst. Wenn es keine politische Lösung gebe, dann reiße die Lieferkette im November komplett.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Nearshoring, Friendshoring, Reshoring: Einkaufsstrategien gegen China‑Abhängigkeit
Der Preis der Effizienz: Warum deutsche Produktion unter strukturellen Nachteilen leidet
Jana Tischler von Baier & Michels artikuliert in ihrem LinkedIn-Beitrag eine fundamentale Kritik am gegenwärtigen Zustand europäischer Industriepolitik: Europa sei wirtschaftlich nicht in der Lage, mit Fernost mitzuhalten. Man feilsche oft um jeden Cent und drücke Preise bis zum Anschlag, nur um sich dann zu wundern, wenn am Ende Wertschöpfung, Know-how und Unabhängigkeit verloren gingen.
Diese Beobachtung trifft einen neuralgischen Punkt. Die deutsche Industrie leidet unter einem fundamentalen Wettbewerbsnachteil, der sich in den Lohnstückkosten manifestiert. Im Jahr zweitausendvierundzwanzig lagen diese in der deutschen Industrie zweiundzwanzig Prozent über dem Durchschnitt von siebenundzwanzig Industriestaaten. Das bedeutet konkret: Um eine Produktionseinheit herzustellen, mussten deutsche Unternehmen gut ein Fünftel mehr für Löhne und Gehälter aufwenden als der internationale Durchschnitt. Höher waren die Kosten nur in Lettland, Estland und Kroatien.
Dabei gehört die deutsche Industrie nach wie vor zu den produktivsten weltweit. Unter den siebenundzwanzig untersuchten Ländern erreicht Deutschland den siebten Platz. Von den großen Industrieländern weisen nur die Vereinigten Staaten eine höhere Produktivität auf. Allerdings hat Deutschland auch die dritthöchsten Arbeitskosten. In den USA sind die Arbeitskosten zwei Prozent niedriger, während die Produktivität vierundvierzig Prozent höher liegt als in Deutschland.
Seit zweitausendachtzehn sind die Lohnstückkosten in Deutschland mit achtzehn Prozent zwar etwas schwächer gewachsen als im Ausland mit zwanzig Prozent. Doch während die Bruttowertschöpfung im Ausland im Schnitt um sechs Prozent wuchs, ging sie in Deutschland um drei Prozent zurück. Deutsche Industriefirmen konnten trotz unterdurchschnittlicher Preisentwicklung weniger Produkte absetzen. Ein Grund dafür ist, dass viele deutsche Unternehmen ihren Technologievorsprung, vor allem gegenüber der chinesischen Konkurrenz, verloren haben und deshalb seltener die Preise diktieren können. Die hohen Standortkosten werden so zum Nachteil.
Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft warnt drastisch: Der Fachkräftemangel treibe die Löhne weiter in die Höhe, die Kosten in Deutschland würden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. An dieser Stelle sei die Bundesregierung gefordert, um den Anstieg der Lohnnebenkosten zu bremsen und gleichzeitig auf demografische Herausforderungen zu reagieren. Ohne eine Reform der Sozialsysteme werde der Standort schrittweise in die Deindustrialisierung abrutschen.
Zu den hohen Arbeitskosten gesellt sich ein zweiter massiver Standortnachteil: überbordende Bürokratie. Die Bürokratiebelastung kostete die deutsche Wirtschaft im Jahr zweitausendvierundzwanzig etwa siebenundsechzig Komma fünf Milliarden Euro. Das entspricht rund ein Komma fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Gemeinsam mit hohen Energiepreisen und immer weniger Arbeits- und Fachkräften belastet dies die Qualität des Standorts Deutschland erheblich.
Insbesondere der industrielle Mittelstand leidet unter der Vielzahl staatlicher Vorgaben, da ihm oft die Ressourcen fehlen, um komplexe Anforderungen zu bewältigen. Unnötige Bürokratie kostet Zeit und Geld, hemmt Innovationen und vergrößert den Standortnachteil. Eine Befragung hochrangiger Manager in Europa und den USA ergab, dass einunddreißig Prozent der für Deutschland zuständigen Unternehmensvertreter angaben, Produktion aktiv in andere Kontinente zu verlagern oder dorthin auszuweiten. Zweiundvierzig weitere Prozent investieren in anderen europäischen Ländern statt in Deutschland oder schieben Investitionen hierzulande vorerst auf.
Die energieintensiven Branchen Basis-Chemie, Stahl, Glas und Zement trifft es besonders hart. Christof Günther, Geschäftsführer des Chemiestandortbetreibers Infraleuna, beobachtet: Viele Unternehmen können ihre Anlagen seit Jahren nicht richtig auslasten und sehen jetzt final keine Perspektive mehr. Aktuell verliere man jede Woche massiv und unwiederbringlich industrielle Wertschöpfung in Deutschland.
In diesem Kontext gewinnt Tischlers Hinweis auf Baier & Michels besondere Bedeutung. Das Unternehmen, eine Tochter der Würth-Gruppe, produziert Verbindungstechnik sowie Verschluss- und Dichtsysteme für die Automobil-, Elektro- und Medizinindustrie. Trotz der schwierigen Konjunkturlage investiert Baier & Michels zwanzig Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte am deutschen Standort Ober-Ramstadt bei Darmstadt. Ab Herbst soll dort das innovative Fertigungsverfahren b&m-ECCO TEC zum Einsatz kommen.
Dieses Verfahren verbindet die Gestaltungsmöglichkeiten des Zerspanens mit den Vorteilen der Kaltumformung. Eine einhundertfünfundzwanzig Tonnen schwere Maschine, so groß wie eine Drei-Zimmer-Wohnung, wird kleine Funktionsbauteile wie Kugelbolzen, Antriebswellen oder Stellspindeln spanlos fertigen. Hohe Taktzahlen und die vollständige Ausnutzung des eingesetzten Rohmaterials kombiniert mit absoluter Konturfreiheit und hervorragender Qualität der verfestigten Oberfläche sind die Vorteile. Klassische Langdrehteile, die bisher ausschließlich spanend hergestellt wurden, können nun durch Kaltumformung produziert werden, mit hoher Präzision, in extrem hohen Taktzeiten und ressourceneffizient, ohne dass ein einziger Span als Abfall entsteht.
Die strategische Ausrichtung von Baier & Michels überzeugt: Man betreibe zwar acht Standorte weltweit, aber die innovativste Entwicklung finde derzeit in Deutschland statt. Man investiere rund zwanzig Millionen Euro an einem Standort Ober-Ramstadt bei Darmstadt und widersetze sich damit dem Trend, Werke ins Ausland zu verlagern. Man sei davon überzeugt, dass das der richtige Weg sei.
Diese Haltung repräsentiert eine Gegenposition zum vorherrschenden Narrativ des Standortnachteils Deutschland. Sie basiert auf der Überzeugung, dass man auch am Standort Deutschland erfolgreich produzieren könne, wenn man anders denke, fair kalkuliere und auf Qualität und Partnerschaft statt auf Preisdruck setze.
Passend dazu:
Die sieben Hebel zur Wiedererlangung industrieller Stärke: Eine systematische Analyse
Die sieben Hebel zur Wiedererlangung industrieller Stärke: Eine systematische Analyse – Bild: Xpert.Digital
Die Frage, wo die größten Hebel zur Rückgewinnung der industriellen Stärke Europas liegen, lässt sich nicht monokausal beantworten. Erforderlich ist vielmehr ein koordiniertes Bündel von Maßnahmen, das strukturelle Schwächen adressiert und gleichzeitig bestehende Stärken ausbaut. Basierend auf der Analyse der Nexperia-Krise, der Erkenntnisse zu Vorpufferlagern und der aktuellen Forschung zu Lieferkettenresilienz lassen sich sieben zentrale Hebel identifizieren.
Erster Hebel: Strategische Autonomie bei kritischen Technologien durch gezielte Industriepolitik
Die fundamentalste Lehre aus der Nexperia-Krise lautet: Abhängigkeiten in kritischen Technologiebereichen sind inakzeptable strategische Verwundbarkeiten. Europa muss in definierten Schlüsselbereichen die Fähigkeit zurückgewinnen, sich selbst zu versorgen. Dies bedeutet nicht vollständige Autarkie, wohl aber das Erreichen kritischer Schwellenwerte, ab denen Erpressungsversuche ins Leere laufen.
Das europäische Chip-Gesetz, das im Jahr zweitausenddreiundzwanzig verabschiedet wurde, stellt einen ersten Schritt in diese Richtung dar. Es mobilisiert dreiundvierzig Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen mit dem Ziel, den europäischen Marktanteil an der globalen Halbleiterproduktion von derzeit neun Prozent auf zwanzig Prozent bis zweitausenddreißig zu steigern. Die Initiative Chips für Europa soll den groß angelegten Aufbau technologischer Kapazitäten und Innovationen unterstützen. Ein Rahmen zur Förderung öffentlicher und privater Investitionen in Produktionsanlagen soll die Versorgungssicherheit gewährleisten.
Erste Erfolge zeichnen sich ab. Der taiwanesische Weltmarktführer TSMC errichtet in Dresden gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP seine erste europäische Fertigungsstätte. STMicroelectronics und GlobalFoundries planen eine neue Fabrik in Frankreich. Nach Schätzungen von Analysten und Fachorganisationen werden diese milliardenschweren Investitionen verhindern, dass der derzeitige Marktanteil von knapp zehn Prozent weiter sinkt.
Allerdings wird er entgegen den Hoffnungen der Europäischen Union wahrscheinlich auch nicht steigen vor Ende des Jahrzehnts. Im internationalen Wettbewerb wird deutlich, dass Europa über weniger finanzielle Schlagkraft verfügt als die Vereinigten Staaten und Asien. Der US CHIPS Act stellt dreiundfünfzig Milliarden Dollar an direkten Subventionen, fünfundsiebzig Milliarden an Krediten und weitere Steuervergünstigungen bereit. Die Vereinigten Staaten führen zudem in wichtigen Feldern wie Chip-Design und Forschung zur künstlichen Intelligenz. China unterstützt seine Halbleiterindustrie seit zweitausendvierzehn mit einem staatlichen Investitionsfonds von insgesamt siebzig Milliarden Euro, um die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu reduzieren. Taiwan, Korea und Japan subventionieren ihre lokalen Industrien mit ähnlichen Milliardenprogrammen.
Die Mitgliedstaaten der EU rufen bereits zu einer Überarbeitung des Chips Acts auf. Die Semicon Coalition fordert einen European Chips Act zwei Punkt null, der Chipdesign, Fertigungskapazitäten und Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen entschlossener unterstützen würde. Solche Forderungen spiegeln ein grundlegendes Umdenken wider: Die Branche betrachtet Resilienz nicht mehr nur als eine Frage der Lieferlogistik oder des Marktanteils, sondern als einen Bereich, in dem öffentliche Investitionen, Industriepolitik und eine langfristige strategische Ausrichtung erforderlich sind.
Kritisch ist dabei die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten. Europa verfügt in den Wertschöpfungsschritten Halbleiterdesign und -fertigung über Stärken in den Bereichen Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensorik. Schwächen bestehen jedoch bei hochintegrierten Logikchips, bei Speichern und vor allem bei vorgelagerten Gliedern der Lieferkette wie Rohmaterialien, Fertigungsanlagen und Entwurfswerkzeugen. Eine umfassende Strategie muss diese gesamte Kette adressieren.
Neben Halbleitern müssen weitere kritische Bereiche identifiziert werden. Dazu gehören Permanentmagnete und ihre Vorprodukte, vor allem für Windkraftanlagen und Elektromobilität, Lithium-Ionen-Batterien für Elektromobilität mit der kompletten Lieferkette, Photovoltaik-Industrie insbesondere Ingots, Wafer, Solarglas, Zellen und Module sowie der Aufbau eines Leitmarktes für grünen Stahl. Kurzfristig sollte Resilienz durch gezielte Investitionen in heimische Transformationsindustrien und Ansiedlung besonders kritischer Teile der Lieferketten in Deutschland und Europa erhöht werden.
Zweiter Hebel: Transformation von Just-in-Time zu hybriden Resilienzmodellen mit intelligenten Puffersystemen
Das Konzept des Vorpufferlagers, wie es in der Recherche zu Container-Hochregallagern beschrieben wird, repräsentiert eine innovative Antwort auf das Dilemma zwischen Effizienz und Resilienz. Jahrzehntelang galt die Dichotomie zwischen beiden Zielen als unüberwindbar. Entweder man optimiert Kosten durch minimale Lagerhaltung, oder man erhöht Versorgungssicherheit durch umfangreiche Bevorratung. Container-Vorpufferlager lösen diesen scheinbaren Widerspruch durch technologische Innovation auf.
Die Idee basiert auf der Übertragung bewährter Hochregaltechnologie aus der Stahlindustrie auf die Hafenlogistik. Ein deutscher Maschinen- und Anlagenbauer mit einhundertfünfzig Jahren Erfahrung in der Metallindustrie entwickelte ursprünglich Systeme für die automatisierte Handhabung von Stahlcoils mit bis zu vierzig Tonnen Gewicht in bis zu fünfzig Meter hohen Regalen. Diese Technologie wurde für Containerhandling adaptiert. Nach erfolgreichen Tests mit über dreiundsechzigtausend Containerbewegungen an einem Terminal im Hafen von Jebel Ali in Dubai wurde das System marktreif.
Während konventionelle Container-Yards Container in maximal sechs Ebenen direkt übereinanderstapeln und ein Umstapeln bei dreißig bis sechzig Prozent aller Containerbewegungen erforderlich machen, ermöglicht die Hochregaltechnologie vertikales Stapeln bis zu elf oder sogar achtzehn Ebenen mit direktem Zugriff auf jeden einzelnen Container. Jeder Container erhält einen individuellen Regalplatz in einer Stahlkonstruktion, bedient durch vollautomatisierte elektrische Regalbediengeräte. Das System verdreifacht die Umschlagskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung des Flächenbedarfs um siebzig Prozent.
Die ökonomischen Implikationen sind beträchtlich. In Hafengebieten, wo bebaubares Land zwischen zweitausend und dreitausend Euro pro Quadratmeter kostet, ergibt die Flächeneinsparung von drei Hektar allein für dreitausend TEU Lagerkapazität einen Kostenvorteil von sechzig bis neunzig Millionen Euro. Diese Kapitaleffizienz ermöglicht es Unternehmen, ihre Versorgungssicherheit zu erhöhen, ohne die finanzielle Belastung unverhältnismäßig zu steigern.
Das Container-Vorpufferlager positioniert sich als erste Lagerstation vor dem eigentlichen Produktionslager. Produktionsteile aus Übersee werden per Container über Land aufs Firmengelände ungeöffnet in die Vorpufferzone gebracht und erst bei Bedarf die Produktionsteile aus dem Container ins Bereitstellungslager übergeben. Diese Vorschaltung schafft eine zusätzliche Sicherheitsebene, die Material in Containern als kurzfristigen Bestand puffert, damit die Produktion kontinuierlich mit Nachschub versorgt wird. Bei Schwankungen in der Materialzufuhr oder langsameren Produktionsschritten im Vorlauf können Verzögerungen im Gesamtablauf kompensiert werden.
Ein gut konzipiertes Container-Vorpufferlager verbessert alle vier Schlüsselmetriken von Supply Chain Resilience signifikant. Time to Awareness, die Zeitspanne bis zur Wahrnehmung einer Störung, wird durch automatisierte Bestandsverwaltung mit Echtzeit-Reporting verkürzt. Time to Action, die Zeitspanne bis zur Einleitung von Gegenmaßnahmen, reduziert sich durch direkte Verfügbarkeit von Material. Time to Recover, die Zeitspanne bis zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit, beschleunigt sich durch Entkopplung von globalen Lieferkettenabhängigkeiten. Time to Survive, die maximale Zeitspanne, die ein Unternehmen ohne Versorgung überstehen kann, verlängert sich durch den erhöhten Sicherheitsbestand erheblich.
Moderne Unternehmen setzen oft auf eine Kombination von Just-in-Time bei Standardkomponenten und Just-in-Case bei sensiblen oder kritischen Materialien. Diese hybride Strategie vereint Effizienz und Versorgungssicherheit. Kritische Komponenten oder schwer planbare Materialien werden im Rahmen eines Just-in-Case-Modells bevorratet, während für standardisierte, leicht verfügbare Produkte das Just-in-Time-Prinzip Anwendung findet. So lassen sich Risiken minimieren, ohne dabei die Kostenkontrolle aus den Augen zu verlieren.
Laut einer ifo-Studie setzen etwa dreiundzwanzig Prozent der Firmen auf eine verstärkte Lagerhaltung. Besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen liegt der Fokus auf einer ausgebauten Bevorratung, da ihnen die Diversifizierung der Lieferbeziehungen oftmals schwerfällt. Ein Großteil kritischer Vorprodukte stammt aus China. Fehlen diese oder treffen verzögert ein, kann die Produktion und folglich die gesamte Supply Chain zusammenbrechen. Eine erhöhte Einlagerung dieser Produkte soll in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen, ein klarer Trend weg von Just-in-Time in Richtung Just-in-Case.
Passend dazu:
- Vorpufferlager (Nearshoring): Wenn globale Krisen auf fragile Lieferketten treffen, wird aus Notwendigkeit Innovation
Dritter Hebel: Diversifizierung und Regionalisierung der Lieferketten durch Nearshoring und strategische Partnerschaften
Die extreme Konzentration von Wertschöpfungsketten in einzelnen Regionen, insbesondere in China, hat sich als strategische Verwundbarkeit erwiesen. Diversifizierung ist daher keine optionale Risikomanagementstrategie mehr, sondern eine Überlebensfrage für europäische Industrie.
Nearshoring, die Verlagerung von Produktion in nahegelegene Länder, gewinnt massiv an Bedeutung. Es gab einen zweiundsechzigprozentigen Anstieg der Nearshoring-Investitionen in den Jahren zweitausendzweiundzwanzig und zweitausenddreiundzwanzig im Vergleich zu zweitausendachtzehn bis neunzehn. Die durchschnittlichen Investitionsausgaben für jedes Projekt stiegen im Vergleich zu zweitausendneunzehn um das Dreifache auf einhunderteinunddreißig Millionen Dollar.
Nearshoring verkürzt die Vorlaufzeiten, verbessert die Reaktionsfähigkeit und bringt oft ähnliche kulturelle und zeitliche Kompatibilitäten mit sich. Ein deutsches Unternehmen könnte sich beispielsweise für eine Nearshore-Vertretung in Polen entscheiden, anstatt die Produktion zurück nach Deutschland zu verlagern, um die niedrigeren Arbeitskosten mit der geografischen Nähe in Einklang zu bringen.
Prominente Beispiele zeigen die Dynamik. Der deutsche Automobilhersteller BMW hat seine Produktion in Länder wie Ungarn und die Tschechische Republik verlagert. Auf diese Weise profitiert BMW von niedrigeren Lohnkosten und bleibt gleichzeitig in der Nähe seiner wichtigsten Märkte. Im Werk des Unternehmens in Debrecen, Ungarn, wurden mehr als zwei Milliarden Euro investiert. Bosch, ein weltweit führender Anbieter von Technik und Dienstleistungen, hat einen Teil seiner Produktion nach Ungarn und in die Slowakei verlagert.
Laut einer ABB-Studie aus zweitausendzweiundzwanzig planen sechsundachtzig Prozent der deutschen und vierundsiebzig Prozent der europäischen Unternehmen Reshoring- oder Nearshoring-Maßnahmen. Die Automobilindustrie steht dabei im Fokus. Eine Porsche Consulting-Studie zeigt sektorspezifische Reshoring-Neigung. Automotive-Zulieferer weisen eine hohe Tendenz auf, näher an OEMs zu rücken aus Effizienz- oder Nachhaltigkeitsgründen.
Neben geografischer Diversifizierung ist auch Lieferantendiversifizierung entscheidend. Unternehmen sollten für eine Diversifikation ihrer Zulieferer sorgen. In Hinblick auf unvorhersehbare politische oder wetterbedingte Veränderungen sollten diese bestmöglich geografisch gestreut sein. So können Abhängigkeiten verringert und die Auswirkungen von externen Schwankungen sowie Störungen kompensiert werden.
Friendshoring, die Beschränkung des internationalen Handels auf Länder, mit denen man gemeinsame politische Werte teilt, gewinnt ebenfalls an Bedeutung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte beim Berlin Global Dialogue einen umfassenden Plan an, um die Abhängigkeit von China deutlich zu verringern, nach dem Vorbild der Energiepolitik nach dem russischen Gasstopp. Das Ziel sei, kurz-, mittel- und langfristig den Zugang zu alternativen Quellen von kritischen Rohstoffen für europäische Industrien sicherzustellen.
Parallel dazu will die EU gezielt Partnerschaften mit Ländern wie der Ukraine, Australien, Kanada, Kasachstan, Chile oder Grönland aufbauen. Taiwans De-facto-Botschafter in Deutschland nannte es richtig, dass von der Leyen auf ein De-Risking von China setze. Viele taiwanesische Unternehmen investierten inzwischen in Südostasien statt in China.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung
Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Bürokratieabbau beschleunigen: One-Stop-Shops als Standortvorteil - Vorpufferlager machen Lieferketten resilienter und effizienter
Vierter Hebel: Digitalisierung und Industrie vier Punkt null zur Steigerung von Transparenz und Anpassungsfähigkeit
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein fundamentaler Enabler für resiliente und effiziente Produktion. Die Integration von Internet of Things, Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und digitalen Zwillingen transformiert Lieferketten von reaktiven zu proaktiven Systemen.
Deutsche Industrieunternehmen planten laut einer Studie von PwC und Strategy& in den kommenden fünf Jahren hohe Investitionen in digitale Anwendungen. Im Schnitt wollen sie etwa drei Komma drei Prozent ihres Jahresumsatzes für Industrie vier Punkt null-Lösungen verwenden. Das entspricht einer jährlichen Investitionssumme von mehr als vierzig Milliarden Euro. Schon im Jahr zweitausendzwanzig wollten über achtzig Prozent der befragten Industrieunternehmen ihre Wertschöpfungskette digitalisiert haben.
Von der Digitalisierung ihrer Wertschöpfungsketten versprechen sich Unternehmen effizientere Abläufe und hohe Kosteneinsparungen. Die befragten Firmen rechnen im Schnitt mit einer Effizienzsteigerung von drei Komma drei Prozent pro Jahr. Gleichzeitig sollen digitale Lösungen dabei helfen, die Kosten um jährlich zwei Komma sechs Prozent zu drücken.
Unternehmen, die ihr Produkt- und Service-Angebot schon weitgehend digitalisiert haben, sind in den vergangenen drei Jahren überdurchschnittlich gewachsen. Fast siebzig Prozent aller Unternehmen mit stark digitalisierten Produkten erzielten in den letzten drei Jahren ein Wachstum zwischen sechs und zehn Prozent. Die Studie errechnet, dass die deutsche Industrie dank digitaler Produkte und Services jährlich zusätzlich dreißig Milliarden Euro erwirtschaften kann.
Für Lieferkettenresilienz ist Visibilität entscheidend. Wer den Überblick über alle relevanten Prozesse behält, kann bei Problemen schnell reagieren, behält die Kontrolle und kann vorausschauend in die Zukunft planen. Mehr Transparenz und Flexibilität bieten digitale Plattformen, die eine Überwachung in Echtzeit erlauben. Dafür ist eine zuverlässige Kommunikation unabdingbar, möglich dank digitaler Tools wie spezialisierter SCM-Software.
Internet of Things spielt eine zentrale Rolle in Logistics vier Punkt null. Sensoren und smarte Geräte sammeln kontinuierlich Daten, die zur Optimierung logistischer Prozesse genutzt werden können. Dies reicht von der Überwachung von Lagerbedingungen bis zur Optimierung von Routen in der Transportlogistik. Im Kontext von Container-Vorpufferlagern bedeutet dies die Integration von RFID-Tracking-Systemen, die Inventar in Echtzeit überwachen, und Smart Contracts über Blockchain-Technologie, die sicherstellen, dass Lieferanten Material nur dann liefern, wenn die Produktion es benötigt.
Big Data Analytics und künstliche Intelligenz nutzen die Datenflut, die durch IoT-Geräte und andere Quellen generiert wird. Mit Hilfe von Algorithmen können diese Daten verwendet werden, um Muster zu identifizieren, Prozesse zu optimieren und informierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Prädiktive Analytik wird die Rolle von Vorpufferlagern transformieren. Statt reaktiv auf Materialengpässe zu reagieren, werden intelligente Systeme Nachfrageschwankungen antizipieren und proaktiv Bestände anpassen. Forschungen zeigen, dass KI-gestützte Nachfrageprognosen in JIT-Umgebungen die Lagerkosten um zwanzig bis dreißig Prozent reduzieren und gleichzeitig die Auftragserfüllungsraten verbessern können.
Die Integration von Digital Twin-Technologie ermöglicht Echtzeit-Überwachung und Simulation von Lageroperationen, bevor physische Änderungen implementiert werden. Bis zweitausendfünfunddreißig wird erwartet, dass der Markt für automatisierte Containerterminals zwanzig Komma drei Milliarden US-Dollar erreicht, getrieben durch Fortschritte in Robotik, autonomen Fahrzeugen und KI-gesteuerten Logistiksystemen.
Passend dazu:
- Automatisierung & Digitalisierung: Würth, Procter & Gamble, Seeberger, Oknoplast & Co. setzen auf Lager-Roboter
Fünfter Hebel: Radikaler Bürokratieabbau und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
Bürokratie ist einer der meistgenannten negativen Standortfaktoren Deutschlands und Europas. Die Bürokratiebelastung kostete die deutsche Wirtschaft im Jahr zweitausendvierundzwanzig etwa siebenundsechzig Komma fünf Milliarden Euro, rund ein Komma fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Dies verringert die Produktivität erheblich.
Ein zweiter Aspekt ist die Geschwindigkeit. Auch wenn der bürokratische Aufwand gering ist, kann ein Prozess dennoch viel Zeit in Anspruch nehmen, beispielsweise wenn voneinander unabhängige Prozessschritte nicht gleichzeitig, sondern aufeinander folgend umgesetzt werden. Dies bedeutet für Unternehmen, dass Produktionsanlagen erst später in Betrieb genommen, Vertriebsprozesse verzögert gestartet oder Innovationsvorhaben nicht begonnen werden können.
Drittens gibt es in bürokratischen Prozessen meist einen Ermessensspielraum. Regeln können so ausgelegt werden, dass sie jedes entstehende Risiko durch Auflagen ausschließen. Im Gegensatz dazu kann die Verwaltung auch Risiken bewerten und auf Grundlage von Eintrittswahrscheinlichkeiten entscheiden, welche Auflagen tatsächlich notwendig sind, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Letzteres ermöglicht in der Regel größere wirtschaftliche Aktivität.
Für Ansiedlungen von Produktionsstätten haben Praxis-Checks gezeigt, dass vor allem zentrale One-Stop-Shops für alle damit zusammenfallenden Prozesse erfolgreich sein können. Ebenfalls eignen sich die Praxis-Checks hervorragend, um eine Harmonisierung von Vorgaben auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene zu erreichen und den Abbau von Doppelregulierungen zu ermöglichen.
Ein dritter Schwerpunkt sollte auf die Kostenseite der Umsetzung sinnvoller Regulierungen gesetzt werden. Durchgängig elektronische Arbeitsprozesse und eine bundesweite Plattform für Meldungen und Genehmigungen sollten analoge Prozesse ersetzen. Auch kann eine vergleichbare Qualität der Regulierung mit unterschiedlichen Ansätzen erreicht werden. Eine Chance bieten risikobasierte Ansätze, die auf der Abwägung von Wahrscheinlichkeiten beruhen.
Bürokratie soll dabei nicht abgeschafft, sondern vielmehr modern, kostengünstig und schnell umsetzbar sein. Dann ist ein funktionsfähiger Staat mit einer schnellen Bürokratie ein echter Standortvorteil. Die deutsche Wirtschaft erwartet von der neuen Bundesregierung drastische Einschnitte bei der Bürokratie, mehr Tempo und Effizienz.
Passend dazu:
- Deutsche Verwaltung und Bürokratie: 835 Millionen Euro pro Tag – Explodieren die Kosten für Deutschlands Beamte wirklich?
Sechster Hebel: Fokussierung auf Qualität, Innovation und Partnerschaft statt reinen Preiskampf
Jana Tischlers Kernaussage verdient besondere Beachtung: Man zeige bei Baier & Michels, dass man auch am Standort Deutschland erfolgreich produzieren könne, wenn man anders denke, fair kalkuliere und auf Qualität und Partnerschaft statt auf Preisdruck setze.
Diese Haltung steht im Widerspruch zu einer verbreiteten Einkaufspraxis, die primär auf Kostenminimierung fokussiert. Wenn Unternehmen bei jeder Beschaffungsentscheidung ausschließlich den niedrigsten Preis zum Entscheidungskriterium machen, setzen sie Anreize, die langfristig zur Erosion der Wertschöpfung führen. Lieferanten, die permanent Preisdruck ausgesetzt sind, haben keinen Spielraum für Investitionen in Qualität, Innovation oder Resilienz. Sie sind gezwungen, Kosten zu senken, wo immer möglich, notfalls durch Produktionsverlagerung in Niedriglohnländer oder durch Qualitätskompromisse.
Das Gegenmodell basiert auf langfristigen Partnerschaften, fairer Preisgestaltung und dem Verständnis, dass Qualität und Versorgungssicherheit ihren Preis haben. Ein guter Ruf für hohe Qualität kann einer Marke einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der es ihr ermöglicht, höhere Preise zu erzielen. Kunden sind oft bereit, für Produkte, die sie als hochwertig empfinden, einen Aufschlag zu zahlen, wodurch Unternehmen ihre Gewinnspannen verbessern können.
Eine gleichbleibende Produktqualität erhöht die Kundenbindung und -treue, was zu höheren Umsätzen und Folgegeschäften führt. Sie kann auch den Ruf der Marke verbessern, mehr Kunden anziehen und den Marktanteil des Unternehmens vergrößern. Maßnahmen zur Qualitätskontrolle spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.
Made in Germany, die Qualität deutscher Produkte, deutsche Ingenieurskompetenzen waren legendär. Diese auf Produktqualität und -zuverlässigkeit begründete Meisterschaft hat Unternehmen Wachstum beschert, den Menschen Arbeitsplätze gesichert, Steuern generiert und der Gesellschaft die Grundlagen für jahrzehntelanges Prosperieren in Wohlstand und Frieden verschafft. Viele deutsche Unternehmen, vor allem des im weltweiten Vergleich enorm starken und innovativen Mittelstands, haben sich auf ihren Märkten nach wie vor Qualitätsführerschaft hart erarbeitet.
Investitionen in Qualitätskontrollmaßnahmen wie regelmäßige Inspektionen und strenge Tests können sicherstellen, dass Produkte durchweg hohen Standards entsprechen. Außerdem können Unternehmen so Probleme frühzeitig erkennen und beheben und das Risiko von Produktrückrufen oder unzufriedenen Kunden verringern. Qualitätskontrolle kann den Weg für kontinuierliche Verbesserungen ebnen. Sie bietet wertvolle Einblicke in den Produktionsprozess und ermöglicht es Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um ihre Abläufe und Produktangebote zu verbessern.
Siebter Hebel: Massive Steigerung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen mit Fokus auf Transfer in die Wertschöpfung
Europa investiert im internationalen Vergleich zu wenig in Forschung und Entwicklung. Mit zwei Komma eins Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr zweitausendeinundzwanzig liegt Europa deutlich hinter den Vereinigten Staaten mit drei Komma fünf Prozent, China mit zwei Komma vier Prozent, Israel mit fünf Komma sechs Prozent, Südkorea mit vier Komma neun Prozent und Japan mit drei Komma fünf Prozent.
Es braucht ein klares Bekenntnis der EU und der EU-Mitgliedstaaten dazu, massiv in Forschung, insbesondere in Zukunfts- und Schlüsseltechnologien zu investieren, damit ein nachhaltiger, resilienter und wettbewerbsfähiger europäischer Forschungsraum erreicht werden kann. Die kommenden Jahre sind entscheidend, um den Anschluss an die Länder, die mit Milliardensubventionen und attraktiven Standortbedingungen werben, nicht zu verlieren.
Unternehmen stemmen zwei Drittel aller Forschungsaufwendungen Europas. Die Unterstützung durch öffentliche Forschungs- und Entwicklungsförderung erweist sich dabei als zentraler Hebel für das gesamte Forschungsökosystem und setzt Anreize für unternehmensübergreifende Kooperationen im vorwettbewerblichen Rahmen und für eine enge Verzahnung mit der Wissenschaft sowie dem Mittelstand. Die forschenden deutschen Unternehmen sind in ihren Investitionen im europäischen Vergleich führend. Im Jahr zweitausendzweiundzwanzig stemmten deutsche Unternehmen sechsundvierzig Komma vier Prozent der industriellen Forschungsausgaben in der EU insgesamt.
Gleichzeitig ist Europa vergleichsweise schwach, was den Transfer der Forschung in die Wertschöpfung angeht. Die Schnittstelle zwischen staatlich geförderter Forschung und marktfähiger Produktion und Skalierung, also der Transfer, muss in Deutschland und Europa dringend in Schwung gebracht werden. Zentraler Fokus muss sein, die Forschungsprojekte in die Breite der industriellen Anwendungspraxis zu bringen.
Durch flankierende industriepolitische Maßnahmen muss die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, die vielfach im Rahmen der Transformation vor immensen Herausforderungen steht, gesichert werden. Denn es geht am Ende darum, ein Forschungsergebnis auch zur Marktreife zu führen. Deshalb muss in Zukunft die gesamte Entwicklungskette miteinbezogen und verknüpft werden, von der ersten Idee beziehungsweise Entdeckung bis zur Marktreife des fertigen Produktes und zur Entwicklung von Standards.
Gerade bei digitalen Schlüsseltechnologien wie der künstlichen Intelligenz und im Bereich der digitalen Datenwirtschaft legen insbesondere die USA und China ein anderes Tempo vor. Zudem besteht ein Mangel an Sprunginnovationen. Deutsche Unternehmen sind gut darin, Bestehendes zu optimieren. Doch Innovationen, die ganze Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten revolutionieren, stammen eher selten aus Deutschland.
Passend dazu:
- China und das Neijuan der systematischen Überinvestitionen: Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle
Die Dialektik von Effizienz und Resilienz: Warum Europa beides braucht
Die Nexperia-Krise hat mit brutaler Klarheit offengelegt, dass das europäische Wirtschaftsmodell an einem kritischen Wendepunkt steht. Jahrzehnte einseitiger Optimierung auf Kosteneffizienz haben Abhängigkeiten geschaffen, die sich heute als strategische Verwundbarkeiten erweisen. Die Antwort kann jedoch nicht darin bestehen, das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen zu lassen und Autarkie als Ziel zu definieren. Vielmehr geht es darum, ein neues Gleichgewicht zu finden zwischen den Vorteilen globaler Arbeitsteilung und der Notwendigkeit strategischer Autonomie in kritischen Bereichen.
Die sieben identifizierten Hebel bilden kein sequenzielles Programm, sondern ein systemisches Bündel von Maßnahmen, die nur in ihrer Gesamtheit die gewünschte Wirkung entfalten können. Strategische Autonomie bei kritischen Technologien ohne gleichzeitige Transformation der Lagerhaltungslogik bleibt unvollständig. Nearshoring ohne Digitalisierung verzichtet auf Effizienzpotenziale. Bürokratieabbau ohne Fokussierung auf Qualität und Innovation führt zu einem Race to the Bottom. Forschungsinvestitionen ohne Transfer in die Wertschöpfung verpuffen wirkungslos.
Jana Tischlers Frage, wo die größten Hebel zur Rückgewinnung der industriellen Stärke Europas liegen, lässt sich daher nicht mit einer eindimensionalen Antwort beantworten. Die größten Hebel liegen in der intelligenten Kombination aller sieben Dimensionen, in der Fähigkeit, scheinbare Widersprüche produktiv aufzulösen und aus der Krise die Kraft für eine fundamentale Neuausrichtung zu gewinnen.
Europa muss wieder an sich selbst glauben, wie Tischler formuliert, und handeln, bevor andere für es entscheiden. Dieser Glaube kann jedoch nicht auf nostalgischer Verklärung vergangener Stärken beruhen, sondern muss sich auf eine nüchterne Analyse gegenwärtiger Schwächen und eine entschlossene Vision zukünftiger Möglichkeiten gründen. Die Werkzeuge sind vorhanden, die Technologien verfügbar, das Wissen existent. Was fehlt, ist der politische Wille, die notwendigen Ressourcen zu mobilisieren und die erforderlichen Strukturveränderungen auch gegen Widerstände durchzusetzen.
Die Investition von Baier & Michels in eine hochmoderne Produktionsstätte am Standort Deutschland zeigt, dass es möglich ist, auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen des deutschen Standorts erfolgreich und innovativ zu produzieren. Entscheidend ist der Mut zu andersartigem Denken, zu fairer Kalkulation und zum Setzen auf Qualität und Partnerschaft statt auf puren Preiskampf. Wenn viele Unternehmen diesem Beispiel folgen, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft und wenn die Gesellschaft die notwendigen Transformationsprozesse mitträgt, dann hat Europa durchaus die Chance, seine industrielle Stärke zurückzugewinnen.
Die Nexperia-Krise sollte nicht als isolierter Zwischenfall, sondern als Weckruf verstanden werden. Sie zeigt mit erschreckender Deutlichkeit, wohin extreme Abhängigkeiten führen können. Sie demonstriert aber auch, welche Hebel aktiviert werden müssen, um solche Krisen künftig zu vermeiden oder zumindest besser zu bewältigen. Container-Vorpufferlager, hybride Lagerhaltungsstrategien, Nearshoring, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Qualitätsfokussierung und Forschungsinvestitionen sind keine theoretischen Konzepte, sondern praktikable Lösungsansätze, die bereits heute von innovativen Unternehmen umgesetzt werden.
Die Frage ist nicht, ob Europa die industrielle Stärke zurückgewinnen kann, sondern ob es den Willen aufbringt, die erforderlichen Schritte zu gehen. Die Antwort auf Jana Tischlers Frage lautet daher: Die größten Hebel liegen in der umfassenden Transformation des europäischen Industriemodells von einer einseitigen Effizienzorientierung zu einem ausbalancierten System, das Effizienz und Resilienz, globale Integration und strategische Autonomie, Kostenoptimierung und Qualitätsführerschaft gleichermaßen berücksichtigt. Dieser Transformationsprozess erfordert massive Investitionen, mutige Entscheidungen und die Bereitschaft, liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben. Er ist jedoch alternativlos, wenn Europa nicht zu einem ökonomischen Spielball geopolitischer Machtspiele werden will, sondern seine Zukunft selbst gestalten möchte.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

