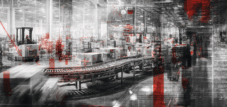Containerhafen Bremerhaven: 3-Milliarden-Euro-Investition für Automatisierung und Sanierung – Wer zahlt für Bremerhavens Zukunft?
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 13. September 2025 / Update vom: 13. September 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Containerhafen Bremerhaven: 3-Milliarden-Euro-Investition für Automatisierung und Sanierung – Wer zahlt für Bremerhavens Zukunft? – Kreativbild: Xpert.Digital
Die Zukunft der Bremerhavener Hafeninfrastruktur: Zwischen Sanierungsbedarf und technologischer Innovation
### 3-Milliarden-Euro-Plan soll Deutschlands Tor zur Welt retten: Was jetzt in Bremerhaven passiert ### Rostfraß und Riesen-Schiffe: Bremerhavens wichtigste Mauer droht zu bröckeln – mit Folgen für alle ### Job-Killer oder Zukunftschance? Ferngesteuerte Kräne revolutionieren Deutschlands wichtigen Hafen ### Hafen-Streit eskaliert: Warum der Süden für den Norden zahlen soll – und der Bund zögert ### Verliert Deutschland den Anschluss? Wie marode Infrastruktur unseren Wohlstand gefährdet ###
Keine Kranführer mehr in der Kanzel: Die stille Revolution, die Bremerhavens Hafen für immer verändert
Der Containerhafen Bremerhaven, eines der wichtigsten Tore Deutschlands zur Welt, steht vor einer historischen Zerreißprobe. Jahrzehntealte Kaimauern, die für die Schiffe der 1970er Jahre gebaut wurden, ächzen unter der Last moderner Mega-Containerriesen und weisen massive Korrosionsschäden auf. Die Infrastruktur ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und droht, den Anschluss an die internationale Konkurrenz wie Rotterdam und Antwerpen zu verlieren. Um den Kollaps zu verhindern und den Standort zukunftsfähig zu machen, ist ein Kraftakt von beispiellosem Ausmaß notwendig: Ein über drei Milliarden Euro schweres Investitionspaket aus öffentlichen und privaten Mitteln soll die marode Stromkaje erneuern und den Hafen in ein hochmodernes, automatisiertes Logistik-Drehkreuz verwandeln.
Doch während die technologische Revolution mit ferngesteuerten Kränen bereits begonnen hat, entzündet sich an der Finanzierung ein erbitterter politischer Streit. Die Küstenländer fordern eine “Zeitenwende” und verlangen, dass der Bund und damit ganz Deutschland die Kosten für diese nationale Aufgabe mittragen. Im Kern geht es um die entscheidende Frage: Wer zahlt für die Modernisierung der Infrastruktur, von der die gesamte deutsche Wirtschaft profitiert? Die kommenden Jahre werden nicht nur über die Zukunft Bremerhavens entscheiden, sondern auch darüber, ob Deutschland seine strategische Rolle als führende Seehandelsnation im Zeitalter der Digitalisierung und der Energiewende behaupten kann.
Was sind die größten Herausforderungen für den Bremerhavener Containerhafen?
Der Containerhafen Bremerhaven steht vor enormen strukturellen Herausforderungen, die grundlegende Investitionen erfordern. Die Hauptproblematik liegt in der veralteten Infrastruktur der Stromkaje in den Bereichen CT1 bis CT3a, die zwischen Ende der 1960er Jahre und Anfang der 2000er Jahre errichtet wurde. Diese Kajenabschnitte sind weder statisch noch technisch in der Lage, die heute erforderlichen großen Containerbrücken zu tragen oder moderne Megaschiffe mit der notwendigen Leistungsfähigkeit abzufertigen.
Die Containerriesen von heute sind fundamental anders als ihre Vorgänger: Während die Schiffe in den 1970er Jahren typischerweise 275 Meter lang waren und 3.000 Standardcontainer (TEU) transportierten, erreichen die heutigen Mega-Boxer bei 400 Metern Länge und doppelter Breite eine Stellplatzkapazität von bis zu 24.000 TEU – das ist das Achtfache der ursprünglichen Kapazität. Mit Tiefgängen von mehr als 16 Metern stellen diese Schiffe zusätzliche Anforderungen an die Hafeninfrastruktur.
Ein weiteres kritisches Problem betrifft die Wellenkammer, einen halb offenen Tunnel unter der Kaje, der bei Sturm den Wellengang auffangen soll. Hier zeigt sich erheblicher Korrosionsschaden am Stahlbeton. Statische Untersuchungen haben ergeben, dass eine einfache Sanierung nicht ausreichen würde – sie würde 60 bis 75 Prozent der Kosten einer kompletten Erneuerung verursachen, ohne dass die Kajen die aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllen könnten.
Welche Investitionssummen sind für die Modernisierung erforderlich?
Die Zahlen sind beeindruckend und verdeutlichen die Dimension der anstehenden Transformation. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt beziffert den Gesamtinvestitionsbedarf für den Bremerhavener Containerterminal auf 950 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Allein für die Erneuerung der Stromkaje werden Kosten im “höheren dreistelligen Millionenbereich” veranschlagt.
Das Land Bremen hat bereits konkrete Schritte eingeleitet. Der Senat stellte für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt 100 Millionen Euro für die erste Baustufe der Stromkajenerneuerung bereit. Nach aktueller Planung will Bremen in den nächsten Jahren insgesamt 120 Millionen Euro in die Sanierung investieren. Die Hafensenatorin konkretisierte die Finanzplanung: Für 2026 werden 20 Millionen Euro benötigt, in den Folgejahren dann jeweils 80 Millionen Euro.
Parallel dazu plant Eurogate als Terminalbetreiber massive Eigeninvestitionen. Das Unternehmen will zusammen mit seinen Partnern in den kommenden Jahren gut zwei Milliarden Euro in die Modernisierung des Terminals investieren. Diese Privatinvestitionen sind jedoch direkt an die Erneuerung der staatlichen Kajeninfrastruktur gekoppelt – ohne moderne Liegeplätze können die privaten Betreiber ihre geplanten Automatisierungsmaßnahmen nicht umsetzen.
Wie sieht die neue Automatisierungstechnologie aus?
Die technologische Revolution hat bereits begonnen. Als Vorbote der kommenden Vollautomatisierung ging im Juli 2025 das neue Rail Gate Bremerhaven in Betrieb – eine hochmoderne Bahnumschlaganlage für den kombinierten Ladungsverkehr. Diese 70 Millionen Euro teure Anlage demonstriert die Zukunftstechnologie: Auf sechs Umschlagsgleisen mit einer Länge von jeweils 762 Metern können bis zu 750 Meter lange Containerzüge abgefertigt werden.
Die revolutionäre Neuerung liegt in der Fernsteuerung der Kräne. Vier große Portalkräne werden nicht mehr von Kranführern in Glaskanzeln bedient, sondern von sogenannten Remote Crane Operators (RCO) aus einem Leitstand im Gatehaus gesteuert. Innovative Sensorik und modernste Kamerasysteme an den Kränen unterstützen die Bediener und übernehmen teilweise auch die digitale Verarbeitung von Containerdaten.
Diese Anlage ist nur der erste Schritt einer umfassenden Digitalisierungsstrategie. Eurogate-Chef Michael Blach bezeichnete die Inbetriebnahme als “ersten großen Meilenstein” für die Weiterentwicklung des Terminalstandorts. Das neue Rail Gate dient als Testfeld für die kommende Vollautomatisierung der Containerbrücken am Kai.
Was bedeutet die Automatisierung für die Arbeitsplätze?
Die Automatisierung verändert fundamental die Arbeitsprofile im Hafen, ohne zwangsläufig Arbeitsplätze zu vernichten. Das neue Berufsbild des Remote Crane Operators zeigt exemplarisch diese Transformation: Anstatt in luftiger Höhe in einer Krankabine zu sitzen, arbeiten diese Fachkräfte nun in ergonomischen Leitständen an modernsten Computerarbeitsplätzen.
Die Vorteile sind vielfältig: Verbesserte Arbeitssicherheit, da die Bediener nicht mehr den Witterungseinflüssen und der körperlichen Belastung in den Krankabinen ausgesetzt sind. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie präzisere Arbeitsabläufe und eine bessere Datenerfassung. Ein Remote Crane Operator kann theoretisch mehrere Kräne überwachen und bei Bedarf zwischen verschiedenen Anlagen wechseln.
Eurogate hat bereits in der sechsmonatigen Testphase des Rail Gate positive Erfahrungen mit dem neuen Arbeitsmodell gesammelt. Die Technologie zeigt ihre Vorteile gegenüber der bisherigen manuellen Bedienung von Bahnkränen. Für die Beschäftigten bedeutet dies Weiterbildungsmöglichkeiten und den Übergang zu anspruchsvolleren, technologieorientierten Tätigkeiten.
Welche Rolle spielt der Bund bei der Hafenfinanzierung?
Die Finanzierungsfrage ist verfassungsrechtlich komplex und politisch umstritten. Christoph Ploß, der seit Mai 2025 als Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft fungiert, machte bei seinem Antrittsbesuch in Bremen die rechtlichen Grenzen deutlich: Verfassungsrechtlich sind aktuell die Länder für die Finanzierung von Hafenanlagen zuständig. Diese Zuständigkeitsverteilung basiert auf der föderalen Struktur des Grundgesetzes, wonach Hafenpolitik grundsätzlich Ländersache ist.
Dennoch sieht Ploß Handlungsbedarf: “Hafenpolitik müsse als nationale Aufgabe verstanden werden”, betonte der Maritime Koordinator. Er kündigte an, sich für eine Änderung der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen einzusetzen, um ein stärkeres finanzielles Engagement der Bundesregierung zu ermöglichen.
Der Bund kann jedoch bereits heute in bestimmten Bereichen aktiv werden. Bei der Umrüstung norddeutscher Häfen zu Umschlagplätzen für neue Energiearten wie Methanol, Ammoniak, Wasserstoff oder E-Fuels hat Ploß Bundesbeteiligung zugesagt, da hierfür Milliarden an Investitionen notwendig seien. Diese Zusage steht im Kontext der Energiewende und der nationalen Bedeutung der Häfen als “Energy Hubs”.
Warum fordern die Küstenländer mehr Bundesengagement?
Die Küstenländer argumentieren mit der nationalen und europäischen Bedeutung ihrer Häfen. Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt forderte angesichts der 950 Millionen Euro Investitionsbedarf, dass auch die Südländer für die Hafenkosten aufkommen sollten, “denn dort bleibe schließlich auch die Wertschöpfung und das Steueraufkommen”. Dieses Argument zielt auf die ökonomische Realität: Während die Häfen in den Küstenländern liegen, profitiert ganz Deutschland von den importierten Gütern und der damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivität.
Die Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen haben in der “Bremer Erklärung” eine “Zeitenwende” bei der Hafenfinanzierung gefordert. Sie verlangen vom Bund eine massive Ausweitung der Hafenfinanzierung auf 400 Millionen Euro jährlich allein für die Infrastruktur. Zur Begründung führen sie an, dass sich die Kosten seit 2005 ungefähr verzehnfacht haben, während der Bund weiterhin nur 38,3 Millionen Euro jährlich an die Länder zahlt.
Diese Forderung hat auch eine strategische Dimension: Deutsche Häfen stehen im intensiven Wettbewerb mit den sogenannten Westhäfen Rotterdam und Antwerpen sowie zunehmend mit Häfen im Mittelmeerraum und Baltikum. Ohne ausreichende Investitionen in die Infrastruktur droht ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und damit ein Rückgang der wirtschaftlichen Bedeutung der deutschen Hafenstandorte.
Ihre Container-Hochregallager- und Container-Terminal-Experten

Container-Hochregallager und Container-Terminals: Das logistische Zusammenspiel – Experten Beratung und Lösungen - Kreativbild: Xpert.Digital
Diese innovative Technologie verspricht, die Containerlogistik grundlegend zu verändern. Anstatt Container wie bisher horizontal zu stapeln, werden sie in mehrstöckigen Stahlregalkonstruktionen vertikal gelagert. Dies ermöglicht nicht nur eine drastische Erhöhung der Lagerkapazität auf gleicher Fläche, sondern revolutioniert auch die gesamten Abläufe im Containerterminal.
Mehr dazu hier:
Häfen im Umbruch: Warum Bremerhaven mehr Bundesgeld und Rechtssicherheit braucht
Welche verfassungsrechtlichen Hürden bestehen?
Die verfassungsrechtliche Situation ist komplex und historisch gewachsen. Das Grundgesetz weist die Zuständigkeit für Hafenangelegenheiten grundsätzlich den Ländern zu. Diese Kompetenzverteilung spiegelt das föderale Prinzip wider, wonach Infrastruktur mit regionalem Bezug in die Länderverantwortung fällt.
Allerdings gibt es bereits heute Ausnahmen und Sonderregelungen. Im Länderfinanzausgleich werden die sogenannten “Hafenlasten” berücksichtigt – ein System, das das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt hat. Danach können die Küstenländer etwa die Hälfte ihrer Nettohafenlasten von ihren Steuereinnahmen absetzen, bevor diese in die Berechnung des Länderfinanzausgleichs eingehen.
Für Finanzhilfen des Bundes an die Länder bestehen grundsätzlich Möglichkeiten nach Artikel 104b des Grundgesetzes. Diese Vorschrift erlaubt Bundesfinanzhilfen für “besonders bedeutsame Investitionen”, die zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur beitragen. Hafenprojekte können durchaus unter diese Kategorie fallen, wenn sie überregionale Bedeutung haben.
Ein praktisches Beispiel zeigt der kombinierte Ladungsverkehr: Der Bund fördert bereits den Bau von Umschlaganlagen für den Schienen-Güterverkehr, um mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Das Rail Gate Bremerhaven profitierte von dieser Förderung, da der Großteil der 70 Millionen Euro Baukosten vom Bund getragen wurde.
Wie entwickelt sich die internationale Konkurrenz?
Die Wettbewerbssituation der deutschen Häfen hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschärft. Die etablierten Westhäfen Rotterdam und Antwerpen investieren kontinuierlich in ihre Infrastruktur und Automatisierungstechnologie. Rotterdam als größter europäischer Hafen hat bereits umfassende Automatisierungsprojekte umgesetzt und plant weitere Milliardsinvestitionen.
Gleichzeitig entstehen neue Konkurrenten: Häfen im Mittelmeerraum profitieren von ihrer geografischen Nähe zu den Suezkanal-Routen und können als erste Anlaufpunkte für Asien-Europa-Verkehre dienen. Häfen wie Piraeus in Griechenland oder Valencia in Spanien haben ihre Kapazitäten massiv ausgebaut und moderne Automatisierungstechnologie implementiert.
Auch im Baltikum entwickeln sich leistungsfähige Hafenstandorte, die den norddeutschen Häfen Marktanteile streitig machen können. Diese internationale Konkurrenzsituation verstärkt den Druck auf deutsche Häfen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Der Hamburger Hafen, Deutschlands größter Containerhafen, musste im ersten Halbjahr 2025 einen Rückgang des Containerumschlags um 11,7 Prozent hinnehmen. Solche Entwicklungen verdeutlichen die Dringlichkeit von Modernisierungsinvestitionen. Im EU-weiten Vergleich hält Hamburg zwar noch den dritten Platz hinter Rotterdam und Antwerpen, aber der Abstand zu den Konkurrenten vergrößert sich.
Welche Bedeutung haben die Häfen für die Energiewende?
Die deutschen Häfen stehen im Zentrum der Energiewende und entwickeln sich zu unverzichtbaren “Energy Hubs”. Diese Transformation geht weit über den traditionellen Güterumschlag hinaus und macht die Häfen zu strategischen Infrastrukturelementen der deutschen Klimapolitik.
Deutschland deckt etwa 70 Prozent seines Energieaufkommens durch Importe. Während bisher fossile Energieträger wie Mineralöl, Gas und Steinkohle über die Häfen importiert wurden, werden künftig grüne Energieträger wie Wasserstoff und seine Derivate eine zentrale Rolle spielen. Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht die Häfen als Schlüsselinfrastruktur für den Import und die Verteilung dieser neuen Energieträger.
Gleichzeitig fungieren die Häfen als Basishäfen für den Ausbau der Offshore-Windenergie. Der Bau und die Wartung von Windparks auf See erfordern den Umschlag extrem schwerer Komponenten wie Fundamenten, Turmsegmenten und Rotorblättern. Schätzungen zufolge werden allein für den Neubau von Offshore-Windparks bis 2029 bis zu 200 Hektar zusätzlicher schwerlastfähiger Flächen benötigt.
Diese doppelte Funktion – als Import-Drehscheibe für grüne Energieträger und als Servicebasen für die Offshore-Windenergie – unterstreicht die nationale Bedeutung der Hafeninfrastruktur. Maritime Koordinator Ploß verwies explizit auf diese Rolle, als er Bundesbeteiligung bei der Umrüstung zu Energieumschlagplätzen zusagte.
Was passiert mit der traditionellen Hafenwirtschaft?
Der Strukturwandel in der Hafenwirtschaft ist bereits in vollem Gange, aber er vollzieht sich evolutionär und nicht revolutionär. Die traditionellen Umschlagfunktionen bleiben bestehen, werden aber durch neue Technologien und zusätzliche Aufgaben ergänzt.
Im Containerbereich zeigt sich diese Evolution deutlich: Während die Grundfunktion – das Be- und Entladen von Schiffen – unverändert bleibt, ändern sich die Methoden fundamental. Die neuen ferngesteuerten Kräne im Rail Gate Bremerhaven demonstrieren diese Entwicklung: Dieselbe Arbeit wird präziser, sicherer und effizienter erledigt.
Der Bahnanteil beim Gütertransport entwickelt sich positiv: Bremerhaven verfügt über einen Bahnanteil von mehr als 50 Prozent beim Containertransport ins Hinterland, was europaweit nur noch Hamburg in ähnlicher Größenordnung erreicht. Das neue Rail Gate mit einer Kapazität von 330.000 Containern pro Jahr soll diese Position weiter stärken.
Parallel entstehen völlig neue Geschäftsfelder: Häfen werden zu Logistikzentren für die Energiewende, zu Produktionsstandorten für grünen Wasserstoff und zu Servicezentren für die Offshore-Windenergie. Diese Diversifikation schafft neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung, die den Strukturwandel in anderen Bereichen kompensieren können.
Wie ist der aktuelle Stand bei der Sail Bremerhaven 2025?
Die Sail Bremerhaven 2025 wurde zu einem besonderen politischen und kulturellen Ereignis, das die Bedeutung des Hafenstandorts unterstrich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete am 13. August 2025 persönlich das internationale Windjammerfestival und gab an Bord der “Gorch Fock” das Startsignal für die Veranstaltung.
Die Dimension der Veranstaltung war beeindruckend: 250 Schiffe aus 15 Nationen nahmen teil, darunter das Flaggschiff “Alexander von Humboldt II”, die “Union” aus Peru als größtes Segelschulschiff Südamerikas und die “Shabab Oman II” aus dem Sultanat Oman. Über 1,2 Millionen Besucher wurden in die Seestadt gelockt.
Maritime Koordinator Christoph Ploß nutzte seinen Besuch zur Sail-Eröffnung für intensive Gespräche über die Hafenfinanzierung. Er besuchte die Bremer Lürssen Werft, den Bremer Kalihafen und den Bremerhavener Containerterminal. Diese Kombination aus kulturellem Fest und politischen Gesprächen verdeutlichte symbolisch die Verbindung zwischen maritimer Tradition und moderner Hafenwirtschaft.
Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte betonte bei der Eröffnung die internationale Ausstrahlung der Veranstaltung: “Dass diese Schiffe ihre Routen extra so legen, dass sie die fünf maritimen Tage hier verbringen können, das ist der eindrucksvolle Beleg dafür, dass die Sail Bremerhaven ein ganz besonderes Windjammer- und Schiffs-Festival ist”.
Welche Lehren lassen sich aus anderen deutschen Häfen ziehen?
Der Blick auf andere deutsche Hafenstandorte zeigt sowohl erfolgreiche Automatisierungsansätze als auch die Herausforderungen der Finanzierung. Hamburg als größter deutscher Containerhafen geht mit der Westerweiterung einen ähnlichen Weg wie Bremerhaven: Gesamtkosten von 1,1 Milliarden Euro für die Infrastruktur plus mindestens 700 Millionen Euro private Investitionen von Eurogate.
Der Hamburger Container Terminal Altenwerder (CTA) gilt bereits seit 2002 als einer der weltweit modernsten automatisierten Terminals. Die dort gesammelten Erfahrungen mit fahrerlosen Containertransportern (AGV) und softwaregesteuerten Portalkransystemen fließen in die Planungen für Bremerhaven ein.
Wilhelmshaven zeigt mit dem JadeWeserPort-Projekt, wie Automatisierungstechnologie getestet werden kann: Eurogate führte dort das Pilotprojekt “STRADegy” durch, bei dem automatisch fahrende Straddle Carrier unter realen Bedingungen erprobt wurden. Diese Erfahrungen aus dem Testfeld kommen nun der Entwicklung in Bremerhaven zugute.
Die Erkenntnisse aus Hamburg und Wilhelmshaven bestätigen: Automatisierung ist kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit im internationalen Wettbewerb. Die Investitionen sind hoch, aber ohne diese Modernisierung droht der Verlust von Marktanteilen an konkurrierende Häfen.
Was sind die langfristigen Perspektiven?
Die Zukunft der deutschen Hafenwirtschaft wird von mehreren Megatrends geprägt: Digitalisierung, Automatisierung, Dekarbonisierung und die Energiewende. Bremerhaven positioniert sich strategisch für diese Herausforderungen, aber der Erfolg hängt von der Finanzierung der notwendigen Infrastrukturinvestitionen ab.
Die geplante Erneuerung der Stromkaje wird sich über 15 bis 20 Jahre erstrecken und das größte Hafenbauprojekt in der Geschichte Bremens darstellen. Parallel dazu will Eurogate schrittweise die Automatisierung vorantreiben, sobald die Kajeninfrastruktur erneuert ist. Diese Kombination aus öffentlichen und privaten Investitionen in Höhe von insgesamt über drei Milliarden Euro könnte Bremerhaven zu einem der modernsten Containerhäfen Europas machen.
Die Rolle als Energiedrehscheibe bietet zusätzliche Wachstumschancen: Import von grünem Wasserstoff, Service für Offshore-Windparks und Umschlag von Komponenten für die Energiewende könnten neue Geschäftsfelder erschließen. Diese Diversifikierung macht den Hafen weniger abhängig vom traditionellen Containergeschäft und schafft Resilienz gegen konjunkturelle Schwankungen.
Entscheidend bleibt die Lösung der Finanzierungsfrage. Ohne eine stärkere Bundesbeteiligung werden die Küstenländer die erforderlichen Investitionen kaum allein stemmen können. Maritime Koordinator Ploß hat angekündigt, sich für eine verfassungsrechtliche Neuregelung einzusetzen. Sollte dies gelingen, könnte Deutschland seine Häfen zu den leistungsfähigsten und modernsten Europas entwickeln.
Die technologische Innovation hat bereits begonnen – das Rail Gate Bremerhaven ist der Beweis dafür. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent fortzusetzen und die notwendigen finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Deutschland seine Rolle als bedeutende Seehandelsnation erfolgreich in das digitale Zeitalter übertragen kann.
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Head of Business Development
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder
mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.