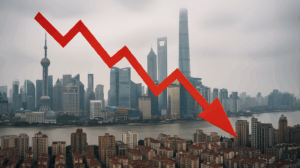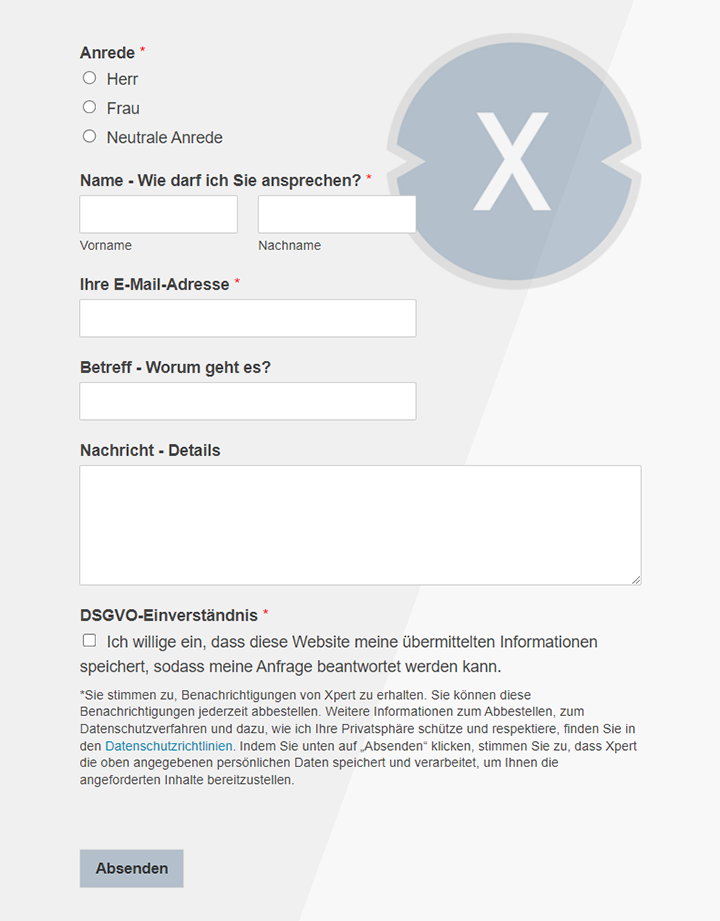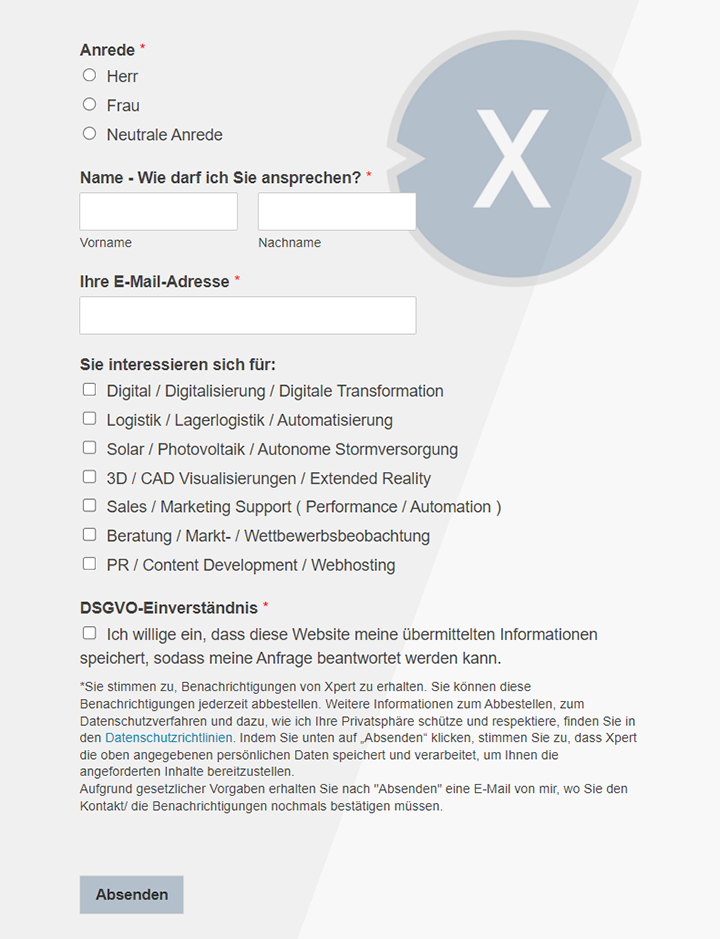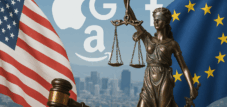Die chinesische Wirtschaft am Wendepunkt: Wenn selbst Giganten wie BYD ins Wanken geraten
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 11. Juli 2025 / Update vom: 11. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die chinesische Wirtschaft am Wendepunkt: Wenn selbst Giganten wie BYD ins Wanken geraten – Kreativbild: Xpert.Digital
Chinas Wirtschaftswunder bröckelt: BYD-Krise offenbart strukturelle Schwächen des Systems
Von Weltmarktführer zu Produktionsstopp: Wie BYDs Absturz Chinas Wirtschaftsprobleme enthüllt
Die chinesische Wirtschaft, lange Zeit als unaufhaltsame Wachstumsmaschine gefeiert, zeigt zunehmend bedenkliche Risse im Fundament. Was einst als das Wirtschaftswunder des 21. Jahrhunderts galt, offenbart nun strukturelle Schwächen, die das gesamte System erschüttern könnten. Besonders alarmierend ist, dass selbst Branchenführer wie der Elektroautohersteller BYD, der noch vor kurzem als Symbol für Chinas technologischen Aufstieg galt, nun mit erheblichen Schwierigkeiten kämpft.
Die Verzweiflung bei BYD ist symptomatisch für eine tiefgreifende Krise, die weit über einzelne Unternehmen hinausgeht. Der Elektroautogigant, der sich in wenigen Jahren vom unbekannten Batteriehersteller zum weltgrößten Produzenten von Elektrofahrzeugen entwickelte, musste in den vergangenen Monaten seine Produktion drastisch drosseln. In mindestens vier der sieben Werke in China wurden die Fertigungskapazitäten um bis zu ein Drittel reduziert. Nachtschichten wurden gestrichen, geplante Erweiterungen auf Eis gelegt. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da BYD noch 2023 den deutschen Volkswagen-Konzern als Marktführer in China ablöste und 2024 sogar Tesla als größten Elektroautohersteller weltweit überholte.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während BYD für 2025 ein ambitioniertes Verkaufsziel von 5,5 Millionen Fahrzeugen ausgegeben hatte, zeigt die Realität ein anderes Bild. Im ersten Quartal 2025 wuchs der Absatz des Unternehmens nur um magere 5,5 Prozent, während der chinesische Elektroautomarkt insgesamt um über 45 Prozent zulegte. Besonders dramatisch ist die Situation bei den Lagerbeständen: Ende Mai 2025 stapelten sich über 340.000 unverkaufte BYD-Fahrzeuge auf den Höfen der Händler – ein Vorrat von mehr als drei Monaten.
Passend dazu:
- China unter Druck: Grenzen des Exportmodells der zweitgrößten Volkswirtschaft und die Herausforderungen der Transformation
Der ruinöse Preiskrieg und seine Folgen
In ihrer Verzweiflung griff BYD zu drastischen Maßnahmen. Im Mai 2025 senkte das Unternehmen die Preise bei 22 Modellen um bis zu 34 Prozent. Der beliebte Mini-Hatchback Seagull wird nun für umgerechnet knapp 7.800 US-Dollar angeboten – ein Preis, der weit unter den Produktionskosten vieler westlicher Hersteller liegt. Diese aggressive Preispolitik löste eine Kettenreaktion aus: Konkurrenten wie Geely, Chery und SAIC-GM zogen nach, ein ruinöser Preiskrieg entbrannte.
Die Auswirkungen dieser Rabattschlacht sind verheerend. Gewinnmargen schmelzen dahin, Zulieferer geraten unter enormen Druck. BYD benötigte 2023 durchschnittlich 275 Tage, um seine Lieferanten zu bezahlen – die Zulieferer werden faktisch zu unfreiwilligen Kreditgebern. Analysten schätzen, dass BYDs wahre Verschuldung bei etwa 39 Milliarden Euro liegt, während offiziell nur 3,3 Milliarden Euro ausgewiesen werden. Die Differenz entsteht durch die systematische Verzögerung von Zahlungen an Geschäftspartner.
Wei Jianjun, CEO des Autoherstellers Great Wall Motor, warnte bereits im Mai vor einer Entwicklung, die an die katastrophale Immobilienkrise erinnert. Er sprach von einem Evergrande der Autoindustrie, das noch nicht explodiert sei. Seine Worte erwiesen sich als prophetisch: Die Situation verschärfte sich derart, dass selbst die chinesische Regierung eingreifen musste. Die Parteizeitung Renmin Ribao schrieb von ungeordneten Preiskriegen, die Gewinne über die gesamte Lieferkette hinweg vernichteten.
Die strukturellen Probleme der chinesischen Wirtschaft
Die Krise in der Automobilindustrie ist nur die Spitze des Eisbergs. Chinas Wirtschaft kämpft mit fundamentalen strukturellen Problemen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Das investitionsgetriebene Wachstumsmodell der vergangenen Jahrzehnte stößt zunehmend an seine Grenzen. Mit einer Investitionsquote von über 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – außergewöhnlich hoch im internationalen Vergleich – wird es immer schwieriger, Kapital gewinnbringend anzulegen.
Die totale Faktorproduktivität, ein Maß für die Effizienz der Wirtschaft, sinkt in China seit mindestens 2014 kontinuierlich. Dies deutet auf zunehmende allokative und technologische Ineffizienzen hin. In vielen Branchen des verarbeitenden Gewerbes haben sich erhebliche Überkapazitäten aufgebaut. Die chinesische Autoindustrie kann fast doppelt so viele Fahrzeuge produzieren, wie tatsächlich verkauft werden. Die Fabriken laufen mit einer durchschnittlichen Auslastung von nur 49,5 Prozent.
Das offizielle Wirtschaftswachstum von 5 Prozent für 2024 wird von vielen Experten angezweifelt. Unabhängige Analysten wie die des Forschungsunternehmens Rhodium Group schätzen, dass das tatsächliche Wachstum nur zwischen 2,4 und 2,8 Prozent lag. Die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und der wirtschaftlichen Realität wird immer größer.
Die Immobilienkrise als Brandbeschleuniger
Parallel zur Krise in der Automobilindustrie verschärft sich die bereits seit Jahren schwelende Immobilienkrise. Der Sektor, der einst bis zu einem Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung ausmachte, befindet sich in einer Abwärtsspirale. Die Hauspreise fallen seit 21 Monaten in Folge. Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die Preise bis 2027 um weitere 10 Prozent sinken könnten – zusätzlich zu den bereits erfolgten Rückgängen von 20 Prozent.
Die Krise begann 2021 mit strengeren Kreditvorschriften, die das finanzielle Risiko im Sektor reduzieren sollten. Was als vorsichtige Regulierung gedacht war, entwickelte sich zu einem Flächenbrand. Die Pleite des Immobiliengiganten Evergrande war nur der Anfang. Millionen von Wohnungen, die bereits verkauft wurden, bleiben unfertig. Das Vertrauen der Konsumenten ist erschüttert, viele Haushalte stehen vor negativem Eigenkapital – der Wert ihrer Immobilie liegt unter der ausstehenden Hypothekenschuld.
Die Regierung versucht verzweifelt, den Sektor zu stabilisieren. Ein 300 Milliarden Yuan schweres Ankaufprogramm soll Lokalregierungen ermöglichen, unverkaufte Immobilien zu erwerben und in Sozialwohnungen umzuwandeln. Doch diese Maßnahmen wirken wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Einnahmen der Lokalregierungen aus Landverkäufen, ihre wichtigste Finanzierungsquelle, brachen 2024 um 16 Prozent ein.
Passend dazu:
- “Werkbank der Welt” – Chinas Wirtschaftstransformation: Die Grenzen des Exportmodells und der steinige Weg zur Binnenwirtschaft
Die schwächelnde Binnennachfrage
Ein zentrales Problem der chinesischen Wirtschaft ist die schwache Binnennachfrage. Die Konsumenten halten ihr Geld zusammen, verunsichert durch die Immobilienkrise und eine Jugendarbeitslosigkeit von 16 Prozent. Die Verbraucherpreise stagnieren, teilweise herrscht sogar Deflation – ein Alarmsignal für eine Wirtschaft, die auf Wachstum angewiesen ist.
Diese Konsumzurückhaltung trifft nicht nur chinesische Unternehmen. Europäische Firmen in China berichten von der schlechtesten Stimmung seit Jahren. Nur noch 29 Prozent der befragten Unternehmen der EU-Handelskammer sind optimistisch bezüglich ihrer Wachstumsaussichten in China für die kommenden zwei Jahre. Der erbitterte Preiskampf in vielen Branchen drückt auf die Gewinne, die Planbarkeit schwindet.
Chinas verlorenes Jahrzehnt? Parallelen zu Japans Wirtschaftskrise der 1990er Jahre
Die internationale Dimension: EU-China-Beziehungen unter Spannung
Die wirtschaftlichen Turbulenzen in China haben weitreichende internationale Auswirkungen. Der für Ende Juli geplante EU-China-Gipfel findet in einer Atmosphäre zunehmender Spannungen statt. Die Handelsbeziehungen, mit einem jährlichen Volumen von über 700 Milliarden Euro eigentlich von enormer Bedeutung für beide Seiten, werden durch gegenseitige Vorwürfe und protektionistische Maßnahmen belastet.
Die EU hat Zölle von bis zu 45 Prozent auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt, um die heimische Industrie vor der Flut subventionierter Importe zu schützen. China reagierte mit Gegenzöllen auf europäische Produkte, darunter bis zu 34,9 Prozent auf Branntweinimporte. Die Eskalationsspirale dreht sich weiter: Exportkontrollen auf seltene Erden, Beschränkungen bei Medizinprodukten, gegenseitige Vorwürfe unfairer Handelspraktiken.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem neuen China-Schock, da die Volksrepublik die Weltmärkte mit subventionierten Überkapazitäten überschwemme. Das System sei eindeutig manipuliert. Gleichzeitig betont sie, dass eine vollständige Abkopplung von China weder effizient noch effektiv wäre. Europa setzt weiterhin auf ein zielorientiertes Engagement, fordert aber faire Wettbewerbsbedingungen.
Passend dazu:
Der Exportdruck als Ventil
Mit dem überhitzten Heimatmarkt und schwacher Binnennachfrage wächst der Druck auf chinesische Unternehmen, ihre Überkapazitäten ins Ausland zu exportieren. Bereits 20 Prozent aller in China produzierten Fahrzeuge gehen in den Export – Tendenz steigend. BYD baut nicht nur Werke in der Türkei und Ungarn, sondern plant auch eine Fabrik in Deutschland.
Doch die Exportmärkte werden enger. Die USA haben mit 100-Prozent-Zöllen auf chinesische Elektroautos den Markt praktisch verschlossen. Japan und Korea könnten folgen. Die EU bleibt als einer der wenigen großen Absatzmärkte, doch auch hier wächst der Widerstand gegen die Importflut.
Die Regierung greift ein – mit fraglichem Erfolg
Angesichts der sich zuspitzenden Krise sah sich die chinesische Regierung zum Handeln gezwungen. Die Chefs von über einem Dutzend Autohersteller wurden nach Peking zitiert. Die Botschaft war klar: Keine Verkäufe unter Selbstkosten mehr, Schluss mit der Praxis der Null-Kilometer-Gebrauchtwagen, faire Behandlung von Zulieferern. 17 Autobauer versprachen daraufhin, ihre Zahlungsfristen auf maximal 60 Tage zu begrenzen.
Doch diese Interventionen wirken wie der Versuch, einen Waldbrand mit Gießkannen zu löschen. Die strukturellen Probleme – Überkapazitäten, zu viele Hersteller, fehlendes Vertrauen der Konsumenten – bleiben ungelöst. Von den 169 Autoherstellern in China haben mehr als die Hälfte weniger als 0,1 Prozent Marktanteil. Analysten erwarten eine brutale Marktbereinigung, bei der nur fünf bis sieben dominante Marken überleben werden.
Die technologische Herausforderung
Chinas Antwort auf die Wachstumsschwäche ist die Förderung neuer Produktivkräfte durch technologische Innovation. Doch auch diese Strategie ist voller Widersprüche. Das Streben nach technologischer Eigenständigkeit bedeutet einen bewussten Verzicht auf die Vorteile internationaler Arbeitsteilung. Wenn traditionelle Industrien trotz mangelnder Wettbewerbsfähigkeit im Land gehalten werden sollen, wenn Vorleistungen aus politischen Gründen selbst produziert werden müssen statt sie günstiger zu importieren, leidet die Effizienz.
Die zunehmend kleinteilige staatliche Planung und Steuerung von Forschung und Innovation könnte Kreativität und Produktivität langfristig schwächen. Internationale Unternehmen und Wissenschaftler werden durch die stärker an chinesischen strategischen Interessen ausgerichtete Politik abgeschreckt. Der Technologietransfer, von dem China jahrzehntelang profitierte, versiegt.
Ein verlorenes Jahrzehnt?
Die Parallelen zu Japans verlorenem Jahrzehnt nach dem Platzen der Immobilienblase in den 1990er Jahren sind unübersehbar. Überkapazitäten, faule Kredite, deflationäre Tendenzen, sinkende Produktivität – all diese Symptome zeigt nun auch China. Doch es gibt wichtige Unterschiede: China ist noch immer ein Entwicklungsland mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen, die Urbanisierung schreitet voran, das Potenzial für Aufholwachstum besteht theoretisch noch.
Die Frage ist, ob die politische Führung bereit ist, die notwendigen schmerzhaften Reformen durchzuführen. Eine echte Marktbereinigung würde Massenentlassungen und Firmenpleiten bedeuten – politisch heikel in einem System, das seine Legitimität aus wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Stabilität bezieht. Die Alternative, das Weiterwursteln mit staatlichen Subventionen und Marktinterventionen, droht die Probleme nur zu verschleppen und zu vergrößern.
Passend dazu:
- Soziale Stabilität über alles: China stützt Verlust-Unternehmen und die Kosten politischer Prioritäten
Globale Auswirkungen
Die Krise in China hat weitreichende globale Folgen. Deutsche Automobilhersteller, die jahrzehntelang vom chinesischen Markt profitierten, verzeichnen zweistellige Absatzrückgänge. Der Marktanteil ausländischer Marken in China ist von 64 Prozent im Jahr 2020 auf nur noch 30,6 Prozent gesunken. Selbst bei Verbrennungsmotoren, lange eine Domäne westlicher Hersteller, verkauft Geely inzwischen mehr als Toyota.
Die Überkapazitäten in China drohen globale Märkte zu destabilisieren. Wenn chinesische Hersteller ihre Überschussproduktion zu Dumpingpreisen exportieren, geraten Produzenten weltweit unter Druck. Handelskonflikte verschärfen sich, protektionistische Maßnahmen nehmen zu. Die Vision einer integrierten Weltwirtschaft weicht einem Flickenteppich aus Handelsblöcken und Zollschranken.
Das Ende einer Ära
Die chinesische Wirtschaft steht an einem historischen Wendepunkt. Das Modell des investitionsgetriebenen Wachstums, das China in nur vier Jahrzehnten von einem Entwicklungsland zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt machte, hat ausgedient. Die Symptome der Krise – von BYDs Produktionsdrosselung über die Immobilienblase bis zur schwachen Binnennachfrage – sind Ausdruck tieferliegender struktureller Probleme.
Die Verzweiflung selbst bei Branchenführern wie BYD zeigt, dass niemand immun ist gegen die systemischen Verwerfungen. Der Versuch, durch aggressive Preissenkungen Marktanteile zu sichern, verschärft die Krise nur. Die Überkapazitäten in der Automobilindustrie sind symptomatisch für eine Wirtschaft, die zu viel produziert und zu wenig konsumiert.
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob China den schwierigen Übergang zu einem nachhaltigeren, konsumgetriebenen Wachstumsmodell schafft. Die Alternative – eine lange Phase der Stagnation bei steigenden sozialen Spannungen – hätte nicht nur für China, sondern für die gesamte Weltwirtschaft gravierende Folgen. Der bevorstehende EU-China-Gipfel wird ein wichtiger Test dafür sein, ob trotz aller Spannungen noch Raum für konstruktive Zusammenarbeit besteht. Die Zeit drängt, denn wenn selbst Giganten wie BYD ins Wanken geraten, steht mehr auf dem Spiel als nur die Zukunft einzelner Unternehmen – es geht um die Stabilität des gesamten globalen Wirtschaftssystems.
Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein
Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.
Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.
Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.
Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus