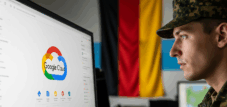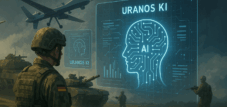Trotz Warnungen und sehenden Auges: Das erneute Versagen der neuen Bundeswehr-Digitalfunkgeräte
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 29. September 2025 / Update vom: 29. September 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Trotz Warnungen und sehenden Auges: Das erneute Versagen der neuen Bundeswehr-Digitalfunkgeräte – Kreativbild: Xpert.Digital
Ein Desaster mit Ansage: Warum das neue Milliarden-Funkgerät der Bundeswehr scheitern musste
Zu groß, zu komplex, zu stromhungrig: Die Pannenserie beim neuen Bundeswehr-Funk
Die neuen Digitalfunkgeräte der Bundeswehr sind erneut gescheitert, und dieses Versagen hat tieferliegende strukturelle und technische Ursachen, die bereits seit Jahren bekannt waren. Das Projekt Digitalisierung Landbasierte Operationen, kurz D-LBO, ist mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro aus dem Sondervermögen eines der wichtigsten Modernisierungsvorhaben der Streitkräfte und sollte die veraltete analoge Funktechnik durch moderne, abhörsichere digitale Systeme ersetzen.
Die Problematik zeigt sich auf zwei Hauptebenen: Zum einen versagen die neuen VR500-Funkgeräte von Rohde & Schwarz in der praktischen Anwendung aufgrund schwerwiegender Software-Probleme. Zum anderen erweisen sich die Geräte als physisch und technisch inkompatibel mit den vorhandenen Bundeswehrfahrzeugen.
Software-Probleme bei der Bedienung der VR500-Funkgeräte
Der gravierendste Mangel liegt in der überkomplexen Bedienungssoftware der digitalen Funkgeräte. Bei einem entscheidenden Systemtest im Mai 2025 auf dem Truppenübungsplatz Munster musste die Erprobung vorzeitig abgebrochen werden, da die Geräte als nicht truppentauglich eingestuft wurden. Diese Bewertung ist besonders schwerwiegend, da sie die grundlegende Einsatzfähigkeit der Systeme in Frage stellt.
Die Software-Probleme manifestieren sich in mehreren kritischen Bereichen. Die Bedienungsoberfläche erwies sich als derart kompliziert, dass Soldaten nur mit erheblichen Schwierigkeiten und zeitraubenden Prozessen Funkkreise aufbauen konnten. Dies ist ein fundamentaler Mangel, da die schnelle und intuitive Etablierung von Kommunikationsverbindungen im militärischen Einsatz überlebenswichtig ist.
Besonders problematisch ist das Versagen bei Standardtests, bei denen Kommandeure schnell zwischen verschiedenen Funknetzen wechseln müssen. Diese Funktionalität ist essentiell für die moderne Gefechtsführung, da militärische Führungskräfte flexibel zwischen verschiedenen Kommunikationsebenen und Einheiten koordinieren müssen. Das komplette Scheitern dieses Tests zeigt, dass die Software den grundlegenden militärischen Anforderungen nicht gerecht wird.
Zusätzlich traten instabile Sprechfunkverbindungen auf, was selbst die elementarste Kommunikationsfunktion beeinträchtigt. Die Software wird von Experten als zu komplex für den Einsatz in Kampfpanzern und unter Gefechtsbedingungen beschrieben, wo einfache und zuverlässige Bedienung unter Stress und zeitkritischen Situationen erforderlich ist.
Rohde & Schwarz arbeitet derzeit unter Hochdruck gemeinsam mit der Bundeswehr an einem umfassenden Software-Update, um diese grundlegenden Mängel zu beheben. Die Notwendigkeit eines solchen Updates nach bereits erfolgter Auslieferung zeigt jedoch, dass die Geräte ohne ausreichende Praxistests in die Erprobung gegangen sind.
Hardware-Integrationsprobleme in die Fahrzeugflotte
Parallel zu den Software-Problemen bestehen massive Schwierigkeiten beim physischen Einbau der Funkgeräte in die vielfältige Fahrzeugflotte der Bundeswehr. Diese Probleme sind bereits seit 2023 bekannt und betreffen etwa 200 verschiedene Fahrzeugtypen, von Kleinbussen über Geländewagen bis zu Kampfpanzern.
Die physische Inkompatibilität zeigt sich in mehreren Dimensionen. Die neuen Funkgeräte sind schlichtweg zu groß und zu schwer für viele der vorgesehenen Fahrzeuge. Passende Adapterplatten für den fachgerechten Einbau fehlen vollständig, und die räumlichen Gegebenheiten in den Fahrzeugen wurden bei der Geräteentwicklung offensichtlich nicht ausreichend berücksichtigt.
Schwerwiegender sind die elektrischen Inkompatibilitäten. Die Batteriekapazitäten vieler Fahrzeuge reichen nicht aus, um die stromhungrigen digitalen Funkstationen zu betreiben. Die Lichtmaschinen sind zu schwach dimensioniert, um die erforderliche stabile Spannung für den Betrieb der High-Tech-Geräte zu liefern. Bei einem Teil der Fahrzeuge sind sogar Veränderungen am Kühlsystem notwendig, um die zusätzliche Wärmeentwicklung der digitalen Systeme zu bewältigen.
Der Umfang des Problems ist beträchtlich. Von den gut 200 verschiedenen Fahrzeugtypen gelang bislang nur bei etwa 30 ein reibungsloser Einbau der neuen Funksysteme. Bei mehr als 80 Fahrzeugtypen laufen die Umrüstarbeiten noch, während bei anderen die Versuche noch nicht einmal begonnen haben. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der Bundeswehrfahrzeuge derzeit nicht mit den neuen digitalen Kommunikationssystemen ausgerüstet werden kann.
Systemische Ursachen und organisatorische Mängel
Die Grundursache für diese Probleme liegt in einer mangelnden Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz. Verschiedene Fachbereiche kommunizierten nicht ausreichend untereinander, wodurch die kritische Frage der Integration vor der Bestellung der Geräte nicht geklärt wurde.
Die technische Komplexität beim Einbau der Funkstationen wurde systematisch unterschätzt. Die Bundeswehr spricht selbst von einer Operation am offenen Herzen, da die Umrüstung parallel zum regulären Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsbetrieb verlaufen muss. Diese parallele Durchführung erhöht die logistische Komplexität erheblich und macht eine präzise Koordination aller beteiligten Akteure unabdingbar.
Es gelang nicht, ein durchgängig konsistentes Lagebild bei allen beteiligten Akteuren zu erzeugen – weder im Bundesministerium der Verteidigung noch bei der Bundeswehr oder den beteiligten Industrieunternehmen. Die bisherige organisatorische Einbettung des Projektes in die Aufbauorganisation der Bundeswehr erwies sich als unzureichend. Die übergreifende Koordination und Kommunikation der betroffenen Stellen erfolgte nicht im erforderlichen Umfang.
Auswirkungen auf das D-LBO-Projekt und die NATO-Verpflichtungen
Diese kombinierten Probleme bedrohen das gesamte milliardenschwere D-LBO-Projekt fundamental. Das ursprüngliche Ziel, bis Ende 2027 eine vollständige Division des Heeres mit den neuen, abhörsicheren Funk-Systemen auszustatten, ist durch die Verzögerungen akut gefährdet. Da Deutschland der NATO ab 2025 die Bereitstellung einer vollständig ausgerüsteten und einsatzbereiten Heeresdivision zugesichert hat, haben die Probleme auch bündnispolitische Dimensionen.
Die Division 2025 kann ohne funktionsfähige digitale Kommunikationssysteme ihre NATO-Aufgaben nicht erfüllen. Mit veralteter analoger Kommunikationstechnik wäre diese Division nicht führungsfähig und könnte nicht interoperabel mit NATO-Partnern operieren. Dies untergräbt Deutschlands Glaubwürdigkeit als verlässlicher Bündnispartner erheblich.
Besonders problematisch ist, dass trotz des Versagens bei den Tests die Systeme weiterhin in Fahrzeuge der schnellen NATO-Eingreiftruppe Panzerbrigade 37 eingebaut werden. Ohne funktionsfähigen Digitalfunk sind diese hochmodernen Waffensysteme jedoch nicht einsatzbereit, was die Verfügbarkeit des deutschen Vorzeigeverbandes drastisch reduziert.
Politische Verantwortung und Kommunikationspannen
Die politische Dimension des Skandals verschärft sich dadurch, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius angeblich erst in der letzten Septemberwoche 2025 über die gravierenden Probleme informiert wurde. Seine Hausleitung war jedoch spätestens seit dem 10. Juni über die katastrophalen Ergebnisse des Systemtests in Munster unterrichtet. Dies wirft schwerwiegende Fragen über die Funktionsfähigkeit der Informationsketten im Ministerium auf.
Noch am 10. September hatte Pistorius im Bundestag versichert, dass es keine Probleme bei dem Projekt gebe und man im Zeitplan liege. Diese Aussage erfolgte drei Monate nach der internen Information über das Versagen der Tests und führt nun zu scharfer Kritik von Parlamentariern, die sich hintergangen fühlen.
Der Minister hat inzwischen Rüstungsstaatssekretär Jens Plötner und Generalinspekteur Carsten Breuer angewiesen, die Probleme aufzuarbeiten und Vorschläge für notwendige Maßnahmen zur zügigen Behebung vorzulegen. Die vom Minister nach den ersten Problemen eingerichtete Koordinierungsstelle im Beschaffungsamt, die ihn direkt informieren sollte, hat offensichtlich ihre Aufgabe nicht erfüllt.
Technische Standards und NATO-Interoperabilität
Ein zusätzlicher Aspekt der Problematik liegt in der Komplexität der NATO-Standardisierung. Die neuen Funkgeräte müssen nicht nur national funktionieren, sondern auch mit den Systemen der Bündnispartner interoperabel sein. Dies erfordert die Einhaltung komplexer technischer Standards wie dem Federated Mission Networking und verschiedener NATO-Protokolle.
Die Integration verschiedener Kommunikationstechnologien in ein kohärentes System erfordert höchste technische Präzision. Moderne militärische Kommunikation muss VHF- und UHF-Übertragung mit Datenraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde unterstützen und gleichzeitig abhörsicher verschlüsselt sein. Diese technischen Anforderungen erhöhen die Komplexität der Software exponentiell.
Finanzielle Dimensionen des Projekts
Die finanziellen Auswirkungen des D-LBO-Projekts sind beträchtlich. Bereits im Dezember 2022 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags 1,35 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Beschaffung von zunächst 20.000 Funkapparaten freigegeben. Das Gesamtprojekt könnte letztendlich bis zu fünf Milliarden Euro kosten.
Parallel dazu wurden weitere Milliarden-Aufträge vergeben. Rheinmetall und die KNDS Deutschland erhielten einen Auftrag über 1,98 Milliarden Euro für die Fahrzeugintegration von etwa 10.000 Kampf- und Unterstützungsfahrzeugen. Ein zweiter Vertrag mit Rheinmetall und blackned im Wert von 1,2 Milliarden Euro betrifft die IT-Systemintegration.
Risikomanagement und Warnsignale
Bereits 2018 warnten Autoren eines Berichts des Verteidigungsministeriums zu Rüstungsangelegenheiten explizit vor den Risiken des D-LBO-Projekts. Sie identifizierten die zeitgerechte Integration in die unterschiedlichen Plattformen als größte Herausforderung und Risiko des gesamten Vorhabens. Diese frühe Warnung zeigt, dass die Probleme nicht überraschend auftraten, sondern bereits Jahre im Voraus absehbar waren.
Das unter Staatssekretärin Suder eingerichtete Risikomanagement hatte zum Ziel, Risiken von Rüstungsprojekten zeitgerecht zu identifizieren und die strategische Ebene frühzeitig zu informieren. Offensichtlich funktionierte dieses System bei D-LBO nicht wie vorgesehen, da die Probleme nicht rechtzeitig an die politische Führung kommuniziert wurden.
Internationale Erfahrungen und bewährte Praktiken
Internationale Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiche militärische Kommunikationsprojekte eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Akteuren von Anfang an erfordern. Bewährte Praktiken umfassen regelmäßige Schulungen und realistische Simulationen, robuste Wartungsprotokolle und kontinuierliche technische Unterstützung.
Besonders wichtig ist die frühzeitige Integration von Praxistests unter realistischen Bedingungen. Kontinuierliches Training und Simulationen, die die Einsatzumgebung genau nachbilden, sind entscheidend für den Erfolg komplexer Kommunikationssysteme. Diese Testphasen müssen bereits in der Entwicklung berücksichtigt werden, nicht erst bei der Auslieferung.
Präventive Maßnahmen und Vermeidungsstrategien
Das Versagen der Bundeswehr-Digitalfunkgeräte hätte durch verschiedene präventive Maßnahmen verhindert werden können. Eine zentrale Koordinierungsstelle hätte von Projektbeginn an alle technischen, logistischen und organisatorischen Aspekte koordinieren müssen.
Frühzeitige und umfassende Systemtests unter realistischen Bedingungen hätten die Software-Probleme bereits in der Entwicklungsphase aufgedeckt. Die Durchführung von Integrationstests in verschiedenen Fahrzeugtypen vor der Großbestellung hätte die Hardware-Inkompatibilitäten rechtzeitig identifiziert.
Ein systematisches Risikomanagement mit regelmäßiger Berichterstattung an die politische Führung hätte eine rechtzeitige Intervention ermöglicht. Die Etablierung klarer Kommunikationskanäle zwischen allen beteiligten Akteuren hätte Informationsverluste verhindert.
Die Einbeziehung von Nutzern aus den Streitkräften bereits in der Entwicklungsphase hätte praxisnahe Anforderungen sichergestellt. Prototyping und iterative Entwicklungszyklen hätten eine schrittweise Verbesserung der Systeme ermöglicht.
Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen
Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.
Passend dazu:
Warum das D-LBO-Projekt die Schwächen der deutschen Rüstungsbeschaffung offenbart – Wie Deutschland sein Rüstungsmanagement modernisieren muss
Strukturelle Reformen im Beschaffungswesen
Die D-LBO-Problematik zeigt grundsätzliche Schwächen im Beschaffungswesen der Bundeswehr auf. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz steht seit Jahren in der Kritik wegen zu langer Ausschreibungsverfahren und übermäßiger Bürokratisierung.
Moderne Risikomanagement-Systeme müssen bereits in der Analysephase des Beschaffungsprozesses implementiert werden. Strategisches Risikomanagement mit rollierender Kalkulation und Vollkostenschätzung kann kostspielige Überraschungen vermeiden.
Die Professionalisierung der Vertragsgestaltung mit der Rüstungsindustrie ist unerlässlich. Dies umfasst vertragliche Anreize und eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit von Sanktionen bei Nichterfüllung. Transparente Leistungsindikatoren und regelmäßige Meilenstein-Kontrollen können Abweichungen frühzeitig identifizieren.
Technologische Herausforderungen moderner Kommunikationssysteme
Die Entwicklung militärischer Kommunikationssysteme steht vor besonderen Herausforderungen. Software-definierte Funkgeräte müssen verschiedene Wellenformen und Protokolle unterstützen und dabei höchste Sicherheitsstandards einhalten. Die Integration verschiedener Kommunikationstechnologien in ein kohärentes System erfordert außerordentliche technische Expertise.
Moderne militärische Kommunikation muss abhörsicher, störungsresistent und interoperabel mit NATO-Partnern sein. Die Anforderungen an Verschlüsselung und Authentifizierung erhöhen die Komplexität der Software erheblich. Gleichzeitig müssen die Systeme unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
Auswirkungen auf die Vernetzte Operationsführung
Das D-LBO-Projekt ist ein Kernbestandteil der Vernetzten Operationsführung der Bundeswehr. Die Verzögerungen beeinträchtigen nicht nur die Kommunikation, sondern die gesamte digitale Kriegführungsfähigkeit der deutschen Streitkräfte. Moderne militärische Operationen erfordern die nahtlose Vernetzung von Sensoren, Plattformen und Effektoren.
Die Integration verschiedener Informationssysteme ermöglicht Echtzeitaustausch von Lage-Informationen und koordinierte Reaktionen. Ohne funktionierende digitale Kommunikation können moderne Waffensysteme ihr volles Potenzial nicht entfalten. Dies reduziert die Kampfkraft und Überlebensfähigkeit der Streitkräfte erheblich.
Industrielle Verantwortung und Qualitätssicherung
Die Rolle der Rüstungsindustrie bei den D-LBO-Problemen kann nicht ignoriert werden. Rohde & Schwarz als Hauptlieferant trägt Verantwortung für die unzureichende Software-Qualität und die mangelhaften Praxistests vor der Auslieferung. Die Notwendigkeit nachträglicher Software-Updates zeigt Defizite im Qualitätsmanagement.
Moderne Rüstungsunternehmen müssen bereits in der Entwicklungsphase umfassende Systemtests unter realistischen Bedingungen durchführen. Die Integration von Nutzerfeedback und iterative Entwicklungszyklen sind essentiell für erfolgreiche militärische Systeme. Qualitätssicherung darf nicht erst bei der Auslieferung beginnen.
Internationale Kooperationen und Standards
Die NATO-Interoperabilität erfordert die Einhaltung komplexer internationaler Standards. Das Federated Mission Networking ermöglicht die Vernetzung verschiedener Nationen in einem gemeinsamen Informationsverbund. Deutsche Systeme müssen nahtlos mit amerikanischen, britischen und französischen Kommunikationsnetzen zusammenarbeiten.
Die Standardisierung militärischer Kommunikation ist ein langwieriger Prozess, der Jahre dauern kann. Nationale Alleingänge gefährden die Interoperabilität und reduzieren die Wirksamkeit multinationaler Operationen. Die Coalition Warrior Interoperability Exercise dient der Erprobung und Validierung dieser Standards.
Langfristige Konsequenzen und Reformbedarf
Die D-LBO-Problematik zeigt den dringenden Reformbedarf im deutschen Rüstungsmanagement auf. Strukturelle Veränderungen sind erforderlich, um zukünftige Fehlschläge zu vermeiden. Dies umfasst organisatorische Reformen, verbesserte Koordination und modernere Projektmanagement-Methoden.
Das Beschaffungswesen muss agiler und nutzerorientierter werden. Starre bürokratische Prozesse sind für moderne Technologieentwicklung ungeeignet. Schnelle Anpassungszyklen und kontinuierliche Verbesserungen sind in der digitalen Welt unerlässlich.
Die Bundeswehr muss ihre Innovationsfähigkeit stärken und enger mit Start-ups und Technologieunternehmen zusammenarbeiten. Traditionelle Beschaffungsverfahren sind für schnelllebige IT-Systeme oft ungeeignet. Neue Kooperationsmodelle und Beschaffungsstrategien sind erforderlich.
Die D-LBO-Krise ist mehr als ein technisches Problem – sie offenbart systemische Schwächen in der deutschen Verteidigungsorganisation. Nur durch grundlegende Reformen können zukünftige Milliardenfehlschläge vermieden und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nachhaltig gestärkt werden. Die Zeit für oberflächliche Korrekturen ist vorbei; Deutschland braucht eine fundamentale Modernisierung seines Rüstungsmanagements.
NATO-Druck und interne Blockaden: Der Weg zum D-LBO-Desaster
Wie konnte das soweit kommen? Die Entstehungsgeschichte des D-LBO-Debakels
Das Versagen der neuen Bundeswehr-Digitalfunkgeräte ist kein plötzlich aufgetretenes Problem, sondern das Ergebnis jahrelanger systemischer Mängel und ignorierter Warnsignale. Die Frage “Wie konnte das soweit kommen?” lässt sich nur verstehen, wenn man die tieferliegenden strukturellen Defizite des deutschen Beschaffungswesens und die Geschichte der Warnsignale betrachtet, die bereits seit Jahren unbeachtet blieben.
Die frühen Warnsignale – bereits 2018 bekannte Risiken
Entgegen der aktuellen Darstellung waren die Integrationsprobleme bei D-LBO keineswegs überraschend. Bereits 2018 warnten Experten in einem Bericht des Verteidigungsministeriums zu Rüstungsangelegenheiten explizit vor den Risiken des D-LBO-Projekts. Sie identifizierten die zeitgerechte Integration der Funkgeräte in die unterschiedlichen Fahrzeugplattformen als größte Herausforderung und als Hauptrisiko des gesamten Vorhabens.
Diese frühe Warnung zeigt deutlich, dass die aktuellen Probleme nicht überraschend auftraten, sondern bereits Jahre im Voraus absehbar waren. Die Tatsache, dass diese Warnungen nicht zu konsequenten präventiven Maßnahmen führten, offenbart ein grundlegendes Versagen des Risikomanagements.
Das Versagen des Risikomanagement-Systems
Das von Staatssekretärin Katrin Suder eingerichtete Risikomanagement-System sollte genau solche Probleme verhindern. Es war darauf ausgelegt, Risiken von Rüstungsprojekten zeitgerecht, strukturiert und zielgerichtet zu identifizieren und die strategische Ebene frühzeitig zu informieren.
Dieses System funktionierte jedoch beim D-LBO-Projekt nicht wie vorgesehen. Obwohl bereits am 19. Januar 2023 erste Hinweise auf Verzögerungen geäußert wurden und am 28. Juni 2023 die ARGE D-LBO dem Beschaffungsamt mitteilte, dass es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Integration kommen würde, erreichten diese kritischen Informationen nicht rechtzeitig die politische Führung.
Die Koordinierungsstelle, die erst im Oktober 2023 eingerichtet wurde, war eine Reaktion auf bereits bekannte Probleme, nicht deren Prävention. Sie kam zu spät und konnte das Versagen nicht mehr aufhalten.
Strukturelle Mängel im Beschaffungsamt
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz zeigt seit Jahren dieselben systemischen Probleme. Die Parallelen zur G36-Affäre sind erschreckend. Schon damals wurden hausinterne Kritiker unter Druck gesetzt oder kaltgestellt, wenn sie auf Mängel hinwiesen. Beamte, die bereits 2012 interne Beweise für die Treffsicherheitsprobleme des G36 vorlegten, wurden systematisch bekämpft.
Diese Kultur der Problemvertuschung setzt sich bei D-LBO fort. Das Beschaffungsamt hat eine Geschichte von Vergabefehlern und mangelnder Koordination zwischen den Abteilungen. Verschiedene Bereiche kommunizieren nicht ausreichend miteinander, was bereits beim G36-Nachfolgeprojekt zu schwerwiegenden Verfahrensfehlern führte.
Politische Führung ohne Kontrolle
Die politische Dimension verschärft sich dadurch, dass Minister Pistorius noch am 10. September 2025 im Bundestag versicherte, es gebe keine Probleme bei D-LBO und man liege im Zeitplan. Diese Aussage erfolgte drei Monate nach der internen Information über das Versagen der Tests in Munster.
Das vom Minister eingerichtete Planungs- und Führungsstab sollte sicherstellen, dass alle Aktivitäten den strategischen Zielen dienen und Entscheidungen zügig umgesetzt werden. Dieses System versagte bei D-LBO vollständig. Die Umstrukturierung des Risiko-Controllings weg vom Rüstungsstaatssekretär in andere Abteilungen führte offensichtlich zu einem Informationsverlust.
Die Mikromanagement-Falle
Ein zentrales Problem ist das von Beamten des Beschaffungsamts kritisierte Mikromanagement, das seit Katrin Suders Zeit eingeführt wurde. Mitarbeiter haben keine Freiheit mehr für Entscheidungen, alles wird bis ins Detail kontrolliert. Dies führt zu Lähmung statt zu effizienter Beschaffung.
Entscheidungen über die Art der Beschaffung dauern nicht mehr zwei Tage wie früher, sondern zwei Monate. Die Begründung passt nicht mehr auf eine halbe Seite, sondern umfasst mehr als ein Dutzend Blätter. Diese Überregulierung macht schnelle Anpassungen unmöglich und führt zu starren Prozessen.
Industrielle Mitverantwortung ignoriert
Die Probleme entstanden auch, weil die Industrie ihre Verantwortung nicht wahrnahm. Rohde & Schwarz lieferte Software aus, die in Praxistests durchfiel, ohne vorher ausreichende Erprobungen unter realistischen Bedingungen durchzuführen. Die ARGE D-LBO teilte bereits im Juni 2023 Verzögerungen mit, ohne dass dies zu konsequenten Maßnahmen führte.
Die Tatsache, dass nun nachträglich Software-Updates erforderlich sind, zeigt, dass die Qualitätssicherung in der Industrie versagte. Moderne Rüstungsunternehmen müssen bereits in der Entwicklungsphase umfassende Systemtests durchführen, was offensichtlich nicht geschah.
Das Muster sich wiederholender Fehlschläge
D-LBO ist nur das neueste Beispiel einer langen Reihe von Beschaffungsdesastern. Die G36-Probleme, die Vergabefehler beim G36-Nachfolger, die Berateraffäre unter von der Leyen – alle zeigen dieselben strukturellen Mängel auf.
Das stete Abwälzen strategisch-politischer Verantwortung auf die Beschäftigten im Ministerium und Beschaffungsamt verhindert eine ehrliche Aufarbeitung. Ohne fundamentale Reformen wird sich das Muster wiederholen.
Die NATO-Verpflichtungen als Zeitdruck
Der zusätzliche Zeitdruck durch die NATO-Zusagen zur Bereitstellung einer vollständigen Division bis 2025 verstärkte die Problematik. Statt zu sorgfältiger Planung führte dieser Druck zu übereilten Entscheidungen und dem Verzicht auf ausreichende Tests vor der Beschaffung.
Fehlende Nutzereinbindung
Ein gravierender Fehler war die mangelnde Einbeziehung der tatsächlichen Nutzer – der Soldaten – in die Entwicklungs- und Testphase. Die komplizierte Bedienungssoftware hätte durch frühzeitige Nutzertests unter realistischen Bedingungen identifiziert und korrigiert werden können.
Das Versagen der Kontrollinstitutionen
Auch externe Kontrollinstitutionen versagten. Der Bundesrechnungshof, der bei anderen Projekten kritische Prüfungen durchführte, griff bei D-LBO nicht rechtzeitig ein. Die parlamentarische Kontrolle funktionierte nicht, da das Ministerium die Abgeordneten nicht rechtzeitig und vollständig informierte.
Die Kombination aus ignorierter Expertise, mangelnder Kommunikation, strukturellen Defiziten und politischem Zeitdruck schuf die perfekten Bedingungen für das D-LBO-Debakel. Es ist nicht ein plötzlich aufgetretenes Problem, sondern das vorhersagbare Ergebnis jahrelanger systemischer Mängel.
Die Frage ist nicht, ob man die Probleme hätte vorhersehen können – sie wurden tatsächlich vorhergesagt. Die Frage ist, warum diese Warnungen ignoriert wurden und warum die Verantwortlichen nicht rechtzeitig Korrekturen vornahmen. Dies zeigt ein fundamentales Versagen der deutschen Verteidigungsorganisation auf allen Ebenen – von der operativen Durchführung bis zur strategischen Führung.
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Head of Business Development
Chairman SME Connect Defence Working Group
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder
mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.
Ihre Dual-Use Logistikexperten
Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.
Passend dazu: