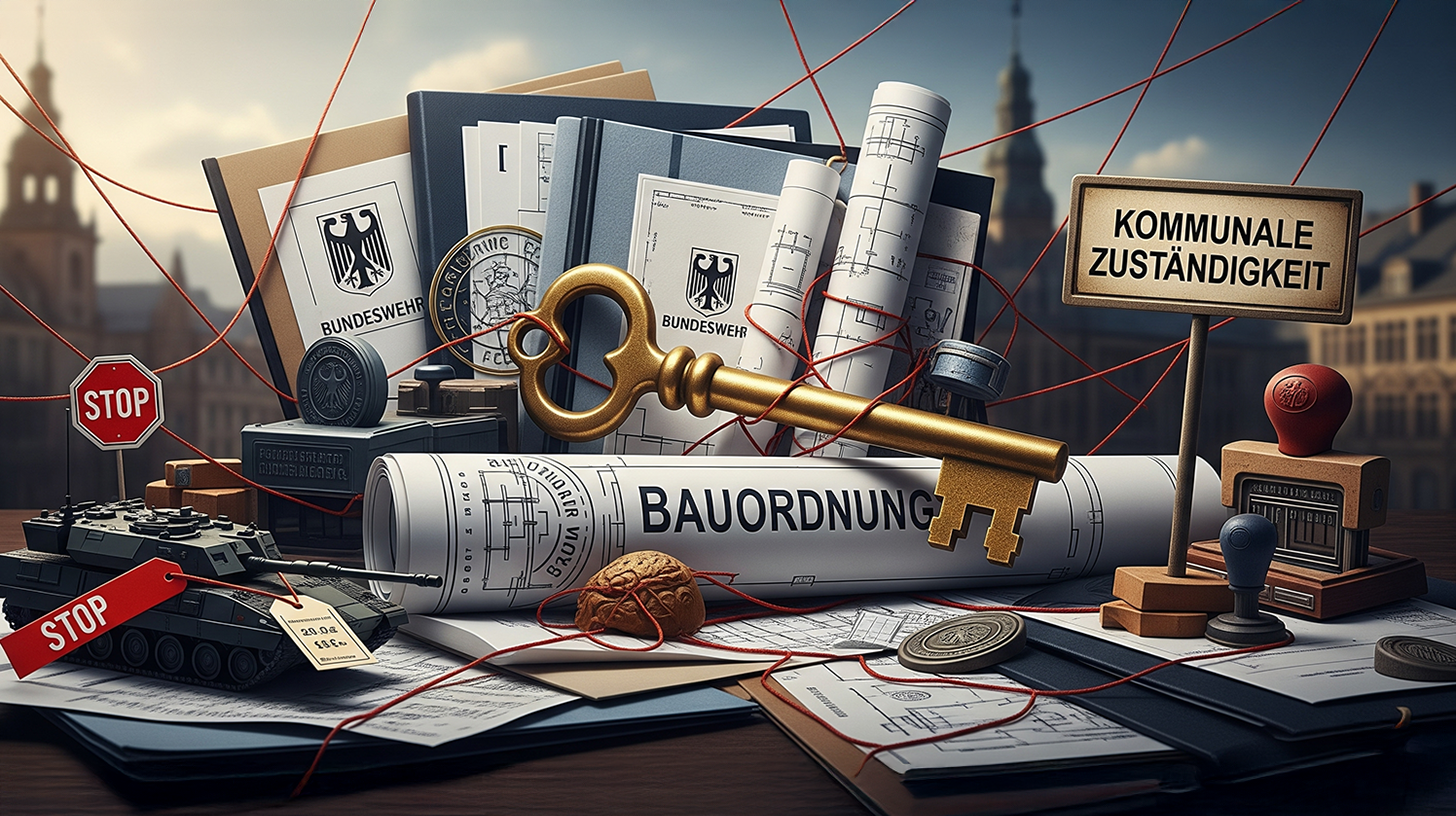
Bundeswehr-Beschaffung und kommunale Verantwortung: Die neue Rolle der Kommunen – Bürokratie und Baurecht im Fokus – Bild: Xpert.Digital
Bundeswehr-Chefin nimmt deutsche Städte in die Pflicht – Bürokratie bremst Aufrüstung
### Panzer statt Artenschutz? Warum Ihr Bürgermeister jetzt für die Bundeswehr Platz machen muss ### „Kriegstüchtig bis 2029“: Was die neue Bundeswehr-Doktrin für Ihre Stadt bedeutet ### Neues Gesetz kippt alles: Darum haben Panzerfabriken jetzt Vorfahrt in Ihrer Gemeinde ### Wie eine Eidechse den Panzerbau stoppen kann – und was sich jetzt radikal ändert ###
Die Forderung nach kommunaler Unterstützung: Nationale Sicherheit wird wichtiger als lokales Baurecht
Was bedeutet die Aussage der BAAINBw-Präsidentin über die Verantwortung der Kommunen?
Annette Lehnigk-Emden, die Präsidentin des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, hat eine klare Position bezogen: „Kommunen sind in der Pflicht, die bürokratischen Hindernisse für die Zeitenwende möglichst gering zu halten”. Diese Forderung ist nicht als isolierte Meinungsäußerung zu verstehen, sondern als Teil einer systematischen Neuausrichtung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Zeitenwende hat eine fundamentale Veränderung der Prioritäten mit sich gebracht. Wo früher ausschließlich zivile Interessen im Mittelpunkt der kommunalen Planungshoheit standen, müssen nun nationale Sicherheitsinteressen stärker berücksichtigt werden. Lehnigk-Emden stellt fest, dass Rüstungsproduzenten vor denselben Herausforderungen stehen wie andere Bauvorhaben auch – insbesondere bei Verzögerungen durch Baugenehmigungsverfahren und Artenschutzauflagen.
Passend dazu:
- Verteidigungslogistik: Deutschlands Schlüsselrolle in der NATO-Strategie – Wie KI und Roboter die Bundeswehr voranbringen können
Warum ist eine Beschleunigung der Rüstungsproduktion notwendig?
Welche Bedrohungsszenarien rechtfertigen diese Dringlichkeit?
Die veränderte Sicherheitslage macht eine schnelle Aufrüstung der Bundeswehr erforderlich. Experten und Geheimdienste warnen, dass Russland bereits 2029 zu einem größeren Krieg und einem Angriff auf NATO-Territorium fähig sein könnte. General Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, betont: „Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein”. Diese Einschätzung basiert auf der systematischen Aufrüstung Russlands und den vielfältigen hybriden Angriffen auf kritische Infrastruktur.
Die Bundeswehr hat in fast allen Bereichen Nachholbedarf. Es fehlt an klassischem Gerät wie Panzern und Flugzeugen, vor allem aber an Munition. Um Deutschland und Europa unabhängiger von den USA zu machen, geht es zudem um das Erlangen militärischer Fähigkeiten, die bislang die USA im NATO-Verbund gestellt haben. Dazu gehören Satellitenaufklärung, Raketen mit großer Reichweite und Luftverteidigung.
Die deutsche Rüstungsindustrie steht vor enormen Herausforderungen. In drei Jahrzehnten der Abrüstung sind die Kapazitäten stark heruntergefahren worden. Wenn die Verteidigungsanstrengungen nun verdoppelt werden sollen, geht das nicht aus dem Stand. Die Endhersteller wie Rheinmetall, KNDS, TKMS oder Diehl haben nur rund 60.000 Mitarbeiter in Deutschland, einschließlich der Zulieferer sind es ungefähr 150.000.
Das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz als Antwort
Was ändert sich konkret durch das neue Gesetz?
Das Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, das am 23. Juli 2025 vom Kabinett verabschiedet wurde und Anfang 2026 in Kraft treten soll, stellt eine fundamentale Weichenstellung dar. Lehnigk-Emden begrüßt besonders die neue Gewichtung der Interessenabwägung: „Darin steht, dass die Interessen der Bundesrepublik bei einer solchen Abwägung vorgehen. Was früher gleich war, ist jetzt neu gewichtet”.
Das Gesetz erweitert den Anwendungsbereich erheblich. Künftig fallen alle „Aufträge zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr” unter die beschleunigten Verfahren. Dies umfasst nicht nur militärische Ausrüstung, sondern auch zivile Beschaffungen wie Sanitätsmaterial, medizinische Geräte, Verbandsmaterial und Medikamente. Ebenso fallen alle Baumaßnahmen und Planungsleistungen für die Bundeswehr unter das Gesetz, unabhängig davon, ob sie verteidigungs- oder sicherheitsspezifisch sind.
Die Laufzeit des Gesetzes wird bis zum 31. Dezember 2035 verlängert, was Planungssicherheit für langfristige Projekte schafft. Durch Ausnahmeregelungen im Vergaberecht soll die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr erleichtert und beschleunigt werden. Direktvergaben von Aufträgen sollen künftig schneller und häufiger möglich sein.
Bürokratische Hindernisse und ihre Auswirkungen
Welche konkreten Probleme entstehen durch langwierige Genehmigungsverfahren?
Die Artenschutzprüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist seit 2010 bei allen Bauvorhaben durchzuführen. Diese Prüfungen können erhebliche Verzögerungen verursachen, da sie ein dreistufiges Verfahren umfassen. In der ersten Stufe wird geklärt, ob überhaupt geschützte Arten im Wirkbereich vorkommen. Bei positiven Befunden folgen vertiefende Prüfungen, die zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, einem speziellen Risikomanagement oder sogar zur Unzulässigkeit des Vorhabens führen können.
Lehnigk-Emden nennt konkret Verzögerungen bei Baugenehmigungen aufgrund von Artenschutzauflagen als Beispiel für Hindernisse, die sich Deutschland „angesichts der Weltlage” nicht mehr leisten könne. Diese Einschätzung reflektiert einen grundlegenden Wandel in der Prioritätensetzung. Wo früher der Artenschutz unbedingte Priorität hatte, muss nun eine Abwägung mit Sicherheitsinteressen stattfinden.
Das neue Gesetz zielt darauf ab, dass bei militärischen Bauvorhaben das Sicherheitsinteresse des Bundes Vorrang vor kommunalen Bauplanungsrechten erhält. Dies bedeutet nicht, dass Umwelt- und Artenschutz vollständig ausgehebelt werden, aber die Abwägung erfolgt mit einer neuen Gewichtung zugunsten der Verteidigungsinteressen.
Die Rolle der Kommunen im Spannungsfeld
Wie sind Bauplanungsrechte der Kommunen und Sicherheitsinteressen des Bundes zu vereinbaren?
Die Kommunen haben nach dem Grundgesetz die Planungshoheit über ihr Gebiet. Dies schließt die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen ein. Das öffentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, das durch den Bund geregelt wird, und das Bauordnungsrecht, das in der Hand der Länder liegt. Der Vollzug des öffentlichen Baurechts erfolgt jedoch durch die Bauaufsichtsbehörden der Kommunen.
Lehnigk-Emden betont, dass Bauplanungsrechte der Kommunen und das Sicherheitsinteresse des Bundes „immer miteinander abgewogen werden” müssen. Die gelernte Juristin verweist dabei auf das neue Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, das diese Abwägung neu justiert. Während früher beide Interessen gleichberechtigt waren, gehen nun die Interessen der Bundesrepublik vor.
Diese Neugewichtung zeigt sich auch in anderen Bereichen. So werden beispielsweise bei der Windenergie die Belange des zivilen und militärischen Luftverkehrs neu bewertet. Zwar kommt dem Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß § 2 EEG 2023 nicht per se ein Vorrang gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung zu, aber es soll die Möglichkeit geschaffen werden, durch zumutbare Anpassungen einen angemessenen Ausgleich der berührten Belange zu erreichen.
Produktionskapazitäten und industrielle Herausforderungen
Welche Anstrengungen sind nötig, um die Rüstungsproduktion zu steigern?
Die deutsche Rüstungsindustrie steht vor enormen Herausforderungen beim Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Rheinmetall-Chef Armin Papperger berichtete, dass sein Unternehmen bereits im März 2022 begann, die Kapazitäten zu verdoppeln. Dies zeigt, wie schnell die Industrie auf die veränderte Bedrohungslage reagiert hat.
Dennoch reichen die aktuellen Kapazitäten bei weitem nicht aus. Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft betont: „Die Kapazitäten müssen hier ausgeweitet werden durch Einbeziehung bislang ziviler Industriewerke oder Neuerrichtung von Produktionsstätten”. Die Industrie benötigt dabei langfristige Perspektiven, die mit konkreten Bestellungen unterlegt sind.
Ein zentrales Problem ist die mittelständische Struktur der deutschen Rüstungsindustrie. Die in Deutschland existierenden Strukturformen stellen im Vergleich mit internationalen Wehrindustrien eine exotische Ausnahme dar. Die klassischerweise auf kleine Losgrößen zugeschnittenen wehrtechnischen kleinen und mittleren Unternehmen verfügen hinsichtlich ihrer Fabrikationssubstanz über zu geringes Erweiterungspotential, um sich an die derzeit verteidigungspolitisch getriggerte Marktdynamik anzupassen.
Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen
Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.
Passend dazu:
Strategische Transformation: Wenn Stadtplanung militärische Priorität wird
Zeitdruck und strategische Notwendigkeiten – Zwischen Effizienz und Demokratie: Kommunen als Sicherheitsarchitekten
Warum ist die Zeit ein so entscheidender Faktor?
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Geschwindigkeit zur obersten Priorität im Beschaffungswesen erklärt. „Der Faktor Zeit hat oberste Priorität”, betont er immer wieder. Die Bundeswehr soll bis spätestens 2029 kriegstüchtig sein. Angesichts der Bedrohungsanalysen, die einen möglichen russischen Angriff auf NATO-Territorium bereits für 2027 bis 2030 nicht ausschließen, wird der Zeitdruck verständlich.
Das Problem ist jedoch, dass moderne Rüstungsproduktion Zeit braucht. Panzerstahl muss mit einem Vorlauf von mindestens einem Jahr bestellt werden. Personal ist ein enormer Engpass, nicht nur in der Bundeswehr und Wehrtechnik. Rheinmetall soll alleine mehr als 3.500 neue Mitarbeiter suchen. Dazu müssen zusätzliche Fertigungsstraßen aufgebaut und dafür Maschinen bestellt und aufgestellt werden. Dies alles geht nicht von heute auf morgen.
Gleichzeitig warten viele Firmen erst auf den Eingang der Bestellungen, bevor diese Schritte unternommen werden, da im Vordergrund immer noch die Wirtschaftlichkeit steht. Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, fordert daher „klare Ansagen” für die Branche: „Die Industrie kann das allermeiste liefern, wenn ihr klar gesagt wird, was jetzt wovon in welcher Stückzahl und welcher Zeit benötigt wird”.
Passend dazu:
Die Neugewichtung von Interessen
Wie verändert sich das Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Prioritäten?
Die Zeitenwende bringt eine fundamentale Neugewichtung der Prioritäten mit sich. Während in den vergangenen drei Jahrzehnten der Abrüstung zivile Interessen nahezu uneingeschränkt Vorrang hatten, müssen nun Sicherheitsinteressen stärker berücksichtigt werden. Dies zeigt sich nicht nur bei Rüstungsvorhaben, sondern auch bei anderen Infrastrukturprojekten.
Das neue Beschaffungsbeschleunigungsgesetz ermöglicht es beispielsweise der Bundeswehr, zivile Bauvorhaben zu verhindern, wenn sie militärische Aufgaben stören könnten. Als Beispiel werden Windkraftprojekte genannt, die möglicherweise Radare für die Flugabwehr stören. Hier kann das Gesetz verhindern, dass solche Bauvorhaben realisiert werden, da damit die Verteidigungsfähigkeit des Landes gefährdet werden könnte.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Raumordnung und Landesplanung wider. Die Erfordernisse der Verteidigung und des Zivilschutzes sollen aufgewertet werden, ohne ihren Charakter als abwägbarer Grundsatz anzutasten. Die Abwägbarkeit muss erhalten bleiben, um die Belange der Verteidigung mit anderen Belangen in praktische Konkordanz bringen zu können. Durch die Aufwertung wird aber deutlich gemacht, dass die Raumordnung und Landesplanung die Verteidigungsfähigkeit des Landes stärker als bisher unterstützen müssen.
Kommunale Handlungsspielräume und Grenzen
Welche konkreten Maßnahmen können Kommunen ergreifen?
Kommunen haben verschiedene Möglichkeiten, die Rüstungsproduktion zu unterstützen, ohne dabei ihre grundsätzlichen Planungskompetenzen aufzugeben. Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren können sie durch beschleunigte Bearbeitung und pragmatische Auslegung der Vorschriften zur Zeitenwende beitragen.
Bei der Artenschutzprüfung besteht bereits heute die Möglichkeit, bei Vorhaben im Bereich von Bebauungsplänen, die nicht älter als sieben Jahre sind, auf die Artenschutzprüfung bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu verweisen. Bei Vorhaben im Innenbereich können Regelvermutungen angewendet werden, dass keine Artenschutzbelange betroffen sind.
Die Kommunen können auch durch aktive Flächenbereitstellung zur Rüstungsproduktion beitragen. Die Ausweisung von Gewerbeflächen für Rüstungsunternehmen und deren Zulieferer kann die notwendige Kapazitätserweiterung unterstützen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die klassischen Rüstungsunternehmen, sondern auch Zulieferer aus anderen Bereichen wie der Automobilindustrie für die Verteidigungsindustrie arbeiten sollen.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Grenzen
Wo liegen die rechtlichen Grenzen der kommunalen Unterstützung?
Trotz der neuen Prioritätensetzung bleiben die grundsätzlichen rechtlichen Strukturen bestehen. Das Bauplanungsrecht wird weiterhin durch den Bund geregelt, während das Bauordnungsrecht in der Hand der Länder bleibt. Die Kommunen behalten ihre Planungshoheit, müssen aber bei der Abwägung der verschiedenen Interessen die veränderten Gewichtungen berücksichtigen.
Die materielle Rechtslage wird durch die Verfahrensbeschleunigung nicht geändert. Auch bei beschleunigten Verfahren müssen die materiellen Anforderungen des Baurechts eingehalten werden. Dies bedeutet, dass Sicherheitsstandards, Umweltschutzauflagen und andere zwingende Vorschriften weiterhin gelten, auch wenn die Verfahren schneller abgewickelt werden.
Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Geheimschutzinteressen. Militärische Anlagen unterliegen besonderen Sicherheitsanforderungen, die bei der Planung und Genehmigung berücksichtigt werden müssen. Dies kann zu Einschränkungen der üblichen Beteiligungsverfahren führen, wenn Gründe der Geheimhaltung oder der Eilbedürftigkeit des Vorhabens der Durchführung normaler Genehmigungsverfahren entgegenstehen.
Herausforderungen für die Verwaltung
Wie können Kommunalverwaltungen die neuen Anforderungen bewältigen?
Die Kommunalverwaltungen stehen vor der Herausforderung, die traditionellen Planungs- und Genehmigungsverfahren an die neuen Prioritäten anzupassen. Dies erfordert nicht nur rechtliches Know-how, sondern auch ein Umdenken in der Verwaltungskultur. Wo früher ausschließlich zivile Belange im Mittelpunkt standen, müssen nun Sicherheitsinteressen mitgedacht werden.
Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behördenebenen wird intensiviert werden müssen. Bei sicherheitsrelevanten Vorhaben ist eine enge Abstimmung zwischen kommunalen, Landes- und Bundesbehörden erforderlich. Dies kann zu komplexeren Verfahren führen, auch wenn diese insgesamt beschleunigt werden sollen.
Ein weiterer Aspekt ist die Personalausstattung der Verwaltungen. Die beschleunigte Bearbeitung von Anträgen erfordert ausreichendes und qualifiziertes Personal. Gleichzeitig müssen die Mitarbeiter für die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen und die veränderten Prioritäten sensibilisiert werden.
Auswirkungen auf die Stadtentwicklung
Welche langfristigen Folgen hat die Priorität für Rüstungsproduktion?
Die verstärkte Berücksichtigung von Verteidigungsinteressen wird langfristige Auswirkungen auf die Stadtentwicklung haben. Kommunen müssen bei ihrer Flächenplanung stärker als bisher militärische Belange berücksichtigen. Dies kann zu Nutzungskonflikten führen, wenn zivile Entwicklungspläne mit Sicherheitsinteressen kollidieren.
Die Ansiedlung von Rüstungsunternehmen bringt auch Chancen mit sich. Die Branche wächst rasant und kann zu einer wichtigen wirtschaftlichen Säule werden. Hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie können die lokale Wirtschaft stärken. Gleichzeitig müssen die Kommunen mit den Herausforderungen umgehen, die mit der Rüstungsproduktion verbunden sind, wie erhöhten Sicherheitsanforderungen und möglicherweise eingeschränkter Öffentlichkeitsbeteiligung bei sensiblen Projekten.
Die Integration von Rüstungsstandorten in die städtebauliche Entwicklung erfordert eine sorgfältige Planung. Sicherheitszonen, Transportwege für militärisches Material und die Anbindung an überregionale Infrastrukturen müssen berücksichtigt werden.
Die Balance zwischen Effizienz und Demokratie
Wie lässt sich Beschleunigung mit demokratischen Prinzipien vereinbaren?
Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren darf nicht zu einer Aushöhlung demokratischer Beteiligungsrechte führen. Auch bei prioritären Sicherheitsprojekten müssen die Grundprinzipien der Bürgerbeteiligung und der rechtsstaatlichen Verfahren gewahrt bleiben.
Das neue Beschaffungsbeschleunigungsgesetz sieht vor, dass bei Geheimhaltungsinteressen oder Eilbedürftigkeit besondere Verfahren zur Anwendung kommen können. Dies darf jedoch nicht zur Regel werden, sondern muss auf wirklich sicherheitskritische Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
Die Kommunen stehen vor der Aufgabe, transparente und nachvollziehbare Kriterien dafür zu entwickeln, wann Sicherheitsinteressen Vorrang haben und wann normale Verfahren zur Anwendung kommen. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall und die Entwicklung entsprechender Leitlinien für die Verwaltungspraxis.
Zeitenwende: Kommunen als Schlüsselspieler der deutschen Sicherheitspolitik
Welche Entwicklungen sind in den kommenden Jahren zu erwarten?
Die Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik wird die Arbeit der Kommunen nachhaltig prägen. Das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz ist nur der erste Schritt in einem längeren Prozess der Anpassung an die veränderte Sicherheitslage. Weitere Gesetzesänderungen und Anpassungen der Verwaltungspraxis sind zu erwarten.
Die Rüstungsindustrie wird in den kommenden Jahren erheblich wachsen. Dies wird zu einer verstärkten Nachfrage nach Gewerbeflächen, Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften führen. Kommunen, die frühzeitig entsprechende Planungen vorantreiben, können von dieser Entwicklung profitieren.
Gleichzeitig wird die gesellschaftliche Diskussion über die richtige Balance zwischen Sicherheitsinteressen und anderen Belangen weitergehen. Die Kommunen werden dabei eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen spielen müssen.
Die kommenden Jahre bis 2029, dem Zieljahr für die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr, werden entscheidend sein. In dieser Zeit muss sich zeigen, ob die neue Gewichtung der Interessen zu einer tatsächlichen Beschleunigung der Rüstungsproduktion führt, ohne dabei andere wichtige gesellschaftliche Ziele zu gefährden. Die Kommunen werden dabei als Partner des Bundes eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Zeitenwende spielen müssen.
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Head of Business Development
Chairman SME Connect Defence Working Group
Beratung - Planung - Umsetzung
Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder
mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.

