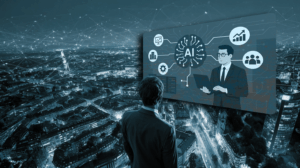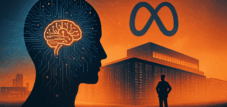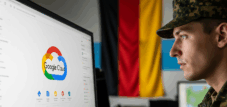KI-Rechenzentrum | Nicht alles ist, wie es scheint: Der wahre Grund für Googles plötzliche Milliarden-Liebe zu Deutschland
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 6. November 2025 / Update vom: 6. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

KI-Rechenzentrum | Nicht alles ist, wie es scheint: Der wahre Grund für Googles plötzliche Milliarden-Liebe zu Deutschland – Bild: Xpert.Digital
Der wahre Preis der KI: Googles neue Rechenzentren könnten unser Stromnetz an seine Grenzen bringen
Der Wendepunkt deutscher Infrastruktur oder ein leeres Versprechen für Datensouveränität?
Die Ankündigung von Googles bisherig größtem Investitionsprogramm für Deutschland markiert einen Wendepunkt in der wirtschaftspolitischen Wahrnehmung des Landes. Das Timing dieser Ankündigung könnte bewusster nicht sein: Mitte November 2025, zu einer Zeit, als deutsche Regierungspolitiker intensiv darüber debattierten, wie die europäische Abhängigkeit von amerikanischen Technologiekonzernen reduziert werden kann. Was oberflächlich als Vertrauensbeweis für den Wirtschaftsstandort Deutschland erscheint, offenbart bei genauerer Betrachtung ein komplexeres, ambivalentes Bild der digitalen Transformation Europas. Die Entscheidung Googles, nach Jahren gescheiterter Pläne doch wieder in Deutschland zu investieren, erzählt nicht nur von einer Unternehmensrechnung, sondern auch von strukturellen Versäumnissen europäischer Infrastrukturpolitik und dem anhaltenden technologischen Gefälle zwischen Amerika und Europa.
Passend dazu:
KI als neuer Motor: Der unersättliche Energiehunger der Rechenzentren
Die Rechenzentrumsbranche hat sich in den letzten Jahren fundamental transformiert. Während Rechenzentren lange Zeit als graue Utility-Infrastruktur galten, sind sie heute zum nervösen System des globalen digitalen Kapitalismus geworden. Die Künstliche Intelligenz, nicht Cloud Computing im engeren Sinne, treibt diese Transformation an. Ein KI-Query verbraucht ein Vielfaches mehr Energie als eine herkömmliche Suchanfrage. Diese einfache technische Realität erklärt, warum plötzlich Konzerne, die ihre Infrastruktur jahrelang weltweit optimiert haben, wieder massiv in nationale Märkte investieren. Die räumliche Nähe zu regulatorischen Institutionen, zu Energieinfrastruktur und zu Kunden wird wieder zentral. Deutschland und Europa insgesamt stehen an der Schwelle zu einem Wettlauf um digitale Infrastruktur, dessen Ausgang noch längst nicht entschieden ist.
Das Investitionsvolumen, das Google ankündigen wird, steht im Kontext einer globalen Umverteilung von Kapital. Der Konzern steckt weltweit mehrstellige Milliardenbeträge pro Jahr in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Allein die Muttergesellschaft Alphabet plant für 2025 Investitionsausgaben zwischen 91 und 93 Milliarden Dollar, wobei der überwiegende Teil für Rechenzentren verwendet wird. Für 2026 wird mit einem deutlichen weiteren Anstieg gerechnet. Deutschland erhält dabei aber nur einen Bruchteil dieser Ressourcen. Das macht die relativen Proportionen deutlich: Was Deutschland als Großinvestition verkauft, ist für einen Konzern wie Alphabet bestenfalls eine strategische Positionierung in einer kritischen Region.
Passend dazu:
Ein geplatzter Traum in Brandenburg: Warum Google zunächst scheiterte
Die Geschichte dieser Investition beginnt mit Fehlschlägen. Google hatte ursprünglich im Jahr 2021 ankündigt, eine Cloud-Region Berlin-Brandenburg aufzubauen. Die dabei geplanten Rechenzentren sollten zum Rückgrat der deutschen und europäischen Cloud-Infrastruktur werden. Zunächst war Neuenhagen östlich von Berlins Zielort, später dann Mittenwalde, etwa 30 Kilometer südlich der Hauptstadt. Das Mittenwalde-Projekt war dabei das ambitionierteste: auf einem 30 Hektar großen Gelände sollte ein riesiges Rechenzentrum entstehen, das etwa hundert qualifizierte Vollzeitstellen schaffen würde. Google erwarb die Grundstücke, unterzeichnete Vorverträge. Alles schien konkret zu werden.
Dann kam im Juni 2025 das abrupte Aus. Google stoppte das Mittenwalde-Projekt, ohne detailliert zu erklären, warum. Die offizielle Begründung war vage: Nach gründlicher Prüfung der Machbarkeit, der Marktentwicklung und unternehmensspezifischer Prioritäten habe man sich gegen den Bau entschieden. Hinter dieser Formulierung verbargen sich aber konkrete infrastrukturelle Probleme, die das ganze Dilemma deutscher Energiepolitik widerspiegeln. Das zentrale Problem war die Stromversorgung. Die bestehenden Stromnetze hätten nicht ausgereicht und hätten massiv erweitert werden müssen. Der Energieverbrauch eines großen KI-Rechenzentrums ist gewaltig, und die deutsche Strominfrastruktur, trotz Ausbau erneuerbarer Energien, war schlicht nicht dazu ausgelegt, solche Lasten zu bewältigen. Während Google bereit war, in Gebäude und Kühlung zu investieren, wollte das Unternehmen nicht auch noch die grundlegende Netzinfrastruktur in Brandenburg finanzieren.
Am Limit: Europas Stromnetze und die globale KI-Explosion
Dieses Scheitern offenbart ein fundamentales Problem. Der Energiebedarf von Rechenzentren ist explodiert. Im Jahr 2024 verbrauchten Rechenzentren in Deutschland etwa 20 Milliarden Kilowattstunden Strom, was dem Jahresverbrauch von etwa 5,7 Millionen Zwei-Personen-Haushalten entsprach. Das ist bereits etwa drei Prozent des gesamten deutschen Stromverbrauchs. Doch dies ist nur ein Vorgeschmack. Der weltweite Stromverbrauch von KI-Rechenzentren soll sich vom Basisjahr 2023 bis zum Jahr 2030 um das Elffache erhöhen, von 50 Milliarden Kilowattstunden auf rund 550 Milliarden Kilowattstunden. In Europa wird der Bedarf von Rechenzentren insgesamt von 100 Terawattstunden 2022 bis 2026 auf 150 Terawattstunden steigen. Der Internationale Energieagentur zufolge werden Rechenzentren bis 2030 mehr Energie benötigen als das Doppelte von ganz Deutschland 2024. Diese Zahlen sind kaum zu fassen, und sie führen zu einer Spirale: Mehr Rechenzentren brauchen mehr Strom, mehr Strom braucht mehr Infrastruktur, und in einem Zeitalter der Energiewende werden erneuerbaren Energien durch KI-Rechenzentren stärker gebunden, möglicherweise sogar kanibalisiert.
Dieses Problem ist nicht auf Deutschland begrenzt. Irland, lange ein Anziehungspunkt für Rechenzentren wegen billiger Energie und stabiler Märkte, musste 2023 einen Baustopp für neue Rechenzentren verhängen, weil das nationale Stromnetz die neuen Lasten nicht bewältigen konnte. Teile Londons erlebten ähnliches. Spanien hatte im Jahr 2023 einen fast achtzehstündigen Stromausfall, der zumindest teilweise auf unerwartete geringe Stromproduktion aus Solarenergie zurückging. Überall in Europa ist ein Pattern zu beobachten: Rechenzentren als energieintensive Infrastruktur stoßen an die Grenzen nationaler Stromnetze, die von Natur aus fragmentiert und von Stabilitätslogiken des 20. Jahrhunderts geprägt sind.
Passend dazu:
Das Paradox der Souveränität: Europas gespaltene Tech-Politik
Die deutsche Energiepolitik hat Mühe, mit diesem Tempo Schritt zu halten. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist zwar vorangegangen, aber nicht mit der Geschwindigkeit, die KI-Rechenzentren verlangen würden. Die Regierung hat unter Kanzler Friedrich Merz versprochen, die wirtschaftliche Stimmung im Land zu drehen, aber Arbeitslosigkeit steigt, Schlüsselindustrien stehen unter Druck. Ein großes Rechenzentrum von Google hätte als Vertrauensbeweis gewirkt. Stattdessen scheiterten zwei Projekte. Aus diesem Grund werden die neuen Investitionsankündigungen mit großem Applaus empfangen: Sie sind so dringend nötig, dass jedes Versprechen gerade noch willkommen ist, unabhängig davon, ob es den strukturellen Problemen wirklich abhilft.
Das ist auch im internationalen Kontext zu verstehen. Die Bundesregierung verfolgt aktiv das Ziel, internationale Investoren anzusprechen. Kanzler Merz hat den früheren Commerzbank-Chef Martin Blessing zum Investitionsbeauftragten ernannt. Gleichzeitig verfolgt die Regierung das widerspruchsvolle Ziel, Deutschland aus der Abhängigkeit von amerikanischen Technologieanbietern zu lösen. Die Trump-Administration und ihre protektionistische Handelspolitik haben selbst Transatlantiker wie Merz davon überzeugt, dass europäische Souveränität notwendig ist. Deutschland und Frankreich planen einen Gipfel zur digitalen Unabhängigkeit Europas. Unionspolitiker fordern eine schrittweise Abkehr von amerikanischen Cloud-Anbietern. Und doch: Google wird sein Kapital und seine Infrastruktur investieren, und Deutschland wird diese Investitionen mit offenen Armen empfangen. Das ist das Paradoxon der europäischen Technologiepolitik. Man will unabhängig sein, hat aber nicht die eigene Kraft, um die notwendige Infrastruktur zu bauen, und ist daher gezwungen, mit den Oligopolen zu verhandeln.
Von Brandenburg nach Hessen: Googles neue Strategie und das Versprechen der Abwärme
Google hat in Deutschland bereits eine Reihe von Rechenzentren im Betrieb oder im Bau. Hessen ist dabei das wichtigste Bundesland. In Hanau betreibt Google ein Rechenzentrum, das 2023 eröffnet wurde. In den Orten Erlensee, Dietzenbach und Babenhausen im Rhein-Main-Gebiet hat sich Google Grundstücke gesichert, auf denen zukünftige Rechenzentren entstehen könnten. Das Rhein-Main-Gebiet ist für Rechenzentren günstig gelegen, nicht nur wegen der Nähe zu Frankfurt mit seinem DE-CIX Internet-Knoten, der eine der größten Drehscheiben für digitale Datenströme weltweit ist. Auch die Energieinfrastruktur ist dort besser als in Brandenburg. Unter diesen Umständen macht die Fokussierung auf Hessen strategischen Sinn. Doch auch dies zeigt ein strukturelles Problem auf: Während einige Regionen Deutschlands zu Hotspots für digitale Infrastruktur werden können, bleiben andere völlig ausgehängt. Brandenburg, wo Berlin liegt, bleibt unterversorgt, weil die Stromnetze dort nicht ausreichen.
Das neue Investitionspaket Googles wird detailliert am 11. November 2025 in Berlin vorgestellt werden, gemeinsam mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Geplant sind der Bau von Infrastruktur und Rechenzentren, innovative Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärmenutzung sowie der Ausbau der Standorte in München, Frankfurt und Berlin. Das Stichwort Abwärmenutzung ist dabei strategisch bedeutsam, denn es deutet darauf hin, dass Google begonnen hat, den Energieaspekt ernster zu nehmen. Die Abwärme von Rechenzentren ist tatsächlich ein riesiges, bislang stark unterutzte Ressource. Ein Rechenzentrum mit einer IT-Anschlussleistung von mehr als fünf Megawatt produziert genug Abwärme, um Fernwärmenetze zu speisen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts könnte die Abwärme aus den größeren deutschen Rechenzentren den Wärmebedarf von etwa 32 Millionen Quadratmetern versorgen. Das entspricht enormen Einsparungen, wenn diese Potenziale gehoben werden könnten. Aber auch hier offenbaren sich die Hürden: Die meisten Rechenzentren nutzen Luftkühlung statt Wasserkühlung, und Umrüstungen sind kostspielig. Alte Fragen von Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen sich immer wieder. Die Wärme von Rechenzentren zu nutzen bedeutet auch enge Abstimmung mit lokalen Wärmeversorgungs-Infrastrukturen. Das ist möglich, aber nicht trivial.
Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) - Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) – Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung - Bild: Xpert.Digital
Hier erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen schnell, sicher und ohne hohe Einstiegshürden realisieren kann.
Eine Managed AI Platform ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket für künstliche Intelligenz. Anstatt sich mit komplexer Technik, teurer Infrastruktur und langwierigen Entwicklungsprozessen zu befassen, erhalten Sie von einem spezialisierten Partner eine fertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung – oft innerhalb weniger Tage.
Die zentralen Vorteile auf einen Blick:
⚡ Schnelle Umsetzung: Von der Idee zur einsatzbereiten Anwendung in Tagen, nicht Monaten. Wir liefern praxisnahe Lösungen, die sofort Mehrwert schaffen.
🔒 Maximale Datensicherheit: Ihre sensiblen Daten bleiben bei Ihnen. Wir garantieren eine sichere und konforme Verarbeitung ohne Datenweitergabe an Dritte.
💸 Kein finanzielles Risiko: Sie zahlen nur für Ergebnisse. Hohe Vorabinvestitionen in Hardware, Software oder Personal entfallen komplett.
🎯 Fokus auf Ihr Kerngeschäft: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können. Wir übernehmen die gesamte technische Umsetzung, den Betrieb und die Wartung Ihrer KI-Lösung.
📈 Zukunftssicher & Skalierbar: Ihre KI wächst mit Ihnen. Wir sorgen für die laufende Optimierung, Skalierbarkeit und passen die Modelle flexibel an neue Anforderungen an.
Mehr dazu hier:
Digitale Souveränität in Gefahr: Was Europa jetzt gegen US‑Dominanz tun muss
Abhängigkeit als neues Geschäftsmodell: Die deutsche Wirtschaft in der Cloud
Der Kontext dieser Investitionen ist geopolitisch aufgeladen. Microsoft hat im letzten Jahr mitgeteilt, dass es 3,2 Milliarden Euro in deutsche Rechenzentren investieren will. Die Deutsche Telekom und der US-Chipkonzern Nvidia haben eine Milliarde Euro in ein KI-Rechenzentrum in München investiert, das ab 2026 Operationen aufnehmen soll. Amazon Web Services ist ebenfalls präsent. Die Milliardeninvestitionen der amerikanischen Tech-Giganten in europäische Rechenzentren sind Teil einer globalen Infrastruktur-Offensive, aber sie werfen auch die Frage nach der europäischen Souveränität auf. Was bedeutet es, wenn die Cloud-Infrastruktur, auf der europäische Unternehmen ihre Daten lagern und ihre Systeme betreiben, von amerikanischen Unternehmen kontrolliert wird?
Das deutsche Geschäftsmodell seit der Nachkriegszeit war stark von der Idee mittelständischer Eigentümer geprägt, die ihre Produktionsgeheim- und Betriebsprozesse in ihren eigenen Fabriken wahren konnten. Mit der Cloud und KI verliert diese Logik an Kraft. Eine zunehmende Zahl von Betrieben, gerade im Mittelstand, nutzt Rechenzentren für ihre kritischen Daten und Prozesse. Studien zeigen, dass 51 Prozent der deutschen Unternehmen Rechenzentren nutzen, ein Anstieg um etwa 25 Prozent gegenüber zwei Jahren zuvor. Die Zahl der Arbeitsplätze, deren Existenz von Rechenzentrum-Services abhängt, ist explosiv gewachsen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat berechnet, dass 2024 etwa 5,9 Millionen Arbeiter in Unternehmen tätig sind, deren Geschäftsmodell ohne Cloud nicht möglich wäre. Vor zwei Jahren waren es noch 2,8 Millionen. Das ist ein Anstieg von etwa 126.000 Arbeitsplätzen pro Monat. Die Abhängigkeit vom globalen Rechenzentrum-Ecosystem ist nicht länger peripher, sondern zentral.
Unter diesen Umständen ist die Frage nach europäischer Souveränität auch eine Frage nach Datensouveränität. 45 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass es ihnen wichtig ist, dass Rechenzentren in Deutschland liegen. Datenschutzbedenken sind ein großer Grund: Fast die Hälfte der Unternehmen nennt Datenschutz als Grund, warum sie die Cloud meiden. Dabei ist das nicht irrational. Wenn europäische Unternehmen ihre Daten an amerikanische Konzerne auslagern, unterliegen diese in den USA letztlich amerikanischen Sicherheitsgesetzen. Eine offene Frage ist, ob amerikansiche Geheimdienste auf diese Daten zugreifen können. Das ist nicht paranoid, sondern eine legitime geschäftspolitische Überlegung. Es sind regulatorische und geopolitische Erwägungen, die europäische Unternehmen vorsichtig machen.
Passend dazu:
- Telekom und Nvidia | Münchens Milliarden-Wette: Kann eine KI-Fabrik (Rechenzentrum) Deutschlands industrielle Zukunft retten?
Europas Gegenwehr und die amerikanische Wertschöpfungskette
Die europäische Antwort darauf ist eine Strategie der digitalen Souveränität, die von oben verordnet wird. Die Europäische Union forciert ihren Aufstieg zur globalen KI-Macht mit einer klaren Strategie, die im Oktober 2025 vorgestellt wurde. Die Initiative beinhaltet Investitionen von 200 Milliarden Euro in den kommenden Jahren mit Fokus auf Infrastrukturen, Datenzugang und KI-Adoption. Deutschland hat seine KI-Strategie auf 22 Milliarden Euro bis 2030 aufgestockt. Die Europäische Union will mit Projekten wie dem virtuellen Institut RAISE (Resource for AI Science in Europe) als eine Art CERN für KI fungieren und Europas Unabhängigkeit vorantreiben. Alle diese Initiativen zielen darauf ab, dass Europa nicht bloß Konsument amerikanischer Technologie bleibt, sondern eine eigenständige KI-Industrie aufbaut.
Die Realität ist aber komplexer. Ein großer Teil der Milliardeninvestitionen in deutsche Rechenzentren fließt nicht in den deutschen Standort selbst, sondern in den Einkauf von Hochleistungstechnik aus den USA. Der größte Profiteur dieser Rechenzentren-Offensive ist Nvidia, dessen Grafikprozessoren zum Standard in nahezu allen KI-Rechenzentren geworden sind. Fachleute schätzen, dass bei großen Rechenzentrumsanlagen etwa 60 bis 70 Prozent der Gesamtsumme allein für Halbleiter ausgegeben werden. Im jüngst angekündigten Telekom-Rechenzentrum in München sind das weit über 600 Millionen Euro, die direkt nach Silicon Valley fließen. Nur etwa 10 bis 20 Prozent der Investitionen generieren lokale Wertschöpfung in Deutschland. Der Rest ist letztlich amerikanisches Kapital und amerikanische Technologie, die Deutschland durchquert.
Das ist nicht verwerflich, aber es unterstreicht ein fundamentales Problem der europäischen Technologiepolitik. Es gibt einen tiefgreifenden asymmetrischen Handel zwischen Amerika und Europa. Amerika exportiert Chips, Software und Plattformen nach Europa, Europa exportiert Daten zurück nach Amerika. Diese Asymmetrie führt zu einer strukturellen Abhängigkeit, die über rein technische Fragen hinausgeht. Sie hat mit Kontrolle zu tun, mit Wertschöpfung und mit politischer Autorität. Solange Europa nicht in der Lage ist, eigene Chip-Industrien aufzubauen, bleibt es in dieser Position gefangen.
Passend dazu:
- Die unternehmensinterne KI-Plattform als strategische Infrastruktur und unternehmerische Notwendigkeit
Strukturelle Hürden: Von lokaler Opposition bis zur globalen Machtkonzentration
Diese Strukturen offenbaren sich noch deutlicher, wenn man auf die Wertschöpfungsketten blickt. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat berechnet, dass Rechenzentren insgesamt eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von etwa 250 Milliarden Euro für die deutsche Volkswirtschaft generieren, wenn man indirekte Spillover-Effekte auf andere Sektoren einrechnet. Das sind enorme Zahlen. Aber diese Wertschöpfung entsteht nicht in den Rechenzentren selbst. Sie entsteht in den Unternehmen, die Rechenzentren nutzen, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Datenanalysen durchzuführen, ihre KI-Systeme zu trainieren. Die Rechenzentren sind das Rückgrat, aber die Wertschöpfung erfolgt an den Rändern. Wenn 65.000 Arbeitsplätze in der Rechenzentrumsbranche selbst existieren, dann sind das beachtliche Zahlen, aber sie sind klein im Vergleich zu den 5,9 Millionen Arbeitsplätzen, die von Rechenzentren-Services abhängen. Die Multiplikatoren sind enorm, aber auch die Verwundbarkeit.
Ein zweiter kritischer Aspekt ist die Energiefrage nicht nur als technisches, sondern als geopolitisches Problem. Die europäischen Stromnetze sind nach Logiken des 20. Jahrhunderts gebaut. Sie waren nicht dafür ausgelegt, dass gigantische, konzentrierte Lasten wie ein großes KI-Rechenzentrum an vielen Orten gleichzeitig aktiviert werden. Ein großes Rechenzentrum kann fünf Gigawatt oder mehr benötigen, was in einigen europäischen Regionen die gesamte lokale Kapazität ist. Die Lösung liegt auf der Hand: dezentralisierte Infrastrukturen mit starken lokalen Stromquellen, massive Investitionen in Speichertechnologien, Flexibilität in der Nachfrage und Angebot. Aber alles das kostet Zeit und Geld, den Amerika hat.
Die USA sind dabei, ihre Position zu verfestigen. Ein Konsortium um Nvidia und BlackRock kaufte kürzlich den amerikanischen Rechenzentrum-Betreiber Aligned Data Centers für 40 Milliarden Dollar. Das Konsortium namens Artificial Intelligence Infrastructure Partnership plant, eine riesige Infrastruktur von über 50 Rechenzentrumsstandorten mit einer Gesamtleistungsaufnahme von über fünf Gigawatt zu kontrollieren. Das ist eine unbehörde Konzentration von Macht über digitale Infrastruktur. Nvidia hat ferner Großaufträge gesichert: Oracle plant laut Financial Times rund 40 Milliarden Dollar in den Kauf von 400.000 Nvidia-GB200-Chips zu investieren, um ein gigantisches 1,2-Gigawatt-Rechenzentrum im texanischen Abilene auszustatten, das Teil eines 500-Milliarden-Dollar-Projekts mit OpenAI ist. Diese Zahlen sind gewaltig und zeigen die materielle Basis, auf der amerikanische Tech-Macht aufbaut. Europa hat diese Mittel nicht. Gleichzeitig hat Europa eine breitere Basis: Die industriellen Kompetenzen Deutschlands, Frankreichs und Italiens, die technisches Wissen von Jahrzehnten sind real. Aber ohne eigene Infrastruktur und ohne Kontrolle über die digitale Basis, kann diese Expertise nicht zu digitaler Macht werden.
Ein weiteres Problem liegt in der Strategischen Unsicherheit und den Schwankungen politischer Prioritäten in Deutschland. Das Mittenwalde-Projekt scheiterte nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch, weil die lokalen Genehmigungsprozesse langwierig waren und die Rahmenbedingungen unsicher blieben. Rechenzentren sind in vielen deutschen Gemeinden nicht beliebt. Sie sehen schwarz, sind energieintensiv, haben aber wenige positive Effekte für die lokale Bevölkerung. Die Genehmigungsprozesse können sich über Jahre ziehen. Das ist eine Form von lokaler Opposition, die durchaus verständlich ist, aber auch eine Erklärung dafür, warum Tech-Konzerne zögern, in Deutschland zu investieren. Die USA hat klare Regeln, schnelle Genehmigungsverfahren und eine Pro-Tech-Kultur, die zumindest in Texas, Virginia und anderen Zentren dominant ist. Deutschland und Europa müssen ihre Prozesse beschleunigen und eine neue Mentalität etablieren, in der Rechenzentren als strategische Infrastruktur behandelt werden wie Flughäfen oder Kernkraftwerke.
Ein symptomatisches Investment: Mehr als nur ein Vertrauensbeweis
Die anderen großen Tech-Investitionen in Deutschland sind deutlich jünger. Das Telekom-Rechenzentrum mit Nvidia wird ab 2026 online gehen. Microsoft und Amazon sind ebenfalls present, aber die konkrete Infrastruktur liegt noch in der Zukunft oder ist noch nicht massiv sichtbar. Unter diesen Umständen sind Googles angekündigte Großinvestitionen bedeutsam nicht wegen ihrer absoluten Größe, sondern wegen ihrer symbolischen Kraft. Sie signalisieren, dass Deutschland und Europa wieder interessant werden, nachdem Jahre der Stagnation. Sie signalisieren auch, dass die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen sich verbessern könnten. Die Frage ist nur, ob das ausreicht, um wirklich strukturelle Verschiebungen zu bewirken.
Das eigentliche Problem liegt darin, dass digitale Infrastruktur ein öffentliches Gut geworden ist, das aber von privaten Akteuren bereitgestellt wird. Ein Rechenzentrum ist kein Werk der Ingenieurskunst wie ein Flughafen oder eine Autobahn, sondern ein schwarzer Kasten, der Wert absorbiert und nach außen verteilt. Die USA haben lange verstanden, dass die Kontrolle über digitale Infrastruktur strategische Bedeutung hat. Deutschland und Europa müssen dies auch verstehen. Das bedeutet nicht, dass der Staat selbst Rechenzentren bauen muss. Es bedeutet aber, dass der Staat die Rahmenbedingungen schaffen muss, dass europäische Unternehmen und Staaten eine echte Wahl haben. Solange nur American Tech-Konzerne die Mittel und die Macht haben, um große Rechenzentren zu bauen, bleibt die Abhängigkeit strukturell. Solange Nvidia der einzige Chip-Hersteller ist, der in großem Maßstab Grafikprozessoren für KI liefert, bleibt die Abhängigkeit erhalten.
Googles neue Investitionen in Deutschland sind daher weder reine gute Nachrichten noch eine Lösung der strukturellen Probleme. Sie sind ein Symptom einer europäischen Schwäche: Die Fähigkeit, Infrastruktur zu bauen, ist an die globalen Oligopole delegiert worden. Was Deutschland dringend braucht, ist nicht nur Investitionen von Google, sondern eigene Fähigkeiten, eigene Infrastruktur und eigene strategische Unabhängigkeit. Das ist ein generationenprojekt, und es hat gerade begonnen. Ohne radikale politische und unternehmerische Umbruch wird Europa in den nächsten Jahrzehnten weiter hinter Amerika zurückfallen, egal wie viele Milliarden Google investiert.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.