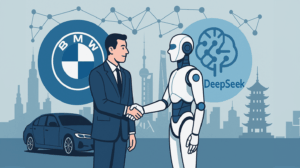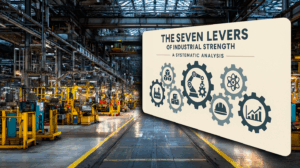Beben in der Autoindustrie: Warum BMW jubelt, während VW und Mercedes zittern
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 5. November 2025 / Update vom: 5. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein
Die Rettung kommt aus München: Kann BMWs „Neue Klasse“ die deutsche Auto-Ehre retten?
Die Gewinner und Verlierer der Elektromobilitätsrevolution – Eine Branche im Umbruch
Ein Beben erschüttert die deutsche Automobilindustrie, und die neuesten Quartalszahlen sind mehr als nur eine Momentaufnahme – sie sind das Zeugnis einer dramatischen Zerreißprobe. Selten zuvor war die Kluft zwischen den heimischen Giganten so tief: Während BMW mit einer klaren und konsequenten Strategie Milliardengewinne einfährt und die Zukunft der Elektromobilität selbstbewusst gestaltet, stürzen Volkswagen und Mercedes-Benz in eine tiefe Krise, gezeichnet von strategischen Fehlentscheidungen, schmerzhaften Verlusten und einem verzweifelten Kampf um den Anschluss.
Der entscheidende Wendepunkt, der über Triumph oder Desaster entscheidet, ist die unumkehrbare Transformation hin zur Elektromobilität. Mutige Weichenstellungen bei BMW führen zu Rekordergebnissen und vollen Auftragsbüchern für die „Neue Klasse“, während das Zögern und die Kehrtwenden bei Porsche den gesamten VW-Konzern in die roten Zahlen reißen. Gleichzeitig kämpft Mercedes-Benz mit dem schwindenden Einfluss im einstigen Wachstumsmarkt China, wo lokale E-Auto-Hersteller die Spielregeln neu definieren. Dieser Artikel analysiert die scharfen Kontraste der jüngsten Bilanzen, deckt die strategischen Manöver auf, die zu Erfolg oder Misserfolg führen, und zeigt, was für die Zukunft der deutschen Schlüsselindustrie wirklich auf dem Spiel steht.
Passend dazu:
Divergenzen im Wandel: Warum die deutsche Automobilindustrie sich neu erfinden muss
Die deutsche Automobilindustrie durchlebt derzeit eine der bedeutsamsten Transformationsphasen ihrer Geschichte. Während einige Konzerne diese turbulente Phase erfolgreich navigieren, verzeichnen andere erhebliche Verluste. Die Quartalsergebnisse des dritten Quartals 2025 zeichnen ein differenziertes Bild einer Branche, die sich in vielen Bereichen selbst neu definiert, wobei Strategische Entscheidungen zwischen Verbrennungsmotoren und Elektromobilität über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Explosive Gewinne durch konsistente Strategieausrichtung – Das BMW-Phänomen
BMW hat im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Vorsteuerergebnis von 2,33 Milliarden Euro erzielt, was einem Zuwachs von 178 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Nettogewinn betrug knapp 1,7 Milliarden Euro, mehr als das Dreifache des Vorjahresquartals. Diese Zahlen sind an sich bemerkenswert, wobei allerdings angemerkt werden muss, dass das Vorjahresquartal durch erhebliche Bremsenbeschaffungsprobleme belastet war, die die Produktionsmengen reduzierten. Unabhängig von diesem Basiseffekt zeigt sich jedoch eine solide operative Verbesserung, die auf eine durchdacht angelegte Strategie hindeutet.
Das EBIT des Automobilsegments wuchs um 33,3 Prozent, während die EBIT-Marge auf 5,2 Prozent anstieg, verglichen mit 2,3 Prozent im Vorjahresquartal. Die Gesamtgruppe erzielte eine EBT-Marge von 7,2 Prozent. Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal 588.140 Fahrzeuge aus, ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders hervorzuheben ist der freie Cashflow des Automobilsegments, der auf 2,7 Milliarden Euro anwuchs und damit die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
BMW profitiert von einer breitangelegten Produktoffensive, die sich nicht nur auf Elektrofahrzeuge konzentriert. Die Performance-Marke BMW M trug wesentlich zum Wachstum bei, während gleichzeitig elektrifizierte Modelle an Bedeutung gewannen. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Gesamtabsatz betrug 40,9 Prozent in Europa, womit das Unternehmen zeigt, dass ein Mixed-Portfolio unter den aktuellen Marktbedingungen profitabel betrieben werden kann. Diese Strategie ermöglicht es BMW, nicht abhängig von einer einzigen Antriebstechnologie zu sein, sondern vielmehr auf die Nachfragestruktur in verschiedenen Märkten zu reagieren.
Chief Executive Officer Oliver Zipse bezeichnete die Geschäftsergebnisse als Beweis für die Robustheit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ermöglicht es, dabei gleichzeitig die europäischen CO₂-Ziele ohne zusätzliche Flexibilisierungsmechanismen zu erreichen. Dieses Versprechen signalisiert dem Markt Klarheit über die strategische Ausrichtung und gibt Investoren wie Kunden Sicherheit.
Passend dazu:
Strategische Fehlentscheidungen und deren Konsequenzen – Das Volkswagen-Desaster
Der Volkswagen-Konzern, einst stolzer Marktführer in Westeuropa und mit strategischen Ambitionen in Asien, verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 1,072 Milliarden Euro. Dies stellt einen Rückgang von 2,632 Milliarden Euro gegenüber dem Gewinn von 1,56 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum dar. Ein solcher Einbruch mag für einen Konzern dieser Größe als Überraschung wirken, doch die Ursachen sind fundamental und offenbaren tiefgreifende Probleme in der Unternehmensführung.
Der Kern des Problems liegt in der Tochtermarke Porsche, die sich einer existentiellen Krise gegenübersieht. Porsche verzeichnete im dritten Quartal einen Betriebsverlust von 967 Millionen Euro, während das Unternehmen im Vorjahr noch einen Gewinn von etwa einer Milliarde Euro auswies. Der Grund für diese dramatische Veränderung liegt in einer strategischen Neuausrichtung, die als fehlgeleitet beschrieben werden muss. Ursprünglich war geplant, dass Porsche die Elektromobilität als strategischen Schwerpunkt ausbauen würde. Diese Planung wurde jedoch radikal revidiert. Das Management beschloss, die Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge zu verlangsamen und stattdessen das Engagement bei klassischen Verbrennungsmotoren zu verlängern. Diese Entscheidung führte zu massiven Sonderbelastungen in Höhe von etwa 1,8 Milliarden Euro für die Umstrukturierung und Anpassung der Produktionslinien.
Für den gesamten Volkswagen-Konzern bedeutet dies, dass die Sondereffekte, einschließlich Abschreibungen auf Geschäftswerte bei Porsche, sich auf etwa 7,5 Milliarden Euro summierten. Ein bereinigtes Ergebnis hätte eine operative Marge von 5,4 Prozent ergeben, aber die Sonderbelastungen verschoben das Unternehmen ins Negative. Die Absatzzahlen des Konzerns zeigen zudem ein differenziertes Bild. Während der Gesamtumsatz um 2,3 Prozent auf etwa 80 Milliarden Euro stieg und die Fahrzeugauslieferungen leicht anzogen, verdecken diese Zahlen erhebliche regionale Probleme.
Die Kernmarke Volkswagen verzeichnete jedoch erste Fortschritte durch Sparprogramme. Besonders bemerkenswert war, dass die Auftragseingänge für Elektrofahrzeuge in Westeuropa im dritten Quartal um 64 Prozent anstiegen. Dies deutet darauf hin, dass das Kernproblem nicht bei einer fehlenden Marktnachfrage nach Elektrofahrzeugen liegt, sondern vielmehr bei den strategischen Fehlentscheidungen auf Konzernebene, insbesondere bei Porsche.
Der Finanzvorstand Arno Antlitz betonte, dass diese Sondereffekte zeitlich begrenzt sind und die Restrukturierungsmaßnahmen langfristig zu einer Verbesserung führen sollen. Allerdings offenbaren die Zahlen eine tiefe Krise in der Führungsstruktur und der strategischen Planung. Der Volkswagen-Konzern steht unter enormem Druck, sich nicht nur technologisch neu auszurichten, sondern auch die Organisationsstrukturen anzupassen.
Schwäche in der Premiumklasse – Mercedes-Benz im Krisenmanagement
Mercedes-Benz, lange Zeit ein Symbol für Ingenieurkunst und Profitabilität, sah sich im dritten Quartal 2025 mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Das Konzernergebnis fiel um fast ein Drittel auf 1,19 Milliarden Euro, verglichen mit 1,72 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank um etwa 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, während das berichtete EBIT um etwa 70 Prozent auf 750 Millionen Euro einbrach, stark beeinflusst von Restrukturierungskosten von über 400 Millionen Euro.
Die operative Marge des Unternehmens reduzierte sich von 11,5 Prozent im Vorjahr auf etwa acht Prozent. Dies liegt am unteren Ende der von Mercedes-Benz selbst prognostizierten Spanne von vier bis sechs Prozent und deutet auf mangelnde Steuerung hin. Der Umsatz sank um 6,9 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, auch wenn Analysten diese Zahlen als weniger dramatisch einschätzten als befürchtet.
Die Absatzzahlen zeigen ein globales Bild der Schwäche. Mercedes-Benz lieferte 525.300 Fahrzeuge aus, ein Rückgang um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das größte Problem offenbarte sich in China, wo die Verkäufe um etwa 27 Prozent einbrachen. Dies ist besonders schmerzhaft, da China lange Zeit ein Wachstumsmotor des Unternehmens war. Die Gründe für diesen Absturz sind vielfältig: Hohe Zinssätze, geopolitische Unsicherheiten und vor allem die zunehmende Dominanz lokaler Elektrofahrzeughersteller wie BYD und Nio haben die Nachfrage nach Premiumfahrzeugen europäischer Hersteller deutlich reduziert.
Hinzu kommen die neuen US-Zölle auf importierte Fahrzeuge, die sich nach Unternehmensangaben mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag auf die Bilanz auswirkten. Diese externen Faktoren, kombiniert mit gestiegenen Produktionskosten und dem Druck, die Produktion umzustrukturieren, führten zu der schwachen Bilanz.
Ein Lichtblick zeigt sich bei der Elektromobilität. Die Zahl reiner Elektrofahrzeuge stieg um 22 Prozent auf 42.600 Einheiten. Zusammen mit Plug-in-Hybriden erreichte der Anteil elektrifizierter Modelle etwa 18 Prozent des Gesamtabsatzes. CEO Ola Källenius betonte, dass die Quartalsergebnisse den Erwartungen entsprechen und kündigte verstärkte Sparmaßnahmen an. Der Konzern konzentriert sich stärker auf profitable Segmente und hat mit der Einführung neuer Elektromodelle wie dem GLC begonnen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das Unternehmen verfügt jedoch über ausreichende finanzielle Ressourcen, mit einer Nettoliquidität von etwa 27 Milliarden Euro, um diese Transformation zu finanzieren.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
BMWs Neue Klasse: Der Schlüssel für Europas E-Auto-Offensive?
Porsche am Wendepunkt – Die Kosten strategischer Neuorientierung
Porsche steht als Fallstudie für die Konsequenzen widersprüchlicher Strategieentscheidungen. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rückgang der Nettoeinnahmen um 95,9 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro. Die operative Rendite, die in besseren Jahren bis zu 15 Prozent erreichte und Porsche als den profitabelsten deutschen Autobauer auszeichnete, fiel auf nur 0,2 Prozent.
Der Grund für diesen Absturz liegt in der bereits erwähnten strategischen Neuausrichtung, die im September 2025 angekündigt wurde. Anstatt die geplante aggressive Elektrifizierungsstrategie beizubehalten, beschloss Porsche, wichtige Elektromodelle zu verzögern oder neu zu konzipieren und stattdessen stärker auf klassische Verbrenner und Plug-in-Hybride zu setzen. Diese Entscheidung wurde mit Marktrealitäten begründet: Die Nachfrage nach vollelektrischen Modellen sei in vielen Regionen schwächer als erwartet. Diese Argumentation ist jedoch fragwürdig, da sie nicht auf empirischen Daten basiert, sondern eher ideologischen Überlegungen entspricht.
Die Absatzzahlen von Porsche zeigen ein differenziertes Bild. Der Gesamtabsatz sank zwischen Januar und September um sechs Prozent auf etwa 212.000 Fahrzeuge. In Deutschland fiel der Rückgang mit 16,7 Prozent deutlich stärker aus. China war besonders problematisch, mit einem Rückgang um etwa 26 Prozent. Die Meistverkäufer bleiben der 911 und der Cayenne, wobei der Elektroanteil bei den Neuzulassungen in Deutschland (Macan und Taycan) bei etwa 30,5 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass es durchaus Marktnachfrage nach Elektrofahrzeugen in diesem Segment gibt.
Die Umstrukturierungskosten belaufen sich auf rund 1,8 Milliarden Euro für 2025 und umfassen die Anpassung der Produktionsprozesse, die Streichung geplanter Batteriefertigungsanlagen und die Neukonzeption von Modellreihen. Finanzvorstand Jochen Breckner rechtfertigt diese Entscheidungen mit dem Argument, dass kurzfristige Verluste akzeptiert werden müssen, um langfristig die Rentabilität zu sichern. Allerdings wird diese Logik von vielen Marktanalysten angezweifelt, da die globale Elektromobilitätsentwicklung in die entgegengesetzte Richtung weist.
Zum Jahresende 2025 findet ein Führungswechsel statt. Oliver Blume, der das Unternehmen während dieser krisenhaften Phase führte und gleichzeitig Chief Executive Officer des Volkswagen-Konzerns ist, gibt seine Doppelfunktion auf. Ab 2026 wird Michael Leiters, ehemaliger Manager bei McLaren, das Unternehmen übernehmen. Parallel dazu plant Porsche ein umfassendes Sparprogramm mit etwa 1.900 Stellenabbaumaßnahmen bis 2029. Finanzvorstand Breckner geht davon aus, dass 2025 den Tiefpunkt markiert und ab 2026 wieder eine spürbare Verbesserung eintritt.
Passend dazu:
- Die Autoindustrie ist im Panikmodus: Europas industrielle Zeitenwende – Wenn Abhängigkeiten zur existenziellen Bedrohung werden
Die globalen Marktkräfte: China als Treiber und Bedrohung zugleich
Die fundamentalen Unterschiede in der Performance der deutschen Autobauer lassen sich nur vollständig verstehen, wenn man die globalen Marktdynamiken einbezieht. China ist dabei der zentrale Faktor. Der Elektrofahrzeugmarkt in China erlebte im ersten Dreiquartal 2025 ein Wachstum von 24,5 Prozent mit insgesamt 8,89 Millionen Neuzulassungen. Dies entspricht einem Marktanteil von 52,4 Prozent aller Fahrzeugverkäufe in China. Die reinen Elektrofahrzeuge (BEV) verzeichneten ein noch stärkeres Wachstum von 32 Prozent, deren Anteil am Gesamtmarkt stieg auf 32,1 Prozent.
Für deutsche Autobauer stellt diese Entwicklung eine massive Herausforderung dar. Das Center of Automotive Management stellte fest, dass die VW-Gruppe bei den stark wachsenden Elektroabsätzen in China nur einen Marktanteil von 0,9 Prozent erreichte, ein Rückgang von 51,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. BYD führt mit einem Marktanteil von 28,7 Prozent, gefolgt von Geely mit 12,3 Prozent. Dies offenbart das tiefe Problem: Deutsche Hersteller können in dem für die globale Automobilindustrie am schnellsten wachsenden Markt nicht konkurrieren.
Die Gründe liegen in mehreren Faktoren. Erstens haben chinesische Hersteller Kostenvorteile bei der Batterieproduktion entwickelt, die es ihnen ermöglichen, preislich konkurrenzfähige Elektrofahrzeuge zu produzieren. Zweitens haben sie eine frühe Spezialisierung auf Elektromobilität vorgenommen, während deutsche Hersteller lange zwischen Verbrenner- und Elektrotechnologie hin und her gewogen haben. Drittens verfügen chinesische Hersteller über ein tiefes Verständnis des lokalen Marktes und können Fahrzeuge produzieren, die den Anforderungen dieses Marktes entsprechen. Der chinesische Staat hat zudem ein klares Signal gegeben, dass Elektrofahrzeuge nicht mehr unter den strategisch wichtigen Branchen aufgeführt werden, was darauf hindeutet, dass die Subventionen für die Industrie auslaufen werden und eine Phase der Marktkonsolidierung bevorsteht.
Für deutsche Autobauer bedeutet dies, dass die langfristigen Wachstumsaussichten in einem der wichtigsten Märkte derzeit äußerst begrenzt sind. Mercedes hat dies am stärksten gespürt, mit einem Rückgang in China um 27 Prozent. BMW, das weniger abhängig von diesem Markt ist, konnte ein Plus von 11,2 Prozent verzeichnen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer diversifizierten geografischen Präsenz.
In Europa zeigt sich ein anderes Bild. Der Elektrofahrzeugmarkt wächst dynamischer als erwartet. In den ersten neun Monaten 2025 wurden 2,72 Millionen Elektrofahrzeuge neu zugelassen, ein Wachstum von 27,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil elektrifizierter Fahrzeuge erreichte 27,4 Prozent in Europa. Die reine Elektromobilität (BEV) wächst um 25,4 Prozent. Dies bietet deutschen Herstellern eine Chance, ihre Marktposition zu bewahren.
Die Rettung durch technologische Neuausrichtung – Die Neue Klasse von BMW
Das Kernstück der WettbewerbsStrategie Deutschlands ist die sogenannte Neue Klasse von BMW. Dieser Name verweist zurück auf die Fahrzeuge der 1960er Jahre, die das Unternehmen aus einer früheren Krise führten. Heute markiert die Neue Klasse einen ähnlich großen Wendepunkt. Das erste Serienmodell, der iX3, wurde auf der IAA 2025 in München präsentiert und sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit.
Der BMW iX3 basiert auf einer völlig neu entwickelten Fahrzeugarchitektur, die speziell für batterieelektrische Antriebe konzipiert wurde. Das Fahrzeug verspricht mehrere technologische Verbesserungen. Die Reichweite soll bis zu 805 Kilometer nach dem WLTP-Prüfverfahren erreichen. Die Ladearchitektur mit 800 Volt ermöglicht deutlich schnellere Ladezeiten im Vergleich zu 400-Volt-Systemen. BMW hat die Software und das Bedienkonzept grundlegend überarbeitet und behebt damit bekannte Schwachpunkte früherer Elektrofahrzeuge deutscher Hersteller, die mit ruckelig laufenden Systemen und endlos langen Ladezeiten zu kämpfen hatten.
Der Einstiegspreis liegt bei unter 70.000 Euro, was für das Premiumsegment deutlich günstiger ist als vergleichbare Modelle und auch unter dem Preis des traditionellen X3 mit Verbrennungsmotor liegt. Dies ist ein strategisches Zeichen, dass BMW sich nicht nur an Kunden mit unbegrenztem Budget richten will, sondern auch in der Massenprämiumklasse konkurrenzfähig sein möchte.
Die Marktakzeptanz ist überraschend stark. In den ersten sechs Wochen nach der Vorstellung auf der IAA erreichte der iX3 über 3000 Bestellungen. Dies liegt deutlich über dem Niveau früherer Modelle wie dem X3 mit Verbrennungsmotor. Bemerkenswert ist dabei, dass die Kunden den iX3 in dieser frühen Phase ohne Probefahrt bestellt haben, was auf das Vertrauen in die Marke und die Überzeugungskraft des Produktkonzepts hindeutet. Die Produktionskapazitäten in Ungarn, wo die Neue Klasse produziert wird, könnten jedoch zum limitierenden Faktor werden. BMW-Manager signalisieren bereits, dass die verfügbaren Kapazitäten 2026 nicht ausreichen werden, um die hohe Nachfrage zu befriedigen.
BMW plant, bis 2027 insgesamt sechs Modelle der Neuen Klasse auf den Markt zu bringen. Diese werden die Modellpalette von Einstiegsfahrzeugen bis zu höherwertigen Segmenten abdecken. Die langfristige Vision ist, dass die Neue Klasse zum neuen Standard bei BMW wird und die Produkte in den kommenden Jahren dominiert.
Die europäische Koordination und deren Grenzen
Parallel zur BMW-Initiative haben auch andere europäische Hersteller neue Elektrofahrzeugplattformen entwickelt. Mercedes bringt den GLC auf der MB.EA-Basis auf den Markt, Volkswagen präsentiert den ID.Polo und ID.Cross als bezahlbare Einstiegsmodelle. Analysten prognostizieren, dass BMW mit seiner iX3-Strategie eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des europäischen Wettbewerbs spielen könnte.
Das Problem besteht jedoch darin, dass diese europäische Koordination zeitlich versetzt abläuft und nicht immer auf der gleichen strategischen Klarheit basiert. Während BMW eine konsistente Linie verfolgt, sind Porsche und Volkswagen in sich selbst widersprechen. Mercedes balanciert zwischen verschiedenen Strategien. Dies eröffnet Chancen für schnellere und entschlossenere Akteure, sowohl innerhalb Europas als auch global.
Der strukturelle Wandel: Was die Krise wirklich bedeutet
Über die kurzfristigen Quartalsergebnisse hinaus offenbaren die Zahlen einen tieferen strukturellen Wandel in der Automobilindustrie. Die Fähigkeit, die Elektromobilität konsequent zu verfolgen, während gleichzeitig Kosteneffizienz gewahrt bleibt, wird zum strategischen Unterscheidungskriterium. BMW hat diese Balance gefunden, Volkswagen und Porsche haben sie verloren, und Mercedes versucht, sie wiederzugewinnen.
Analysten von Unternehmensberatungen wie McKinsey und Oliver Wyman warnen vor drastischen Konsequenzen für Unternehmen, die diese Transformation nicht erfolgreich absolvieren. Sie projizieren, dass bis 2035 bis zu ein Drittel der industriellen Wertschöpfung verloren gehen könnte, das wären etwa 440 Milliarden Euro, sollte die Transformation fehlschlagen. Stellenverluste in sechsstelliger Größenordnung sind bereits im Gange. Volkswagen kündigt 35.000 Stellenabbaumaßnahmen an, Porsche plant 1.900 Stellen bis 2029.
Die deutsche Automobilindustrie befindet sich nicht bloß in einer konjunkturellen Delle, sondern in einer fundamentalen Umstrukturierung ihrer Geschäftsmodelle, ihrer Wertschöpfungsketten und ihrer organisatorischen Strukturen. Unternehmen, die diese Transformation erfolgreich bewältigen, werden gestärkt hervorgehen. Unternehmen, die zögern oder fehlerhafte Strategien wählen, riskieren einen langfristigen Abstieg.
Passend dazu:
Die Geopolitischen Rahmenbedingungen verschärfen die Situation
Eine weitere Dimension der Krise besteht in den geopolitischen Unsicherheiten und Handelsbarrieren, die sich verschärfen. Die US-Zölle auf importierte Fahrzeuge belasten bereits die Bilanzen der deutschen Hersteller. Neue Handelsspannungen und potenzielle Zollerhöhungen könnten die Situation weiter verschärfen. Dies trifft besonders Hersteller, die in den USA produzieren oder importieren, und es verstärkt die Dringlichkeit, lokale Produktionsstätten zu errichten oder auszubauen.
Die europäische Regulierung rund um das Verbrennermotorverbot ab 2035 erzeugt zusätzliche Unsicherheiten. Einige europäische Politiker haben versucht, dieses Verbot aufzuweichen und Plug-in-Hybride sowie E-Fuels zuzulassen. Dies schafft Verwirrung bei Konsumenten und Investoren über die mittelfristige Ausrichtung der Industrie. Expertenanalysen zeigen jedoch, dass dieser Kurs kontraproduktiv ist, da es die notwendigen Investitionen in echte Elektromobilität verzögert und damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gefährdet.
Passend dazu:
- Chinas Elektroautoindustrie steuert auf eine historische Konsolidierung zu –und zwingt selbst Marktführer BYD in die Flucht
Ein Übergangsmarkt mit klaren Gewinnern und Verlierern
Die Quartalsergebnisse der deutschen Automobilhersteller offenbaren eine Industrie im Übergang. BMW zeigt, dass es möglich ist, rentabel zu wachsen, während gleichzeitig eine konsistente Elektrifizierungsstrategie verfolgt wird. Das Geheimnis liegt in der Breite des Produktportfolios, der Klarheit der Ausrichtung und der Fähigkeit, Kostenmanagement mit Produktinnovation zu verbinden.
Volkswagen und insbesondere Porsche zeigen die Gefahren widersprüchlicher Strategieentscheidungen auf. Das ständige Hin- und Herwechseln zwischen Verbrennungs- und Elektrotechnologie, gepaart mit massiven Umstrukturierungskosten, führt zu Verlustergebnissen und Verwirrtung bei Stakeholdern. Mercedes befindet sich in einer Übergangssituation, verfügt aber über die finanziellen Mittel und das technologische Know-how, um aus dieser Krise hervorzugehen, sofern die Strategie konsistent bleibt.
Die globale Wettbewerbsdynamik, insbesondere der chinesische Markt, wird in den kommenden Jahren entscheidend sein. Deutsche Hersteller müssen ihre Kosteneffizienz verbessern, ihre Präsenz in China neu aufbauen und ihre europäische Position stärken. Die Neue Klasse von BMW könnte sich als Spielwechsler erweisen, aber der Erfolg ist nicht garantiert. Die kommenden zwei bis drei Jahre werden entscheidend sein für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten