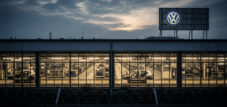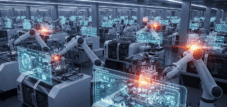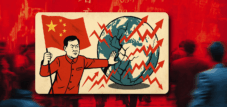Bosch im Zweifrontenkrieg: Der Kampf gegen 22.000 Jobverluste und der akute Produktionsstopp durch Kurzarbeit
Xpert Pre-Release
Sprachauswahl 📢
Veröffentlicht am: 28. Oktober 2025 / Update vom: 28. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Bosch im Zweifrontenkrieg: Der Kampf gegen 22.000 Jobverluste und der akute Produktionsstopp durch Kurzarbeit – Kreativbild: Xpert.Digital
Der Fall Bosch: Ist das das Ende des deutschen Industriewunders? Ein Konzern am Abgrund reißt eine ganze Nation mit
Bosch-Beben: Warum der deutsche Riese jetzt 22.000 Jobs streicht – und das erst der Anfang sein könnte
Der deutsche Vorzeigekonzern Bosch, einst ein unerschütterliches Symbol für Ingenieurskunst und Stabilität, befindet sich im Würgegriff einer beispiellosen Doppelkrise. Ein perfekter Sturm aus langfristigen strategischen Versäumnissen bei der Transformation zur Elektromobilität und einem akuten geopolitischen Schock hat das Unternehmen in eine seiner schwersten Phasen gestürzt. Die Ankündigung, bis 2030 insgesamt 22.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen, ist nur die sichtbarste Folge eines tiefgreifenden Problems, das weit über Bosch hinausreicht. Während die Gewinne einbrechen und die Zukunft der Verbrenner-Sparte schwindet, legt eine neue Chipkrise um den Hersteller Nexperia die fatale Abhängigkeit der deutschen Industrie von globalen Lieferketten und politischen Machtspielen zwischen den USA und China schonungslos offen. Die Krise bei Bosch ist damit mehr als nur die Geschichte eines Konzerns in Not – sie ist ein Alarmsignal für die Zukunftsfähigkeit des gesamten deutschen Industriemodells und stellt die Frage, ob der über Jahrzehnte aufgebaute Wohlstand auf dem Spiel steht.
Passend dazu:
- Der Chip-Schock: Wenn ein Bauteil Europas Industrie lahmlegt – Europas Halbleiterindustrie am Scheideweg
Bosch im Würgegriff der Transformation: Wenn der deutsche Vorzeigekonzern zur Geisel geopolitischer Machtspiele wird
Die aktuellen Entwicklungen bei Bosch offenbaren eine komplexe Gemengelage, in der sich langfristige strukturelle Defizite mit kurzfristigen geopolitischen Schocks zu einem perfekten Sturm verbinden. Der weltgrößte Automobilzulieferer navigiert durch eine der schwierigsten Phasen seiner Unternehmensgeschichte, während gleichzeitig eine neue Chipkrise die Verwundbarkeit global vernetzter Produktionsketten schonungslos offenlegt. Die Dimensionen dieser Entwicklung reichen weit über den einzelnen Konzern hinaus und werfen grundsätzliche Fragen zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Industriemodells auf.
Ende September 2025 kündigte Bosch an, bis 2030 weitere 13.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen, zusätzlich zu den bereits 2024 angekündigten 9.000 Stellen. Damit stehen insgesamt etwa 22.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, was einer historischen Dimension entspricht, die in der über 130-jährigen Geschichte des Unternehmens beispiellos ist. Besonders betroffen sind die Standorte Stuttgart-Feuerbach mit rund 3.500 Stellen, Schwieberdingen mit 1.750, Bühl mit 1.550 sowie Homburg im Saarland mit 1.250 Arbeitsplätzen. Am Standort Waiblingen soll die gesamte Produktion von Verbindungstechnik mit 560 Beschäftigten bis Ende 2028 eingestellt werden. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die jährlichen Kosten der Mobility-Sparte um 2,5 Milliarden Euro zu reduzieren und die operative Marge von derzeit mageren 3,5 Prozent auf die anvisierten sieben Prozent zu steigern.
Die Geschäftsführung unter Arbeitsdirektor Stefan Grosch und Mobility-Vorstand Markus Heyn argumentiert mit der veränderten Marktlage in der Automobilindustrie. Die Nachfrage nach Komponenten für Verbrennungsmotoren sinkt kontinuierlich, während der erhoffte Hochlauf der Elektromobilität deutlich langsamer verläuft als ursprünglich kalkuliert. Besonders drastisch zeigt sich dies in den Beschäftigungszahlen. Während für die Produktion von Dieseleinspritzkomponenten zehn Mitarbeiter benötigt werden und für Benzineinspritzsysteme drei, kommt die Elektromobilität mit nur einem Beschäftigten aus. Diese Produktivitätsschere verdeutlicht die fundamentale Herausforderung des Strukturwandels. Gleichzeitig belasten hohe Vorleistungen für neue Technologien wie Elektromobilität, Wasserstoff und automatisiertes Fahren die Ertragslage massiv, ohne dass sich die gewünschten Markterfolge eingestellt hätten.
Im Geschäftsjahr 2024 sank der Umsatz von Bosch um ein Prozent auf 90,5 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 4,8 Milliarden Euro auf nur noch 3,2 Milliarden Euro einbrach. Die operative Marge von 3,5 Prozent liegt damit weit unter den Anforderungen einer wettbewerbsfähigen Zulieferindustrie. Im Mobility-Bereich, der mit 55,9 Milliarden Euro mehr als 60 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, stagnierte der Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Eigenkapitalquote von 44,3 Prozent ist zwar noch solide, doch die Investitionsfähigkeit des Konzerns schwindet. Für 2025 erwartet Bosch nur ein organisches Umsatzwachstum zwischen ein und drei Prozent, wobei die operative Rendite sich zwar verbessern, aber noch immer deutlich unter dem Zielwert von sieben Prozent liegen soll.
Passend dazu:
- Die große Transformation: Das Ende der Internet-Wirtschaftsepoche mit 3 bis 5 Millionen verlorenen Arbeitsplätzen?
Die strukturelle Margenenkrise der europäischen Zuliefererindustrie
Die Problematik bei Bosch fügt sich nahtlos in das Bild einer gesamten Branche ein, die unter massivem Ergebnisdruck steht. Nach der globalen Automobilzuliefererstudie von Roland Berger und Lazard sank die durchschnittliche operative Marge der Branche 2024 auf nur noch 4,7 Prozent, nachdem sie sich 2023 vorübergehend bei 5,3 Prozent stabilisiert hatte. Vor der COVID-Pandemie lagen die Margen noch bei etwa 6,7 Prozent. Europäische Zulieferer schneiden mit nur 3,6 Prozent besonders schlecht ab, südkoreanische Anbieter bilden mit 3,4 Prozent das Schlusslicht, während chinesische Konkurrenten mit 5,7 Prozent deutlich profitabler arbeiten.
Diese Entwicklung ist struktureller Natur und nicht nur konjunkturbedingt. Die Zulieferer erleben eine Phase der Stagformation, wie Branchenexperten es nennen. Einerseits stagnieren die Produktionsvolumina, andererseits müssen die Unternehmen gleichzeitig ihre Geschäftsmodelle fundamental transformieren. Die Kosten für diese Transformation sind immens, während die Erträge ausbleiben. Mehr als 40 Prozent der 25 größten Automobilzulieferer weltweit sind inzwischen mit einem Non-Investment-Grade-Rating eingestuft, was ihnen den Zugang zu günstiger Finanzierung erschwert. Zum Vergleich: In anderen Industriesektoren wie der Medizintechnik liegt dieser Anteil bei unter fünf Prozent.
Stagformation bezeichnet einen Zustand in der Automobil-Zulieferindustrie, bei dem das Produktionsvolumen stagniert und gleichzeitig große Veränderungen durch die Transformation, zum Beispiel zur Elektromobilität oder Digitalisierung, bewältigt werden müssen. Der Begriff ist ein Kofferwort aus „Stagnation“ und „Transformation“: Es fehlt Wachstum, aber Unternehmen sind trotzdem gezwungen, massiv in neue Technologien zu investieren, was die Margen und die Wettbewerbsfähigkeit stark unter Druck setzt.
Die Ursachen dieser Margenerosion sind vielschichtig. Stagnierende oder gar rückläufige Fahrzeugproduktion in Europa und Nordamerika trifft auf Überkapazitäten in der Zulieferindustrie. Gleichzeitig müssen massive Investitionen in Elektrifizierung, Softwareintegration und neue Produktionstechnologien gestemmt werden, während die Automobilhersteller aufgrund ihrer eigenen angespannten Ertragslage den Preisdruck auf die Zulieferer kontinuierlich erhöhen. Hinzu kommen gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, höhere Arbeitskosten in Europa sowie steigende Anforderungen durch ESG-Regulierung und Cybersecurity.
Besonders dramatisch ist die Situation für spezialisierte Zulieferer im Bereich der konventionellen Antriebstechnik. Während Komponenten für Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren um 30 bis 35 Prozent zurückgehen werden, müssen gleichzeitig neue Kompetenzen in Bereichen wie Batterietechnologie, Leistungselektronik und Softwareentwicklung aufgebaut werden. Diese Transformation erfordert nicht nur Kapital, sondern auch Know-how, das in vielen traditionellen Zulieferunternehmen nicht vorhanden ist. Der Präsident des Verbandes der europäischen Automobilzulieferer betont, dass zwei Drittel der Mitglieder nur eine Marge von weniger als fünf Prozent erreichen, ein Viertel schreibt sogar rote Zahlen. Damit fehlt das Geld, um die notwendigen Investitionen für die Transformation zu finanzieren.
Der Chipmangel als katalytischer Schock
In diese ohnehin angespannte Situation platzte im Oktober 2025 eine neue Chipkrise, die die Verwundbarkeit der Automobilindustrie gegenüber geopolitischen Verwerfungen schonungslos offenlegt. Im Zentrum steht der niederländische Halbleiterhersteller Nexperia, der zum chinesischen Wingtech-Konzern gehört und zu den weltweit größten Anbietern einfacher Halbleiter wie Dioden, Transistoren und Chips für Batteriemanagement zählt. Das Unternehmen produziert jährlich etwa 100 Milliarden Halbleiter, die in nahezu jedem technischen Gerät zu finden sind, von Fensterhebern über Motorsteuerungen bis zu LED-Systemen in Fahrzeugen.
Ende September 2025 übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle über Nexperia mit der Begründung, schwerwiegende Mängel in der Unternehmensführung festgestellt zu haben, die die wirtschaftliche Sicherheit der Niederlande und Europas gefährden würden. Hintergrund war der Druck der USA, die Wingtech im Dezember 2024 auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatten, da das Unternehmen auch nach 2022 weiterhin Chips für den Bau von Waffen nach Russland geliefert haben soll. Die niederländische Regierung wollte verhindern, dass technologisches Wissen nach China abwandert und dass im Notfall die Versorgung mit diesen kritischen Komponenten nicht mehr gewährleistet werden kann.
Die Reaktion aus Peking folgte prompt und war harsch. Die chinesische Regierung verhängte ein Exportverbot für Nexperia-Produkte, die in China weiterverarbeitet werden sollten. Dies traf die europäische Automobilindustrie mit voller Wucht, denn obwohl die Wafer in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien hergestellt werden, erfolgt die Zerteilung in einzelne Chips sowie deren finale Montage und das sogenannte Packaging in chinesischen Werken. Dieser letzte Produktionsschritt ist besonders personalintensiv und wurde bewusst nach China verlagert, wo die Arbeitskosten niedriger sind. Nach der Übernahme durch Wingtech hatte Nexperia die chinesischen Verpackungskapazitäten um etwa 50 Prozent erhöht.
Für die deutsche Automobilindustrie bedeutete dies eine existenzielle Bedrohung. Die Nexperia-Chips sind für spezifische Steuergeräte zertifiziert, Alternativprodukte müssten zunächst aufwendige Zertifizierungsprozesse durchlaufen und auf Qualität sowie Langlebigkeit getestet werden. Dieser Prozess dauert Monate, in denen die Produktion nicht aufrechterhalten werden kann. Bei Bosch wirkte sich die Knappheit besonders schnell am Standort Salzgitter aus, wo mehr als 1.000 Mitarbeiter in der Just-in-Time-Produktion von Motorsteuergeräten tätig sind. Das Werk koordiniert zudem die gesamte Produktion von Steuergeräten innerhalb der Bosch-Gruppe. Laut IG-Metall-Vorstandsmitglied und Bosch-Betriebsrat Mario Gutmann wurde für diese Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet, wobei noch unklar war, ob die Arbeitsagentur den Antrag genehmigen würde.
Der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Horst Ott berichtete, dass auch andere Autozulieferer mit starken Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen konfrontiert seien und bereits Kurzarbeit angemeldet hätten. Ab der kommenden Woche würden voraussichtlich größere Zulieferbetriebe und jeder Fahrzeughersteller mitteilen können, wie sich der Lieferengpass auf sie auswirkt. Bis dahin müssten alle Krisenszenarien hochgefahren werden, dann werde sichtbar, ob Notfallpläne greifen oder nicht. Bei der IG Metall liefen die Telefone heiß, Betriebsräte ließen sich über die notwendigen Betriebsvereinbarungen für Kurzarbeit beraten.
Volkswagen gab bekannt, dass die Fahrzeugproduktion an deutschen Standorten bis zum 30. Oktober 2025 gesichert sei, kurzfristige Auswirkungen auf das Produktionsnetz des Volkswagen-Konzerns könnten grundsätzlich aber nicht ausgeschlossen werden. Der Konzern prüfte alternative Beschaffungsoptionen. Christian Vollmer, Produktionsvorstand der VW-Marken, äußerte, dass das Unternehmen einen alternativen Lieferanten habe, der den Ausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte. Die Frage war jedoch, wie schnell dieser Ersatz in ausreichendem Volumen verfügbar sein würde.
Die makroökonomischen Dimensionen der Doppelkrise
Die Auswirkungen der kombinierten strukturellen und akuten Chipkrise gehen weit über einzelne Unternehmen hinaus und betreffen die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller berechnete in einer Analyse drei Szenarien, wie stark ein länger anhaltender Chipmangel die deutsche Wirtschaft belasten könnte. Im günstigsten Fall würde das Bruttoinlandsprodukt um 0,04 Prozentpunkte geringer ausfallen, im schlechtesten Fall um 0,48 Prozentpunkte. Das entspräche einem Verlust von bis zu 21 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Die Bundesregierung rechnet für 2025 nur noch mit einem Miniwachstum von 0,2 Prozent. Sollte das Worst-Case-Szenario eintreten, würde Deutschland damit das dritte Jahr in Folge schrumpfen, eine historisch einmalige Entwicklung in der Geschichte der Bundesrepublik.
Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Auto- und Zulieferindustrie keine Halbleiter mehr vom chinesischen Hersteller Nexperia bekommt. Im ersten Szenario gehen die Ökonomen davon aus, dass für etwa die Hälfte der VW-Produktion die Bänder zwei Wochen lang stillstehen, was einem Stopp von einem Fünftel der gesamten deutschen Pkw-Produktion entspricht. Im November läge die Produktion dann schon wieder bei 95 Prozent des Vorkrisenniveaus, im Dezember bei 100 Prozent. In diesem Fall würde das BIP-Wachstum um 0,04 Prozentpunkte gedämpft. Im mittleren Szenario würde der Produktionsstopp vier Wochen dauern, was zu einem Wachstumsverlust von 0,15 Prozentpunkten führen würde. Im schlimmsten Fall würde die Produktion acht Wochen stillstehen, was das BIP um 0,48 Prozentpunkte belasten würde.
Besonders problematisch ist, dass die Auswirkungen über die direkt betroffenen Unternehmen hinausgehen. Wenn Autobauer nicht produzieren können, bestellen sie auch keine Vorprodukte. Die Krise schlägt dann auch auf Zulieferer durch, die ihrerseits gar nicht auf Chips angewiesen sind, etwa Hersteller von Blechen, Achsen oder Reifen. In normalen Zeiten nimmt die Automobilbranche fast ein Zehntel der Produktion der heimischen Metallerzeuger ab. Noch höher liegt der Anteil mit elf Prozent bei den Kunststoffproduzenten. Eine mehrwöchige Produktionsunterbrechung in der Automobilindustrie würde somit Kettenreaktionen durch die gesamte deutsche Industrie auslösen.
Die langfristigen strukturellen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind bereits jetzt gravierend. In der deutschen Automobilindustrie sind nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie in den vergangenen zwei Jahren knapp 55.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Die Beschäftigung sank damit um sieben Prozent auf 718.200 Mitarbeitende. Bei den Autozulieferern war der Rückgang mit 11,5 Prozent auf 236.700 Beschäftigte besonders stark. Eine Studie von EY zeigt, dass allein im Jahr 2024 etwa 19.000 Stellen in der deutschen Autoindustrie verloren gingen. Ende 2024 waren noch etwas mehr als 761.000 Menschen in der Branche beschäftigt, der niedrigste Stand seit 2013.
Bei den Zulieferern konzentrieren sich die Stellenstreichungen. Neben Bosch kündigten auch ZF Friedrichshafen den Abbau von bis zu 14.000 Stellen in Deutschland bis 2028 an, Continental will weltweit weitere 3.000 Stellen im Automotive-Bereich streichen, bei Schaeffler sind es 2.800 Jobs. In Baden-Württemberg, dem Herzland der deutschen Automobilindustrie, könnte eine vom Land in Auftrag gegebene Strukturstudie zufolge bis 2030 bis zu 66.000 Arbeitsplätze in der Automobilbranche verloren gehen. Die Frage ist nicht mehr, ob es zu massiven Arbeitsplatzverlusten kommt, sondern nur noch, in welchem Tempo und in welchem Ausmaß.
Die Anatomie einer industriellen Sackgasse
Die aktuelle Situation offenbart fundamentale strategische Fehlentscheidungen auf mehreren Ebenen. Erstens wurde die Transformation zur Elektromobilität von der deutschen Automobilindustrie zu lange verzögert und dann zu abrupt vollzogen. Während chinesische Hersteller über Jahre hinweg systematisch Kompetenzen in Batterietechnologie, Leistungselektronik und Softwareentwicklung aufbauten, konzentrierten sich deutsche Hersteller und Zulieferer auf die Optimierung bestehender Verbrennertechnologie. Als die politisch erzwungene Wende kam, fehlten sowohl das technologische Know-how als auch die industriellen Kapazitäten, um den Rückstand aufzuholen. Bosch beispielsweise stieg aus dem Joint Venture für Batterietechnologie mit Johnson Controls aus, während die Amerikaner daraus das heute erfolgreiche Unternehmen Clarios entwickelten.
Zweitens erwies sich das europäische Regulierungsmodell als kontraproduktiv. Während die Politik mit immer strengeren CO2-Vorgaben und faktischen Verboten von Verbrennungsmotoren operierte, fehlte es an flankierenden Maßnahmen zur Förderung der industriellen Transformation. Die Kosten für Energie sind in Deutschland deutlich höher als in den USA oder China, bürokratische Hürden erschweren Investitionen, und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge wurde zu langsam ausgebaut. Das Ergebnis ist eine Vertrauenskrise bei den Verbrauchern, die sich in schwachen Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge niederschlägt. Der erhoffte Markthochlauf der Elektromobilität blieb aus, während gleichzeitig die Produktion von profitablen Verbrennermodellen zurückgefahren wurde.
Drittens zeigt die Nexperia-Krise die Fragwürdigkeit einer Globalisierungsstrategie, die kritische Produktionsschritte in geopolitisch instabile Regionen verlagert hat. Das Packaging von Halbleitern mag in China günstiger sein, doch die Abhängigkeit von chinesischen Produktionskapazitäten macht die europäische Automobilindustrie erpressbar. Die niederländische Regierung reagierte auf amerikanischen Druck, China konterte mit einem Exportstopp, und die Leidtragenden sind deutsche Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit geschickt werden. Die Just-in-Time-Produktionsphilosophie, die Jahrzehnte als Inbegriff industrieller Effizienz galt, erweist sich in Zeiten geopolitischer Konfrontation als fatale Schwachstelle.
Viertens haben die Automobilhersteller den Kostendruck systematisch auf ihre Zulieferer abgewälzt, ohne deren Investitionsfähigkeit zu berücksichtigen. Die OEMs erzielen teilweise noch akzeptable Margen, während die Zulieferer mit 3 bis 4 Prozent operativen Margen arbeiten müssen. Diese Margen reichen nicht aus, um die notwendigen Investitionen in neue Technologien zu finanzieren. Mehr als 40 Prozent der großen Zulieferer sind inzwischen als Non-Investment-Grade eingestuft, was ihre Refinanzierungskosten erhöht und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter schwächt. Die Konsolidierungswelle, die bereits eingesetzt hat, wird sich beschleunigen. Viele mittelständische Zulieferer werden die Transformation nicht überleben.
Fünftens hat die Fixierung auf das Automobil als Technologieträger dazu geführt, dass andere Geschäftsfelder vernachlässigt wurden. Bosch reagiert darauf nun mit strategischen Portfolioentscheidungen. Der Konzern hat für acht Milliarden Euro das Klimatechnik- und Haushaltstechnikgeschäft von Johnson Controls übernommen, den größten Zukauf seiner Firmengeschichte. Das Signal ist eindeutig: Bosch will weg vom Auto und setzt stattdessen auf Wärmepumpen, Klimaanlagen und Gebäudetechnik. Mit diesen Technologien soll bis 2030 ein Umsatz von mehreren Milliarden Euro erzielt werden. Diese Diversifikation kommt jedoch reichlich spät und ändert nichts daran, dass der Mobility-Bereich weiterhin 60 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht und auf absehbare Zeit nicht profitabel sein wird.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Bosch im Umbruch — Warum Tausende Jobs auf dem Spiel stehen
Die gesellschaftspolitischen Verwerfungen
Die Dimensionen der Krise gehen weit über ökonomische Kennzahlen hinaus. In Regionen wie dem Großraum Stuttgart, dem Saarland oder Ostfriesland ist die Automobilindustrie der dominierende Arbeitgeber. Der Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen wird ganze Regionen destabilisieren. Die IG Metall spricht vom größten Personalabbau in der Geschichte von Bosch und kritisiert, dass das Unternehmen damit nicht nur das Vertrauen derjenigen verspiele, die diese Firma erfolgreich gemacht hätten, sondern auch in vielen Regionen einen sozialen Kahlschlag hinterlasse.
Besonders betroffen sind hochqualifizierte Fachkräfte. Am Standort Hildesheim sollen bis Ende 2027 insgesamt 326 Stellen wegfallen, bundesweit sind 1.500 Arbeitsplätze im Bereich Software und Fahrzeugelektronik bedroht. Diese Mitarbeiter haben oft jahrelang in ihre Ausbildung investiert und sind nun mit der Aussicht konfrontiert, dass ihre Kompetenzen nicht mehr gebraucht werden. Leon Zeller, ein Auszubildender bei Bosch in Schwäbisch Gmünd, fragt sich, ob er bald ohne Job dastehen wird. Seine Familie und er machen sich große Sorgen um die Zukunft. Die Stimmung ist am Tiefpunkt angelangt.
Die Reaktionen der Arbeitnehmervertretungen sind entsprechend vehement. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Geschäftsbereichs Mobility, Frank Sell, lehnt einen Personalabbau dieser historischen Größenordnung ohne gleichzeitige Zusagen zur Sicherung der Standorte in Deutschland entschieden ab. Statt wie vereinbart an den Standorten über Zukunftsbilder zu verhandeln, sollten nun erneut Tausende Menschen das Unternehmen verlassen. Die IG Metall fordert den weiteren Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Für die Sparte gilt ein solcher Kündigungsausschluss bis Ende 2027. Offen ist die Frage, ob Bosch den Beschäftigten Abfindungen zahlt, damit sie das Unternehmen verlassen.
Die Geschäftsführung mahnt zur Eile. Stefan Grosch betont, dass der Zeitdruck groß sei und Verzögerungen die Lage weiter verschärfen würden. Man müsse dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten und die Kosten weiter dauerhaft senken. Bedauerlicherweise komme man dabei auch nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte Maß herum. Das schmerze sehr, doch führe kein Weg daran vorbei. Diese Argumentation trifft auf Widerstand bei den Beschäftigten, die zu Recht darauf hinweisen, dass die strategischen Fehler der Vergangenheit nicht von ihnen zu verantworten sind.
Bemerkenswert ist dabei die personelle Kontinuität an der Unternehmensspitze. Trotz der massiven Stellenstreichungen wurde der Vertrag von Vorstandschef Stefan Hartung um fünf Jahre verlängert, bis 2031. Der frühere McKinsey-Manager steht seit knapp vier Jahren an der Spitze des Konzerns und soll nun den größten Umbau der Bosch-Geschichte steuern. Während Tausende Arbeitsplätze abgebaut werden, stärkt sich die Führung selbst den Rücken. Das Signal an die Belegschaft ist verheerend. Die Botschaft lautet: Die Verantwortung für die Misere tragen die Arbeitnehmer, nicht das Management.
Passend dazu:
Die geopolitische Dimension der industriellen Abhängigkeit
Die Nexperia-Krise verdeutlicht exemplarisch, wie sehr die europäische Industrie in einen Konflikt zwischen den USA und China hineingezogen wird, in dem sie eigentlich keine Partei sein sollte. Die Niederlande handelten auf Druck der USA, die Wingtech auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatten, weil das Unternehmen Chips nach Russland geliefert haben soll. China reagierte mit einem Exportstopp, der europäische Unternehmen trifft. Weder die niederländische noch die deutsche Regierung haben in diesem Konflikt eine eigenständige Position entwickelt, sondern reagieren nur auf die Vorgaben aus Washington.
Die Bundesregierung kündigte Vermittlungsversuche und zusätzliche Maßnahmen gegen den Chipmangel an, ohne konkret zu werden. Außenminister Johann Wadephul von der CDU wollte bei einem Besuch in China über die Kooperation beider Staaten sprechen, doch die Reise wurde überraschend abgesagt. Konkrete Gründe nannte das Auswärtige Amt nicht. Die politische Reaktion wirkt hilflos und konzeptionslos. Während die Produktion stillsteht und Tausende Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt werden, fehlt es an einer strategischen Antwort auf die Herausforderung.
Die Situation zeigt die grundsätzliche Problematik einer Industriepolitik, die kritische Produktionskapazitäten in geopolitisch instabile Regionen verlagert hat. Die Diskussion über Resilienz von Lieferketten wird seit der COVID-Pandemie geführt, doch konkrete Maßnahmen sind ausgeblieben. Im Gegenteil: Die Abhängigkeit von China hat sich in vielen Bereichen noch vertieft. Nexperia ist dabei nur ein Beispiel. Bei seltenen Erden, Batterierohstoffen und vielen anderen kritischen Materialien ist Europa noch stärker von chinesischen Lieferungen abhängig. Jede dieser Abhängigkeiten kann in einem geopolitischen Konflikt als Hebel eingesetzt werden.
Die Reaktionen aus China am Donnerstag, den 24. Oktober 2025, gaben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Nach Angaben von Insidern durfte die chinesische Tochter von Nexperia ihre Lieferungen an Kunden aus der Volksrepublik wieder aufnehmen. Die Bedingung der dortigen Behörden war jedoch, Geschäfte künftig ausschließlich in Yuan statt wie bisher in US-Dollar abzuwickeln. Damit sollte der China-Ableger offenbar unabhängiger vom niederländischen Mutterkonzern gemacht werden. Nexperia wollte sich zu diesem Thema nicht äußern, warnte aber vor möglichen Qualitätsproblemen bei Produkten aus dem chinesischen Werk. Die Frage, ob und wann europäische Kunden wieder beliefert werden, blieb zunächst offen.
Der niederländische Konzern sucht inzwischen nach alternativen Standorten für das Verpacken und Testen seiner außerhalb Chinas produzierten Halbleiter. Ein Nexperia-Sprecher betonte, das Unternehmen verfolge diese Pläne schon länger, die nicht in Zusammenhang mit dem aktuellen Streit stünden. Diese Aussage ist allerdings wenig glaubwürdig. Tatsächlich zeigt der Konflikt, dass die Notwendigkeit besteht, kritische Produktionsschritte nach Europa zurückzuholen. Das Advanced Packaging, bei dem mehrere Chips miteinander kombiniert oder übereinandergestapelt werden, erfordert höhere technologische Standards und ist weitgehend automatisiert. Fachleute sehen hier eine Chance für den Aufbau entsprechender Fertigungskapazitäten in Europa. Doch dies erfordert massive Investitionen und dauert Jahre.
Die chinesische Herausforderung als strukturelles Problem
Hinter der akuten Chipkrise steht die fundamentale Herausforderung, dass China in vielen Bereichen der Automobilindustrie technologisch aufgeholt oder sogar überholt hat. Auf dem größten Automobilmarkt der Welt ist bereits jetzt die Hälfte der Neuwagen elektrifiziert, und deutsche Hersteller tun sich gerade dort schwer. Der Marktanteil elektrifizierter Fahrzeuge steigt global stetig an, während der Anteil der Verbrennerfahrzeuge sinkt. Chinesische Hersteller wie BYD haben sich fest unter den absatzstärksten Herstellern weltweit verankert und überzeugen nicht nur durch Wachstum, sondern auch durch Profitabilität.
Die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer haben jahrelang den Fehler gemacht, die chinesische Konkurrenz zu unterschätzen. Man ging davon aus, dass die technologische Überlegenheit der deutschen Ingenieurskunst ausreichen würde, um die Marktführerschaft zu verteidigen. Diese Annahme hat sich als fundamental falsch erwiesen. Chinesische Hersteller produzieren nicht nur günstiger, sie sind inzwischen auch technologisch ebenbürtig oder überlegen, insbesondere in den Zukunftsfeldern Batterietechnologie, Software und autonomes Fahren. BYD hat im ersten Halbjahr 2025 seine Absatzzahlen um über 500.000 Fahrzeuge gesteigert und überzeugt mit leicht überdurchschnittlichen Gewinnmargen.
Die europäische Antwort auf diese Herausforderung bleibt halbherzig. Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge können kurzfristig helfen, Zeit zu gewinnen, lösen aber das Grundproblem nicht. Deutsche Hersteller müssen auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig bleiben, und dieser Markt wird zunehmend von lokalen Anbietern dominiert. Die Strategie, Elektrofahrzeuge in China für den chinesischen Markt zu produzieren, stößt an Grenzen, weil chinesische Wettbewerber schneller, flexibler und kostengünstiger arbeiten. Gleichzeitig fehlt es in Europa an der Infrastruktur und der Nachfrage, um die gewaltigen Produktionskapazitäten auszulasten, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden.
Besonders problematisch ist die Entwicklung bei den Zulieferern. Chinesische Zulieferer erzielen mit 5,7 Prozent deutlich höhere Margen als ihre europäischen Konkurrenten mit nur 3,6 Prozent. Sie profitieren von wachsender Nachfrage heimischer OEMs, staatlichen Anreizen und privaten Investitionen. Die europäischen Zulieferer hingegen leiden unter niedrigen Produktionsniveaus, Überkapazitäten und steigenden Arbeitskosten. Sie sind in einer Zwickmühle gefangen: Sie müssen in neue Technologien investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, können diese Investitionen aber nicht finanzieren, weil ihre Margen zu niedrig sind. Viele werden diesen Spagat nicht schaffen.
Die Zukunftsszenarien und ihre Implikationen
Die Frage ist nicht, ob die deutsche Automobilzulieferindustrie schrumpfen wird, sondern nur noch, in welchem Tempo und mit welchen Folgen. Mehrere Szenarien sind denkbar, die jeweils unterschiedliche Implikationen für Wirtschaft und Gesellschaft haben.
Im optimistischsten Szenario gelingt es den deutschen Zulieferern, sich auf profitable Nischen zu konzentrieren und durch Innovationen neue Geschäftsfelder zu erschließen. Bosch beispielsweise setzt auf By-Wire-Technologien, bei denen mechanische Verbindungen durch elektronische Steuerungen ersetzt werden. Bis 2032 soll damit ein Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro erreicht werden. Auch im Bereich der Wärmepumpen und Klimatechnik sieht Bosch erhebliches Wachstumspotenzial. Wenn diese Diversifikation gelingt, könnte der Mobilitätsbereich an Bedeutung verlieren, ohne dass das Gesamtunternehmen zusammenbricht. Die Beschäftigung würde zwar sinken, aber kontrolliert und ohne soziale Verwerfungen.
Im mittleren Szenario geht der Stellenabbau weiter, verteilt sich aber über einen längeren Zeitraum und wird sozialverträglich gestaltet. Betriebsbedingte Kündigungen werden vermieden, stattdessen setzt man auf Abfindungen, Frühverrentung und Transfergesellschaften. Die demographische Entwicklung hilft dabei, denn in den kommenden Jahren werden viele Beschäftigte altersbedingt ausscheiden. Das Arbeitsangebot in der Automobilindustrie sinkt bis 2035 aufgrund der altersbedingten Fluktuation um 6,3 Prozent. Allerdings besteht die Gefahr, dass dabei auch dringend benötigte Kompetenzen verloren gehen. Besonders in Berufen wie technische Forschung und Entwicklung, Fahrzeugbautechnik oder Maschinenbau arbeiten überdurchschnittlich viele Menschen in der Automobilindustrie. In diesen Berufen sinkt das Arbeitsangebot bis 2035, gleichzeitig nimmt die Relevanz durch die Elektrifizierung zu.
Im pessimistischsten Szenario beschleunigt sich der Niedergang der europäischen Automobilzulieferindustrie. Die Kombination aus strukturellen Problemen, geopolitischen Verwerfungen und technologischer Disruption führt zu einer Welle von Insolvenzen. Mittelständische Zulieferer, die weder die Kapitalausstattung noch das technologische Know-how für die Transformation haben, verschwinden vom Markt. Die Wertschöpfung verlagert sich nach China und in die USA, wo staatliche Industriepolitik und niedrigere Energiekosten bessere Rahmenbedingungen bieten. Deutsche Standorte werden geschlossen, die verbliebenen Produktionskapazitäten konzentrieren sich auf hochwertige Nischenprodukte. Die Zahl der Beschäftigten in der Automobilindustrie könnte bis 2035 um mehrere Hunderttausend sinken.
Die Realität wird vermutlich zwischen diesen Szenarien liegen, mit erheblichen Unterschieden zwischen den Unternehmen. Große, kapitalstarke Konzerne wie Bosch werden überleben, wenn auch deutlich verkleinert und mit anderem Produktportfolio. Mittelständische Zulieferer hingegen werden in großer Zahl verschwinden oder übernommen werden. Die Konsolidierung der Branche ist unvermeidlich und bereits in vollem Gange. Distressed M&A, also Transaktionen in Sondersituationen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Solche Übernahmen bieten die Chance, operative Kerne zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und Investoren Zugang zu Technologie, Personal und Märkten zu verschaffen.
Die politische Verantwortung und das Versagen der Industriepolitik
Die aktuelle Krise ist auch das Ergebnis jahrelangen politischen Versagens. Die Bundesregierung hat es versäumt, rechtzeitig eine kohärente Industriestrategie für die Transformation der Automobilindustrie zu entwickeln. Statt die Unternehmen bei der notwendigen Neuausrichtung zu unterstützen, wurden immer neue Regulierungen aufgelegt, die die Kosten erhöhten, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Energiekosten in Deutschland gehören zu den höchsten in der entwickelten Welt, die Bürokratiebelastung ist erdrückend, und die Genehmigungsverfahren dauern Jahre.
Gleichzeitig fehlte es an einer aktiven Förderung der Zukunftstechnologien. Während China massive staatliche Investitionen in die Batterieproduktion, die Ladeinfrastruktur und die Förderung von Elektrofahrzeugen steckte, verließ man sich in Deutschland darauf, dass der Markt es schon richten werde. Diese naive Hoffnung hat sich als Irrtum erwiesen. Die USA reagierten mit dem Inflation Reduction Act, der hunderte Milliarden Dollar in die grüne Transformation der Industrie pumpt und gezielt Anreize für die Ansiedlung von Produktionskapazitäten in den USA schafft. Europa hingegen diskutiert über Schuldenregeln und Stabilitätskriterien, während die Industrie wegbricht.
Die Reaktion der Politik auf die aktuelle Chipkrise ist bezeichnend für dieses Versagen. Anstatt eine eigenständige Position gegenüber den USA und China zu entwickeln, lässt man sich von Washington vor den Karren spannen. Die niederländische Regierung handelte auf amerikanischen Druck, ohne die Konsequenzen für die europäische Industrie zu bedenken. Die deutsche Bundesregierung kündigte Maßnahmen an, ohne konkret zu werden. Die Absage der China-Reise des Außenministers zeigt, dass man nicht einmal in der Lage ist, diplomatische Kanäle offenzuhalten. Das ist keine Industriepolitik, sondern industrielles Harakiri.
Notwendig wäre eine umfassende Strategie, die mehrere Elemente umfasst. Erstens braucht es massive Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in die Energieversorgung und die digitale Vernetzung. Die Strompreise müssen auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gesenkt werden, was nur durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Netzinfrastruktur möglich ist. Zweitens müssen die Genehmigungsverfahren drastisch beschleunigt werden. Was in China Monate dauert, zieht sich in Deutschland über Jahre hin. Diese Zeitverschwendung können wir uns nicht leisten.
Drittens braucht es eine aktive Förderung von Zukunftstechnologien. Die Batterieproduktion in Europa muss ausgebaut werden, ebenso die Halbleiterfertigung und das Advanced Packaging. Die Abhängigkeit von China bei kritischen Komponenten muss reduziert werden, auch wenn das kurzfristig höhere Kosten bedeutet. Langfristig ist diese Investition in die Resilienz der Lieferketten unverzichtbar. Viertens muss die Transformation sozialverträglich gestaltet werden. Die Beschäftigten, die jahrelang zum Erfolg der deutschen Automobilindustrie beigetragen haben, dürfen nicht zum Spielball geopolitischer Machtspiele werden. Qualifizierungsmaßnahmen, Transfergesellschaften und soziale Absicherung sind notwendig, um den Übergang zu erleichtern.
Fünftens braucht es eine europäische Koordination. Die Automobilindustrie ist keine nationale Angelegenheit mehr. Deutsche Zulieferer beliefern französische und italienische Hersteller, tschechische Fabriken produzieren für den deutschen Markt. Die Wertschöpfungsketten sind europäisch, und die Antwort auf die Herausforderungen muss es auch sein. Ein europäisches Industrieprogramm nach dem Vorbild des Inflation Reduction Act in den USA wäre notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu erhalten. Die Diskussion über die Schuldenbremse und Stabilitätskriterien muss hinter das Ziel der Erhaltung der industriellen Basis zurücktreten.
Die unausweichliche Neuerfindung des deutschen Industriemodells
Die Krise bei Bosch ist symptomatisch für eine tiefgreifende Strukturkrise des deutschen Industriemodells. Das Erfolgsrezept der Vergangenheit, hochwertige Produkte für den Weltmarkt zu produzieren, funktioniert in einer Welt nicht mehr, in der chinesische Konkurrenten technologisch aufgeholt haben und mit deutlich niedrigeren Kosten arbeiten. Die Vorstellung, dass deutsche Ingenieurskunst und Qualität ausreichen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen, ist überholt. Die Zukunft der deutschen Industrie liegt nicht in der Verteidigung des Status quo, sondern in der Neuerfindung.
Diese Neuerfindung erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen. Unternehmen müssen bereit sein, ihre Geschäftsmodelle radikal zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Bosch zeigt mit dem Einstieg in die Klimatechnik und die Diversifikation weg vom Auto, wie das aussehen kann. Doch diese Transformation darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Die Arbeitnehmer haben jahrzehntelang zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und verdienen Respekt und soziale Absicherung.
Die Politik muss endlich eine Industriestrategie entwickeln, die diesen Namen verdient. Das bedeutet nicht nur, Regulierungen abzubauen, sondern auch aktiv in Infrastruktur, Bildung und Forschung zu investieren. Es bedeutet, die Energiewende konsequent voranzutreiben, um wettbewerbsfähige Strompreise zu ermöglichen. Es bedeutet, die Abhängigkeit von autoritären Regimen bei kritischen Rohstoffen und Komponenten zu reduzieren. Und es bedeutet, die europäische Zusammenarbeit zu stärken, statt nationale Alleingänge zu verfolgen.
Die Gesellschaft muss sich darauf einstellen, dass der Wandel schmerzhaft sein wird. Ganze Regionen werden ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt neu definieren müssen. Baden-Württemberg, das sich stolz als Autoland bezeichnet, wird sich als Gesundheitsstandort neu erfinden müssen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont. Diese Transformation erfordert nicht nur ökonomische Anpassungen, sondern auch ein neues Selbstverständnis. Die Zeiten, in denen jeder Baden-Württemberger nachts geweckt werden konnte und sofort wusste, dass Fahrzeugbau, Maschinenbau und Anlagenbau die bedeutendsten Industrien sind, gehen zu Ende.
Die Herausforderung ist immens, aber nicht unlösbar. Deutschland verfügt über eine hoch qualifizierte Arbeitnehmerschaft, exzellente Forschungseinrichtungen und eine starke industrielle Basis. Die Innovationskraft ist vorhanden, ebenso das technologische Know-how. Was fehlt, ist der politische Wille, die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen, und die gesellschaftliche Bereitschaft, den Wandel aktiv zu gestalten statt ihn passiv zu erleiden. Die Alternative zu einer gestalteten Transformation ist der unkontrollierte Niedergang. Die Wahl liegt bei uns.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten