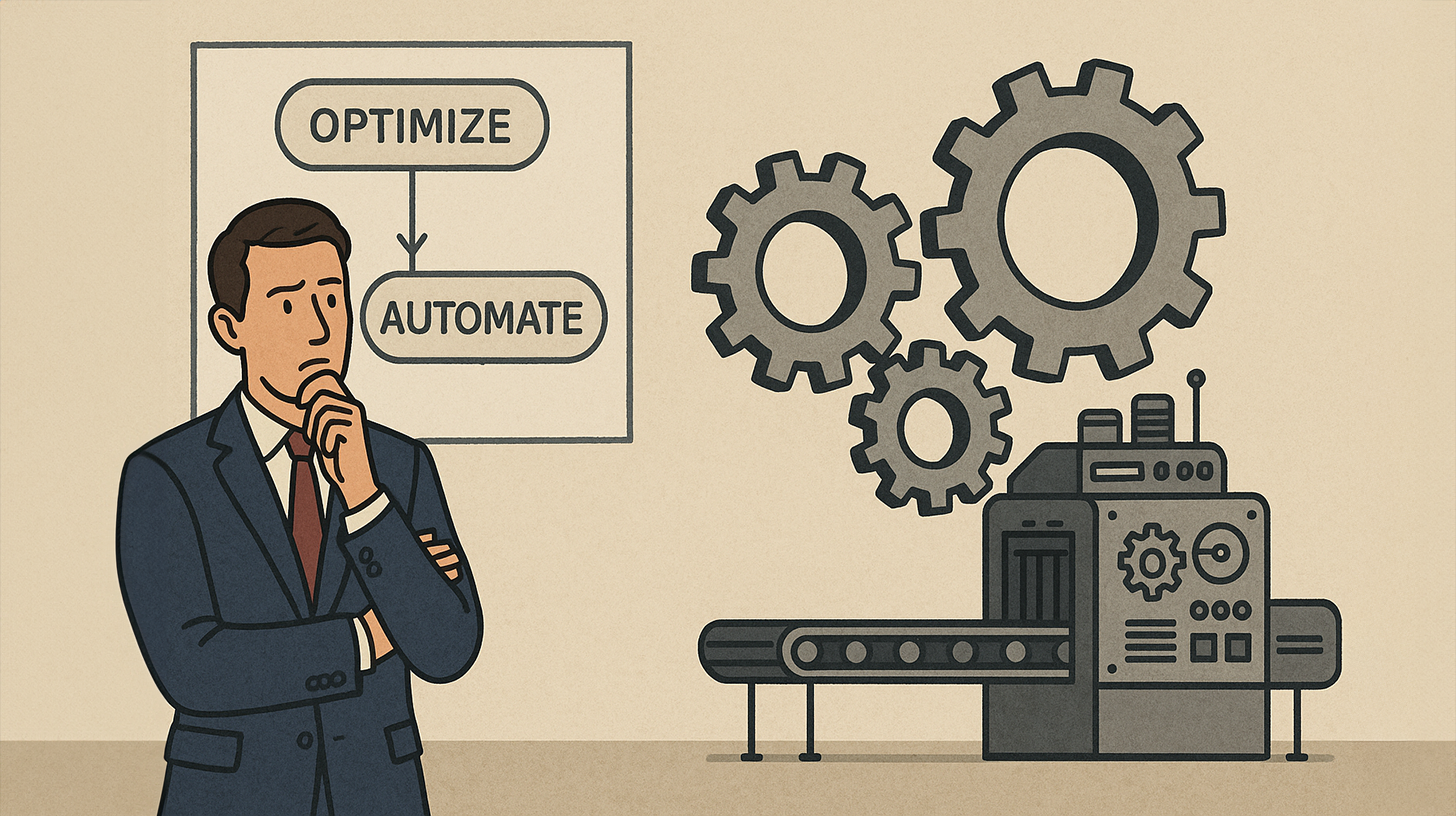
Der größte Denkfehler deutscher Manager: Warum „erst optimieren, dann automatisieren“ Ihr Unternehmen lähmt – Bild: Xpert.Digital
Warten Sie auf den perfekten Prozess? Dieser Fehler kostet Sie mehr, als Sie denken
Automatisierung: Die Wahrheit, die viele Unternehmen ignorieren – und was wirklich funktioniert
Ein Leitsatz, der in der deutschen Geschäftswelt wie ein unumstößliches Gesetz wirkt: „Erst den Prozess optimieren, dann die Technik einsetzen.“ Diese scheinbar logische und risikoscheue Herangehensweise dominiert Diskussionen über die Digitalisierung und wird oft als Mantra für eine solide Unternehmensführung gepriesen. Doch diese sequenzielle Denkweise ist nicht nur veraltet – sie entwickelt sich zunehmend zu einer der größten Bremsen für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im digitalen Zeitalter. Sie basiert auf einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie moderne Automatisierung funktioniert und was sie bewirkt.
Dieser Artikel legt dar, warum die strikte Trennung von Prozessoptimierung und Automatisierung eine falsche Zweiteilung ist. Wir zeigen, dass das Warten auf den „perfekten“ manuellen Prozess Unternehmen in eine Statik-Falle lockt, die wertvolle Zeit kostet, den Return on Investment (ROI) verzögert, den Fachkräftemangel verschärft und massive technische Schulden aufbaut. Anstatt einer starren Abfolge plädieren wir für einen parallelen Ansatz, bei dem Prozessverbesserung und die Planung der Automatisierbarkeit von Anfang an Hand in Hand gehen. Anhand von Prinzipien wie dem Simultaneous Engineering, modernen Methoden wie Process Mining und agilen Vorgehensweisen wird deutlich: Wirkliche Effizienz und Zukunftsfähigkeit entstehen nicht durch Warten, sondern durch das intelligente und gleichzeitige Denken in Prozessen und Systemen. Es ist Zeit für ein neues Mantra in der digitalen Transformation.
Manchmal braucht es einen klaren Impuls, um ein festgefahrenes Denkmuster infrage zu stellen. Dieser kam kürzlich in Form eines LinkedIn-Beitrags von Marco Gebhardt, Geschäftsführer der GEBHARDT Intralogistics Group GmbH. Seine offene Frustration, zusammengefasst in dem Satz „Ich kann’s bald nicht mehr lesen: ‚Du musst erstmal deine Prozesse in den Griff bekommen, bevor du automatisierst.‘“, war der Auslöser für diesen Artikel. Diese Aussage legt den Finger in die Wunde eines der größten Mythen der digitalen Transformation und ist der perfekte Startpunkt, um zu beleuchten, warum dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß ist.
Mehr dazu hier:
Prozessoptimierung und Automatisierung in Parallelität: Die falsche Zweiteilung in der deutschen Geschäftskultur
Warum das sequenzielle Denken Unternehmen ausbremst – und was tatsächlich funktioniert
Die Debatte um die Reihenfolge von Prozessoptimierung und Automatisierung wird in deutschsprachigen Fachkreisen derzeit intensiv geführt. Ein Axiom dominiert dabei die LinkedIn-Diskurse: Erst müssen die manuellen Prozesse perfekt laufen, dann erst kommt die Technik. Dieses Mantra wirkt intuitiv richtig, bestechend logisch und wirtschaftlich konservativ. Es ist auch nicht völlig falsch. Doch eine tiefere Analyse offenbart, dass diese Herangehensweise zu einem fundamentalen Missverständnis über die Natur von Automatisierungsprojekten führt und Unternehmen systematisch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit einbremst.
Die Statik-Falle: Wenn Prozesse als unveränderlich gedacht werden
Die zentrale Problematik liegt darin, dass dieser Ansatz die Geschäftstätigkeit als statische Größe behandelt. Er geht davon aus, dass ein Prozess einen optimalen Zustand erreichen kann, der dann technisch repliziert werden kann. Dies entspricht jedoch nicht der Realität moderner Produktions- und Büroprozesse. Vielmehr zeigt sich in praktischen Implementierungen, dass sich Prozesse durch die Einführung von Automatisierungstechnik grundlegend verändern. Was heute manuell ideal funktioniert, passt morgen nicht mehr in das automatisierte System, weil Automatisierung ihre eigenen Logiken, Anforderungen und Zwänge mit sich bringt.
Die Forschungsergebnisse aus der europäischen Automatisierungsindustrie unterstreichen diese Dynamik. Nach Analysen des Werkzeugbaus zeigt sich, dass knapp zwei Drittel aller befragten Unternehmen die Prozessstabilität als eines der größten Implementierungshindernisse angeben. Allerdings wird hier schnell klar: Diese Stabilität ist nicht etwas, das ein Prozess einfach hat oder nicht hat. Sie ist ein graduelles Konzept, das durch kontinuierliche Anpassung erreicht wird. Siebzig Prozent der Unternehmen in derselben Studie gaben an, dass Bauteil- und Prozessstandardisierung nicht so weit fortgeschritten waren, um eine durchgehende Automatisierung zu ermöglichen. Der logische Fehlschluss wäre, nun zu sagen: Dann optimiert zuerst manuell. Der realistische Befund lautet aber: Die Standardisierung ist oft selbst ein Ergebnis des Automatisierungsprozesses, nicht dessen Vorbedingung.
Passend dazu:
Parallel statt sequenziell: Der Schlüssel zur echten Automatisierbarkeit
Dies wird besonders deutlich bei der Betrachtung des sogenannten Simultaneous Engineering Prinzips, das in modernen Organisationen zur Standard-Best-Practice geworden ist. Dieses Konzept besagt, dass alle am Prozess beteiligten Personen nicht sequenziell, sondern parallel an einem Ergebnis arbeiten. Angewandt auf die Frage von Prozessoptimierung und Automatisierung bedeutet dies: Teams arbeiten gleichzeitig an der manuellen Verbesserung des Prozesses und denken parallel darüber nach, wie dieser Prozess automatisiert werden könnte. Diese parallele Perspektive führt zu fundamentaleren Optimierungen, weil sie Prozessschritte nicht nur auf ihre aktuelle Effizienz optimiert, sondern auf ihre Automatisierbarkeit. Das ist ein qualitativ anderer Ansatz.
Die deutsche Geschäftskultur hat eine ausgeprägte Neigung, Probleme in Phasen zu zerlegen. Dies ist nicht unwirksam – historisch hat der phasenartige Ansatz zu großen Erfolgen in der deutschen Ingenieurwissenschaft und Fertigung geführt. Doch in der modernen Digitalisierung wirkt dieser Ansatz kontraproduktiv. Eine empirische Studie der Bitkom offenbarte, dass 45 Prozent der Unternehmen die Umstellung vorhandener Systeme und Prozesse als zentrale Herausforderung der Digitalisierung bezeichnen – besonders häufig bei größeren Unternehmen mit über tausend Mitarbeitern, wo dieser Wert auf 66 Prozent anstieg. Dies ist nicht zufällig. Je länger man an einem sequenziellen Modell festhält, desto größer wird die Kluft zwischen dem optimierten Zustand und den Anforderungen der Automatisierung.
Passend dazu:
Die versteckten Kosten des Wartens: ROI, Fachkräftemangel und technische Schulden
Das ROI-Problem verschärft sich noch, wenn man die Realität von Automatisierungsprojekten betrachtet. Ein typisches Szenario: Ein Unternehmen investiert fünfzigtausend Euro in eine Automatisierungslösung für die Rechnungsverarbeitung. Die Reduzierung des manuellen Aufwands führt zu jährlichen Einsparungen von vierzigtausend Euro. Der ROI liegt damit bei minus zwanzig Prozent im ersten Jahr. Dies ist kein Scheitern der Automatisierung, sondern eine typische Kurve. Im zweiten Jahr amortisiert sich die Investition vollständig. Im dritten Jahr beginnt die Lösung profitabel zu werden. Unternehmen, die zu lange auf die “perfekte” manuelle Phase warten, verlieren diese wertvollen Jahre der Amortisierung.
Noch kritischer wird es bei der Betrachtung des Fachkräftemangels. Der Mangel an IT- und Digitalisierungsspezialisten ist nach aktuellen Erhebungen ein limitierender Faktor für Automatisierungsprojekte. Eine Studie von Deloitte zeigt, dass Unternehmen, die auf Automatisierung setzen, im Durchschnitt eine zwanzig Prozent höhere Produktivität und eine fünfzehn Prozent geringere Kostenbasis aufweisen. Doch diese Unternehmen haben typischerweise nicht auf die “perfekte” manuelle Phase gewartet. Sie haben früh angefangen, parallele Strukturen aufzubauen. Dies schafft auch die Grundlage für ein tieferes Verständnis zwischen IT und Fachabteilungen, was wiederum die Erfolgsquote von Automatisierungsprojekten deutlich erhöht.
Die technischen Schulden, die durch zu lange sequenzielle Planung entstehen, sind ebenfalls ein wesentlicher Aspekt. Wenn ein Unternehmen wartet, bis alles manuell perfekt läuft, laufen technische Systeme, Datenbanken und Softwarekomponenten in dieser Zeit weiter. Sie veraltern, sie sammeln Inkonsistenzen an, sie entwickeln “Schulden” in Form von nicht aktualisiertem Code, veralteter Hardware und suboptimalen Datenbankstrukturen. Die Belastung, diese Schulden später neben der Automatisierungsimplementierung zu tilgen, wird exponentiell größer. Eine Studie zum Umgang mit technischen Schulden in Großunternehmen zeigt, dass die Rückzahlung von Schulden ein kontinuierlicher Prozess sein muss, bei dem Vermeidung, Identifikation, Messung, Priorisierung und Überwachung parallel erfolgen. Ein rein sequenzieller Ansatz führt dazu, dass technische Schulden sich so sehr ansammeln, dass sie später die Automatisierung selbst behindern.
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Parallel statt sequenziell: Process Mining als Turbo der Automatisierung – Agil, Lean, Kaizen und wie Parallelität Prozesse schneller verbessert
Von Process Mining bis Agile: Wie moderne Methoden Parallelität erzwingen
Das Process Mining bietet hier einen völlig neuen Ansatz. Diese Technologie rekonstruiert Ist-Prozesse aus Ausführungsdaten und macht Ineffizienzen sichtbar. Besonders wertvoll ist dabei die Priorisierung: Process Mining kann objektiv bestimmen, welche Prozessveränderungen den größten ROI bringen. Eine Studie zur Erfolgsmessung durch Process Mining zeigt vier zentrale Erfolgsfaktoren: Prozessaufnahme und -analyse rekonstruieren IST-Prozesse visuell, Prozessharmonisierung und -optimierung standardisieren ähnliche Prozesse, die Auswahl von Automatisierungsprozessen folgt dem ROI-Kriterium mit Fokus auf Standardprozesse mit hohem Volumen, und das Monitoring während des Betriebs misst kontinuierlich die Prozessperformance.
Diese systematische Herangehensweise kann nicht warten, bis alle Prozesse manuell optimiert sind. Sie muss parallel ablaufen. Denn Process Mining funktioniert nur mit echten Daten aus echten Prozessen. Man kann Process Mining nicht auf einem optimierten Prozess anwenden, der nie in der Praxis lief, sondern nur auf einem Prozess, der existiert und Daten produziert.
Die Herausforderungen bei der Implementierung sind ebenfalls ein Aspekt, der für parallele Ansätze spricht. Eine CGI-Marktstudie ergab, dass Change Management, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT, die Integration in die bestehende Systemlandschaft, agile Implementierungsmethoden und Mitarbeiterschulungen die fünf Erfolgsfaktoren für Automatisierungsprojekte sind. Diese Faktoren funktionieren deutlich besser, wenn parallele Ansätze verwendet werden. Wenn das Fachbereich und IT gemeinsam an der Lösung arbeiten, entwickelt sich automatisch eine bessere gegenseitige Verständigung. Change Management funktioniert besser, wenn Mitarbeitende verstehen, warum ein Prozess gerade so optimiert wird – weil sie sehen, dass dies speziell dazu dient, ihn automatisierbar zu machen.
Die statistischen Fehlerquoten bei Automatisierungsprojekten sind ebenfalls aufschlussreich. Eine häufigste Fehlerquelle ist die falsche Auswahl von Automatisierungsprozessen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die richtige Auswahl von Prozessen ist essentiell für den Erfolg. Diese richtige Auswahl kann aber nicht von außen durch Berater erfolgen, die zuerst warten, bis alles manuell optimal läuft. Sie kann nur durch ein gemeinsames, paralleles Verständnis erfolgen, bei dem Techniker und Fachexperten zusammen begreifen, welche Prozesse welche Kandidaten für Automatisierung sind.
Es zeigt sich auch bei der Betrachtung agiler Methoden in der Softwareentwicklung, dass das Parallel-Modell dem Wasser-Modell überlegen ist. Die agile Transformation mit DevOps-Pipelines zeigt, dass durch die Kapselung von Produkten in Microservices und Container schnelles, paralleles und ressourcenschonendes Deployment möglich ist. Dadurch kann parallel und daher schneller automatisiert getestet werden, was die Lead Time signifikant reduziert. Dies ist kein neues Phänomen, sondern ein bewährtes Prinzip, das zeigt, dass Parallelität effizienter ist als Sequenzialität – auch in komplexen technischen Umgebungen.
Das Lean Management Konzept, das in der deutschen Industrie tief verwurzelt ist, unterstützt diesen parallelen Ansatz auch. Lean Management basiert auf kontinuierlicher Verbesserung und der Minimierung von Verschwendung. Wenn man aber wartet, bis ein Prozess manuell perfekt ist, verschwendet man Zeit – eine der wertvollsten Ressourcen. Die Kombination von Lean Management mit Industrie 4.0 Technologien ermöglicht eine noch präzisere Überwachung und Steuerung von Fertigungsprozessen. Diese Kombination funktioniert aber nur, wenn beide Seiten – die Lean-Expertise und die technologische Planung – parallel entwickelt werden.
Passend dazu:
- Die Achillesferse der Produktionsdigitalisierung: Warum zwei Jahrzehnte Industrie 4.0 an der Realität gescheitert sind
Mehr als nur Technik: Mensch, Kultur und kontinuierliche Verbesserung
Ein oft übersehener Aspekt ist auch die psychologische Dimension. Die Aussage “erst Prozesse, dann Technik” ist nicht nur eine strategische Aussage. Sie ist auch beruhigend. Sie bedeutet für viele Mitarbeitende und Führungskräfte, dass man jetzt noch nichts zu tun braucht, dass man noch Zeit hat. Automatisierungsgegner in Unternehmen nutzen dieses Mantra gerne, um Projekte zu bremsen. Dies ist verständlich, aber wirtschaftlich fatal. McKinsey zeigt, dass Unternehmen, die Automatisierung früh und parallel mit Prozessoptimierung vorantreiben, im Durchschnitt zu den Gewinnern in ihrem Markt gehören.
Die hybride Integration ist ein Begriff, der in der modernen Systemarchitektur an Bedeutung gewonnen hat. Das Konzept besagt, dass Unternehmen schrittweise modernisieren können, ohne bestehende Systeme abrupt zu ersetzen. Ein praktisches Beispiel: Die Integration einer SAP-Lösung mit einer Cloud-basierten Applikation. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es, parallel zu modernisieren, ohne dass es Auswirkungen auf den Bestandsbetrieb gibt. Die Neuentwicklung erfolgt parallel zum laufenden Betrieb und ermöglicht Tests, ohne dass es Verfügbarkeitsprobleme gibt. Beide Lösungen können von Benutzern aktiv ausgewählt werden, bis die neue Lösung die alte vollständig ersetzt. Dies ist ein Beweis dafür, dass Evolution, nicht Revolution, der richtige Weg ist – aber eine Evolution, die parallel läuft, nicht sequenziell.
Die Implementierungshindernisse, die in Studien genannt werden, sind nicht zwingend Argumente gegen Parallelität. Ein mangendes Prozessverständnis wird von knapp einem Drittel der Unternehmen genannt. Aber gerade diese Unternehmen könnten von parallelen Ansätzen profitieren, weil die intensive Auseinandersetzung mit Automatisierungstechnologie ein tieferes Prozessverständnis fördert. Die Diskussionen zwischen IT und Fachbereich über “wie würden wir diesen Schritt automatisieren?” führen zu einem intensiveren Verständnis des Prozesses als eine rein analytische Phase.
Die kontinuierliche Verbesserung ist ein weiteres Konzept, das für Parallelität spricht. Nach der Implementierung eines Automatisierungsprojekts beginnt typischerweise eine Phase, in der man monitoring durchführt, erkannte Ineffizienzen behebt und den Prozess weiter optimiert. Diese Phase wird viel effektiver, wenn sie nicht völlig getrennt von der initialen Optimierungsphase ist. Wenn Teams bereits verstanden haben, wie Prozesse automatisierbar sind, können sie kontinuierliche Verbesserungen schneller und zielsicherer umsetzen.
Das Kaizen-Prinzip, das kontinuierliche Verbesserung bedeutet, wird oft missverstanden als ein sehr langsamer Prozess. Tatsächlich bedeutet Kaizen aber, dass alle Beteiligten ständig nach Verbesserungen suchen und diese umsetzen. Dies funktioniert hervorragend mit parallel verlaufenden Automatisierungsinitiativen. Die Kombination schafft eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, die nicht auf die “perfekte” manuelle Phase wartet, sondern diese während der Automatisierungsimplementierung erreicht.
Die Anforderungen an Change Management sind in Automatisierungsprojekten bekanntermaßen hoch. Ein Automatisierungsprojekt ist eine organisatorische Veränderung, keine primär technische. Widerstände bei Mitarbeitern sind normal und menschlich. Die Lösung liegt in transparenter Kommunikation, die regelmäßig über Ziele, Potenziale, Auswirkungen und Status berichtet. Doch diese Kommunikation funktioniert besser, wenn sie parallel erfolgt. Wenn Mitarbeitende von Anfang an sehen, dass ihre Expertise in die Gestaltung von Automatisierungslösungen fließt, entsteht eher Vertrauen und Akzeptanz als wenn sie erst beobachten müssen, wie ein Prozess “perfekt” optimiert wird, um dann “von außen” automatisiert zu werden.
Eine weitere kritische Beobachtung: Unternehmen, die zu lange auf die perfekte manuelle Phase warten, verpassen oft die Fenster für technologische Investitionen. Förderungen, Subventionen und steuerliche Incentives für Digitalisierung sind zeitlich begrenzt. Eine Wartekultur führt dazu, dass diese Fenster verpasst werden. Agile Unternehmen nutzen solche Fenster, weil sie bereits parallel denken und schneller handeln können.
Passend dazu:
Ein neues Mantra für die digitale Transformation
Das Fazit aus all diesen Perspektiven ist klar: Die klassische Aussage “erst Prozesse, dann Technik” ist wirtschaftlich und strategisch überholt. Sie war vielleicht angemessen in einer Industrie 2.0 oder 3.0 Welt, wo Veränderungen langsamer waren und wo große Investitionen in einzelne Systeme lange Lebensdauern hatten. In der heutigen Industrie 4.0 Realität, wo Flexibilität, Schnelligkeit und kontinuierliche Anpassung entscheidend sind, ist dies aber kontraproduktiv.
Das richtige Mantra lautet: Prozesse verstehen ist Pflicht. Automatisierungen denken ist nicht nur Kür, sondern ist notwendig, um Prozesse wirklich zu verstehen. Fortschritt passiert, wenn man beides zusammenbringt. Dies bedeutet nicht, dass man schlecht durchdachte Automatisierungen umsetzt. Es bedeutet, dass man bei der Prozessoptimierung immer auch die Automatisierungsperspektive mitnimmt. Es bedeutet, dass Prozessanalytiker und IT-Architekten von Anfang an gemeinsam arbeiten. Es bedeutet, dass Unternehmen nicht auf die unendliche manuelle Perfektionierung warten, sondern früh mit kleinen, iterativen Automatisierungsschritten beginnen.
Unternehmen, die dies verstehen und praktizieren, werden in ihrer Branche zu den Gewinnern gehören. Diejenigen, die weiterhin sequenziell denken, werden den Anschluss verlieren.
Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung
Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:

