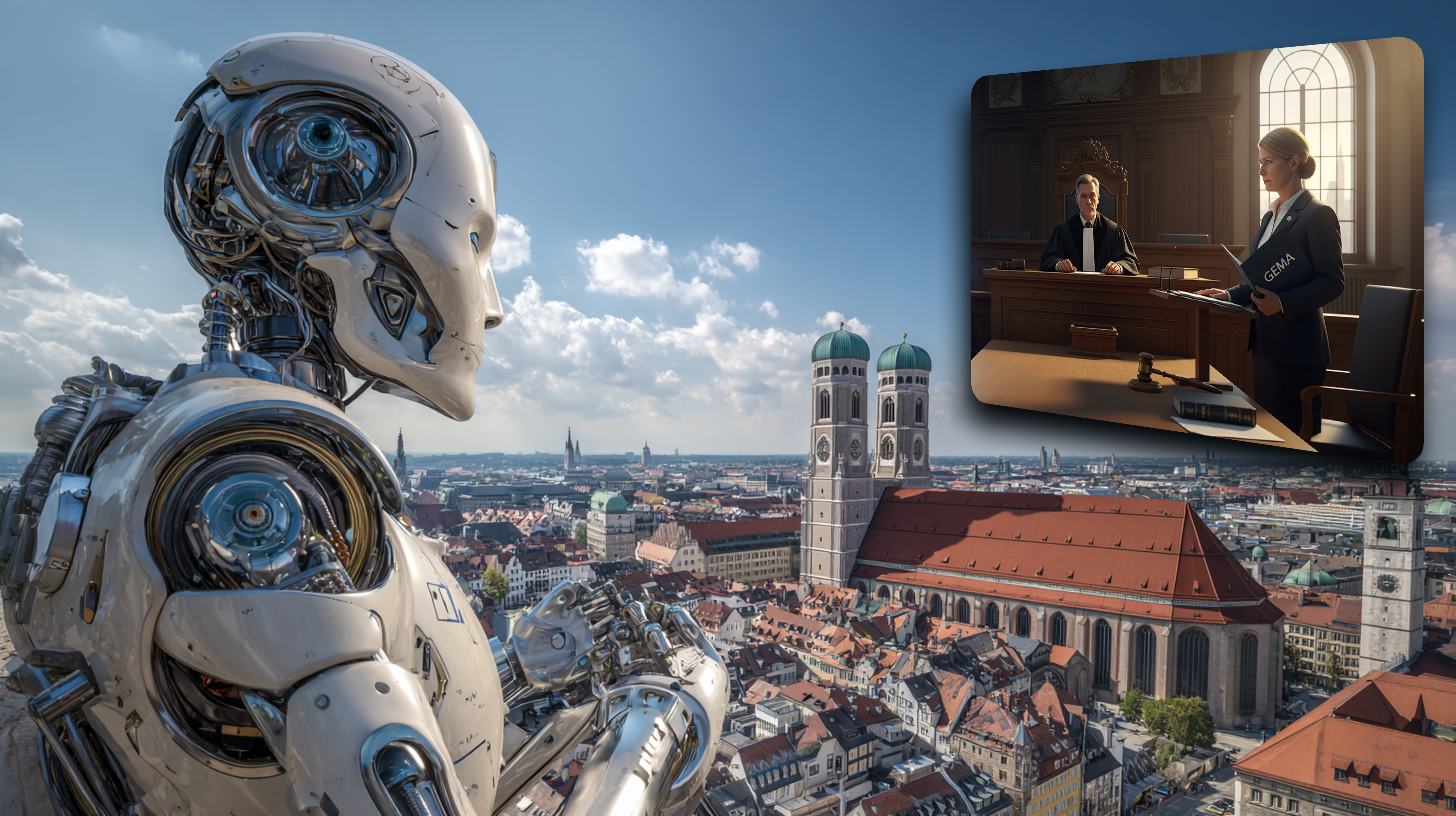
KI vor Gericht: GEMA gewinnt in München historischen Prozess gegen ChatGPT von OpenAI – Bild: Xpert.Digital
Milliarden-Gewinne auf Kosten der Kunst: Das Urteil aus München, das die KI-Branche erschüttert
Mehr als nur gelernt: Warum ChatGPTs „Gedächtnis“ für OpenAI jetzt zum Problem wird
Ein deutsches Gericht hat gesprochen, und das Echo hallt von den Kreativstudios Europas bis in die Chefetagen des Silicon Valley: Im wegweisenden Fall GEMA gegen OpenAI hat das Landgericht München entschieden, dass ChatGPT die Urheberrechte deutscher Musikschaffender verletzt hat. Im Zentrum des Verfahrens standen neun ikonische deutsche Liedtexte, von Helene Fischers „Atemlos“ bis zu Reinhard Meys „Über den Wolken“, die der Chatbot auf Anfrage wortwörtlich wiedergeben konnte. Dieses Urteil ist weit mehr als ein juristischer Sieg für die rund 100.000 von der GEMA vertretenen Künstler; es ist ein Paukenschlag im Ringen um die Würde und den Wert kreativer Arbeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
Der Konflikt legt die ökonomische Logik einer neuen digitalen Enteignung offen: Auf der einen Seite stehen KI-Konzerne wie OpenAI, die mit Bewertungen von hunderten Milliarden Dollar und rasant wachsenden Umsätzen gigantische Werte schaffen. Ihr Geschäftsmodell basiert maßgeblich auf einem Rohstoff, für den sie bisher nicht bezahlt haben: dem gesammelten Wissen und der Kreativität der Menschheit, die sie als Trainingsdaten nutzen. Auf der anderen Seite stehen Künstler, Musiker und Autoren, die durch KI-generierte Inhalte massive Einnahmeverluste und den Verlust ihrer Lebensgrundlage fürchten.
Das Münchner Urteil rückt dabei eine zentrale technische und rechtliche Frage in den Fokus: Was passiert genau im „Gehirn“ einer KI? Während OpenAI argumentiert, seine Modelle würden nur abstrakte Muster lernen, belegt das Gericht die sogenannte „Memorisierung“ – die Fähigkeit der KI, urheberrechtlich geschützte Werke exakt zu speichern und zu reproduzieren. Damit wird die Argumentation der Tech-Giganten erschüttert und die Tür für eine grundlegende Neuverhandlung der Spielregeln geöffnet. Die Entscheidung aus München ist somit der Auftakt zu einer globalen Auseinandersetzung, die definieren wird, ob menschliche Kreativität auch in Zukunft fair entlohnt wird oder zum kostenlosen Treibstoff für die nächste industrielle Revolution verkommt.
Der Kampf um das geistige Eigentum im Zeitalter künstlicher Intelligenz
Wenn Algorithmen zu Trittbrettfahrern werden: Die ökonomische Enteignung der Kreativwirtschaft durch generative KI-Systeme
Das am elften November 2025 vom Landgericht München verkündete Urteil im Fall GEMA gegen OpenAI markiert einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung um die ökonomische Verwertung kreativer Arbeit im digitalen Zeitalter. Die Entscheidung zugunsten der Verwertungsgesellschaft stellt fest, dass der Betreiber von ChatGPT bei der Nutzung von neun bekannten deutschen Liedtexten Urheberrechte verletzt hat. Damit wird erstmals in Europa höchstrichterlich bestätigt, was Künstler und Rechteinhaber seit Jahren vorbringen: Die milliardenschweren Technologiekonzerne des Silicon Valley betreiben eine systematische Aneignung kreativer Leistungen, ohne jene zu vergüten, deren Arbeit den eigentlichen Rohstoff ihrer Geschäftsmodelle bildet. Dieses Urteil ist jedoch weit mehr als eine juristische Einzelfallentscheidung. Es offenbart die fundamentalen Spannungen einer Wirtschaftsordnung, in der die digitale Aneignung menschlicher Kreativität zum Kernmechanismus neuer Akkumulationsstrategien geworden ist.
Die ökonomischen Dimensionen dieses Konflikts sind beachtlich. OpenAI, das im Jahr 2024 bereits Umsätze von 3,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und für 2025 einen annualisierten Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar prognostiziert, baut seinen Erfolg auf der kostenlosen Nutzung von Millionen urheberrechtlich geschützter Werke auf. Diese Werke wurden ohne Genehmigung oder Vergütung zum Training des Sprachmodells verwendet, das heute von über 700 Millionen Menschen wöchentlich genutzt wird. Die Bewertung des Unternehmens erreichte im Oktober 2025 astronomische 500 Milliarden US-Dollar. Diesen enormen Wertschöpfungen stehen Kreative gegenüber, die zunehmend unter Druck geraten: Studien prognostizieren für Musikschaffende Einnahmeverluste von bis zu 27 Prozent durch KI-generierte Inhalte, in der Synchronbranche drohen Einbußen von bis zu 56 Prozent. Der wirtschaftliche Erfolg der KI-Unternehmen korreliert direkt mit dem befürchteten Niedergang traditioneller Kreativberufe.
Die juristische Zäsur und ihre Vorgeschichte
Das Münchner Urteil steht am Ende einer juristischen Auseinandersetzung, die im November 2024 mit der Klageerhebung durch die GEMA begann. Im Zentrum stehen neun Liedtexte prominenter deutscher Künstler, darunter Helene Fischers Atemlos, Herbert Grönemeyers Männer, Reinhard Meys Über den Wolken und Rolf Zuckowskis In der Weihnachtsbäckerei. Die GEMA, die in Deutschland rund 100.000 Musikschaffende vertritt, konnte nachweisen, dass ChatGPT auf einfache Anfragen hin diese Texte exakt oder weitgehend identisch wiedergab. Dieser Befund wurde als Beweis gewertet, dass die Texte nicht nur zum Training des Modells verwendet wurden, sondern in einer Weise im System gespeichert oder memorisiert blieben, die eine fortgesetzte Vervielfältigung darstellt.
Der rechtliche Kern des Verfahrens dreht sich um die Auslegung der 2021 in deutsches Recht übernommenen EU-Richtlinie zum Text und Data Mining. Der Paragraf 44b des Urheberrechtsgesetzes erlaubt grundsätzlich die automatisierte Analyse von Werken, sofern diese rechtmäßig zugänglich sind. Diese Schrankenregelung sollte Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz fördern, ohne dass Entwickler für jeden einzelnen Datensatz Lizenzen erwerben müssen. Allerdings sieht Absatz drei des Paragrafen vor, dass Rechteinhaber der Nutzung widersprechen können. Bei online verfügbaren Werken muss dieser Vorbehalt in maschinenlesbarer Form erfolgen. Die GEMA hatte einen solchen Vorbehalt erklärt, dessen Wirksamkeit OpenAI jedoch bestritt.
Die juristische Komplexität liegt in der Abgrenzung zwischen dem Training eines Modells und der anschließenden Nutzung. Während das Landgericht Hamburg im September 2024 in einem Verfahren um Fotografien entschied, dass die Erstellung von Trainingsdatensätzen unter bestimmten Bedingungen zulässig sein kann, fokussierte sich das Münchner Gericht auf die Ausgabe der Texte durch ChatGPT. OpenAI argumentierte, dass das Modell keine Daten speichere, sondern lediglich reflektiere, was es aus dem gesamten Trainingsdatensatz erlernt habe. Die Ausgaben würden durch eine sequenziell-analytische, iterativ-probabilistische Synthese erzeugt, nicht durch das Abrufen gespeicherter Inhalte. Die GEMA hingegen verwies auf technische Studien, die zeigen, dass große Sprachmodelle durchaus Trainingsdaten memorisieren können, insbesondere wenn diese häufig im Datensatz vorkommen.
Die Richterin Elke Schwager deutete bereits in der mündlichen Verhandlung im September 2025 an, in praktisch allen zentralen Punkten eher den Argumenten der GEMA zu folgen. Das nun verkündete Urteil bestätigt diese Einschätzung und stellt fest, dass sowohl das Training mit den geschützten Werken als auch deren Wiedergabe durch den Chatbot urheberrechtliche Ansprüche verletzt. Die Entscheidung hat unmittelbar keine verpflichtenden Rechtsfolgen, da mit einer Berufung zu rechnen ist. Sie sendet jedoch ein klares Signal: In Europa müssen KI-Anbieter Lizenzen erwerben, wenn sie urheberrechtlich geschützte Werke nutzen wollen.
Die ökonomische Logik der digitalen Aneignung
Um die Tragweite des Münchner Urteils zu erfassen, muss man die ökonomischen Mechanismen verstehen, die den Aufstieg der KI-Giganten ermöglicht haben. OpenAI operiert in einer Wirtschaftsstruktur, die der Ökonom Philipp Staab als Plattformkapitalismus beschrieben hat. Anders als im klassischen Industriekapitalismus, wo Wertschöpfung primär durch die Transformation physischer Güter erfolgt, basiert die Plattformökonomie auf der Kontrolle von Datenflüssen und Zugangsrechten. Plattformen wie OpenAI schaffen proprietäre Märkte, sie sind selbst der Markt. Ihre Macht beruht nicht auf der Produktion von Gütern, sondern auf der Kapitalisierung eigentlich unknapper Ressourcen.
Im Fall von ChatGPT ist diese unknappe Ressource das im Internet frei verfügbare kulturelle und informationelle Material. Durch Web-Crawling und systematisches Auslesen öffentlich zugänglicher Inhalte haben OpenAI und vergleichbare Unternehmen Trainingsdatensätze von einem Umfang zusammengetragen, der jede historische Dimension sprengt. Das Modell GPT-3 wurde mit etwa 560 Gigabyte Textdaten trainiert, die Billionen von Wörtern umfassen. Die Beschaffung dieser Daten erfolgte weitgehend kostenlos, da das Material im Internet verfügbar war. Die anschließende Verarbeitung allerdings erfordert enorme Investitionen: Die Trainingskosten für GPT-4 werden auf 78 bis über 100 Millionen US-Dollar geschätzt, neuere Modelle wie Gemini Ultra sollen mit Trainingskosten von bis zu 191 Millionen US-Dollar zu Buche schlagen.
Diese Kostendiskrepanz ist aufschlussreich. Während die menschliche Arbeit, die zur Erstellung der Trainingsdaten notwendig war, faktisch unbezahlt bleibt, fließen die Investitionen in Rechenleistung, Hardware und hochqualifiziertes technisches Personal. Eine Studie von Forschern der Universität Toronto und Chapel Hill hat berechnet, was es kosten würde, wenn die in Trainingsdaten enthaltene menschliche Arbeit fair vergütet würde. Selbst unter sehr konservativen Annahmen übersteigen die hypothetischen Kosten für die Datenerstellung die tatsächlichen Trainingskosten um das Zehn- bis Tausendfache. Für GPT-4 läge der Wert der verwendeten Daten demnach bei über 30 Milliarden US-Dollar, für neuere Modelle könnte er noch deutlich höher liegen. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Wertverschiebung: Die gesamte kreative und informationelle Arbeit der Menschheit wird zum kostenlosen Input für Geschäftsmodelle, deren Gewinne bei wenigen Konzernen konzentriert bleiben.
Die Argumentation der KI-Unternehmen, dass ihre Modelle lediglich aus Daten lernen und keine Kopien erstellen, verschleiert diese ökonomische Realität. Selbst wenn man technisch annimmt, dass ein trainiertes Modell keine exakten Kopien speichert, bleibt die Tatsache bestehen, dass ohne die kreativen Leistungen von Millionen Urhebern diese Modelle nicht funktionieren würden. Die Parameter eines neuronalen Netzes sind das destillierte Ergebnis der Verarbeitung dieser Werke. Sie repräsentieren den extrahierten Wert aus der menschlichen Kreativität. Insofern handelt es sich um eine Form der Aneignung, die zwar technologisch vermittelt ist, ökonomisch aber einer klassischen Enteignung ähnelt.
Memorisierung als technisches und ökonomisches Problem
Die technische Debatte um das Konzept der Memorisierung ist für die rechtliche und ökonomische Bewertung zentral. Forschungsarbeiten haben nachgewiesen, dass große Sprachmodelle durchaus in der Lage sind, Trainingsdaten wortwörtlich zu reproduzieren, insbesondere wenn bestimmte Prompt-Techniken angewendet werden. Eine Studie von Google DeepMind und anderen Institutionen zeigte, dass ChatGPT mit einem simplen Trick, bei dem das Modell aufgefordert wurde, ein Wort zu wiederholen, plötzlich mehrere Megabyte an Trainingsdaten ausgab, obwohl das Modell eigentlich darauf ausgelegt war, dies zu verhindern. Die Forscher extrahierten für etwa zweihundert US-Dollar mehrere Megabyte an memorisierten Inhalten, darunter persönliche Informationen, urheberrechtlich geschützte Texte und andere sensible Daten.
Diese Befunde widersprechen der Darstellung von OpenAI, wonach das Modell keine Daten speichere. Memorisierung tritt besonders dann auf, wenn bestimmte Textsequenzen sehr häufig im Trainingsdatensatz vorkommen. Populäre Liedtexte, die auf zahllosen Webseiten wiederholt wurden, sind geradezu prädestiniert für diesen Effekt. Das Modell erlernt nicht nur abstrakte Muster von Sprache, sondern auch konkrete Sequenzen, die es bei entsprechenden Eingaben wieder abrufen kann. Die Unterscheidung zwischen gelernten Mustern und gespeicherten Daten verschwimmt damit. Aus juristischer Sicht ist entscheidend, dass die Ausgabe urheberrechtlich geschützter Inhalte erfolgt, unabhängig davon, wie diese Ausgabe technisch zustande kommt.
Ökonomisch betrachtet, bedeutet Memorisierung, dass die Wertschöpfung aus den Originaltexten direkt in das Modell übergeht. ChatGPT kann Nutzern Liedtexte liefern, ohne dass diese die Webseite der GEMA oder andere lizenzierte Quellen besuchen müssen. Dies stellt eine direkte Substitution dar, die den Rechteinhabern potenzielle Einnahmen entzieht. Während Suchmaschinen wie Google Nutzer zu den Originalquellen weiterleiten und dadurch Traffic generieren, der monetarisiert werden kann, beendet ChatGPT diese Wertschöpfungskette. Der Nutzer erhält die Information direkt vom Modell, der Urheber geht leer aus. Diese Form der Disintermediation ist ein Kernmerkmal vieler Plattformgeschäftsmodelle, sie erreicht hier jedoch eine neue Qualität, weil sie das kreative Schaffen selbst betrifft.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung
Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Münchner Urteil gegen OpenAI: Wird die GEMA die KI‑Branche neu ordnen?
Asymmetrien der Verhandlungsmacht
Die Auseinandersetzung zwischen der GEMA und OpenAI ist eingebettet in eine fundamentale Machtasymmetrie zwischen der Technologiebranche und der Kreativwirtschaft. OpenAI verfügt über schier unbegrenzte finanzielle Ressourcen: Allein im Jahr 2025 plant das Unternehmen Ausgaben von etwa acht Milliarden US-Dollar, bis 2030 sollen die kumulierten Investitionen in Infrastruktur, Training und Personal nahezu 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Mittel stammen von Investoren wie Microsoft, SoftBank und anderen Kapitalgebern, die auf eine Verfünfzigfachung des Umsatzes bis 2030 setzen. In der Gerichtsverhandlung in München traten sieben Anwälte und zwei Legal Counsels für OpenAI auf, eine Anwaltsmacht, die die Ressourcen selbst großer Verwertungsgesellschaften bei weitem übersteigt.
Auf der anderen Seite stehen Kreative, deren Einkommen bereits durch die Streaming-Ökonomie unter erheblichen Druck geraten ist. Studien zum Musikstreaming in Deutschland zeigen, dass 68 Prozent der Künstler mit ihren gestreamten Werken weniger als einen Euro im Jahr verdienen. Die Umsätze konzentrieren sich extrem: 75 Prozent der Einnahmen entfallen auf nur 0,1 Prozent der Künstler. Das Geschäftsmodell der Streaming-Plattformen, bei dem Künstler nicht nach tatsächlichen Streams bezahlt werden, sondern nach ihrem Anteil an der Gesamtzahl aller Streams, benachteiligt systematisch kleinere und mittlere Künstler. In diese bereits prekäre Situation dringt nun die generative KI ein, die droht, auch noch jene Marktnischen zu besetzen, in denen bislang Menschen arbeiteten.
Die Verhandlungsmacht der Kreativwirtschaft ist strukturell begrenzt. Anders als in der industriellen Produktion, wo Gewerkschaften und Tarifverträge für einen gewissen Ausgleich sorgen, fehlen im Kulturbereich vergleichbare Mechanismen. Verwertungsgesellschaften wie die GEMA nehmen zwar eine wichtige Funktion wahr, sie sind jedoch auf die Durchsetzung bestehender Rechte angewiesen. Wenn aber die Rechtslage unklar ist und Gerichte erst nach Jahren eine Klärung herbeiführen, entsteht ein faktischer Zustand, in dem die technologische Entwicklung Fakten schafft, die juristisch kaum noch einzufangen sind. Bis das Münchner Urteil rechtskräftig wird, können Jahre vergehen. In dieser Zeit wird ChatGPT weiterhin von Hunderten Millionen Menschen genutzt, OpenAI baut seine Marktposition aus, und die Gewöhnung an KI-generierte Inhalte schreitet voran.
Diese Asymmetrie zeigt sich auch in der politischen Arena. Die großen Technologiekonzerne verfügen über erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse, durch Lobbying, durch die Drohung mit Standortverlagerungen und durch die narrative Rahmung, wonach Regulierung Innovation verhindere. Die KI-Verordnung der Europäischen Union, die im August 2025 teilweise in Kraft getreten ist, verpflichtet Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck zwar zu mehr Transparenz über die verwendeten Trainingsdaten. Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben bleibt jedoch Gegenstand intensiver Verhandlungen, in denen die Industrie versucht, möglichst weitgehende Ausnahmen und Übergangsfristen durchzusetzen.
Das Lizenzmodell der GEMA als Gegenmodell
Als Reaktion auf die systematische Nichtbezahlung hat die GEMA im September 2024 als erste Verwertungsgesellschaft weltweit ein Lizenzmodell für generative KI vorgestellt. Dieses Zwei-Säulen-Modell versucht, die Wertschöpfung an beiden Stellen abzuschöpfen, an denen sie entsteht: beim Training der Modelle und bei der Nutzung der generierten Inhalte. Die erste Säule richtet sich an die Anbieter der KI-Systeme und sieht eine Beteiligung von 30 Prozent an allen Netto-Einnahmen vor, die mit dem Modell erwirtschaftet werden. Dies umfasst Abonnementgebühren, Lizenzeinnahmen und andere Erlöse. Zusätzlich soll eine Mindestvergütung gelten, die sich am Umfang der generierten Inhalte orientiert, um auch Modelle zu erfassen, die wenig direkte Einnahmen erzielen, aber dennoch verbreitet genutzt werden.
Die zweite Säule betrifft die Folgenutzung KI-generierter Musikinhalte. Wenn etwa ein mit einem KI-Tool erstellter Song auf Streaming-Plattformen, in Werbung oder als Hintergrundmusik verwendet wird, sollen auch hier Tantiemen an die Urheber der Originalwerke fließen, die zum Training verwendet wurden. Dieses Modell erkennt an, dass die Wertschöpfungskette nicht mit dem Training endet, sondern dass die generierten Inhalte selbst wirtschaftlich verwertet werden und in Konkurrenz zu menschengeschaffener Musik treten.
Die Begründung der GEMA für die Höhe der geforderten Beteiligung ist bemerkenswert. Sie argumentiert, dass die Nutzung von Originalwerken zu Zwecken der generativen KI die intensivste denkbare Nutzungsform darstelle. Anders als bei einer einzelnen Vervielfältigung oder einer Aufführung, bei der das Werk in seiner Identität erhalten bleibt, wird es bei der KI zum Rohmaterial für die Erzeugung neuer Inhalte, die das Original ersetzen oder verdrängen können. Die kreative Leistung der Urheber bildet die unabdingbare Grundlage für den gesamten wirtschaftlichen Erfolg der KI-Anbieter. Eine Beteiligung von 30 Prozent erscheint vor diesem Hintergrund nicht als überzogen, sondern als Versuch, einen angemessenen Anteil am Mehrwert zu sichern.
Kritiker des Modells, vornehmlich aus der Technologiebranche, warnen vor einer Innovationsbremse. Die Kosten für Lizenzen könnten demnach die Entwicklung neuer KI-Anwendungen erschweren und Europa im internationalen Wettbewerb zurückwerfen. Diese Argumentation übersieht jedoch, dass Innovation nicht gleichbedeutend mit der kostenlosen Aneignung fremder Arbeit ist. Auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Forschung und Entwicklung extrem teuer sind, wird nicht argumentiert, dass man sich deshalb kostenlos an patentgeschützten Substanzen bedienen dürfe. Die Frage ist vielmehr, wie die Kosten und Erträge des technologischen Fortschritts verteilt werden und ob eine Wirtschaftsordnung akzeptabel ist, in der wenige Konzerne astronomische Gewinne erzielen, während die Kreativen, auf deren Arbeit alles beruht, systematisch leer ausgehen.
Die internationale Dimension und vergleichbare Konflikte
Das Münchner Verfahren ist kein Einzelfall, sondern Teil einer globalen Auseinandersetzung. In den USA haben mehrere Autorenverbände, Verlage und Medienunternehmen Klagen gegen OpenAI und andere KI-Anbieter eingereicht. Die New York Times verklagte OpenAI und Microsoft im Dezember 2023 und wirft den Unternehmen vor, Millionen von Artikeln ohne Genehmigung zum Training verwendet zu haben. In anderen Verfahren geht es um die Nutzung von Büchern, wissenschaftlichen Publikationen und Programmcode. Ein US-Bundesgericht entschied im Februar 2025 erstmals, dass die Verwendung urheberrechtlich geschützter Daten zum Training einer KI eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann, auch wenn der Entwickler keine Kenntnis von der konkreten Rechtsverletzung hatte.
In Europa hat das Bezirksgericht Budapest dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur Nutzung geschützter Inhalte durch Google Gemini vorgelegt. Es geht um einen Artikel über ein geplantes Delphin-Aquarium, den der Chatbot nahezu wörtlich wiedergab. Die ungarische Klage betrifft sowohl das Urheberrecht als auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Der EuGH wird klären müssen, ob die Wiedergabe von Inhalten durch einen Chatbot eine Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des EU-Rechts darstellt und welche Rolle es spielt, dass die Modelle auf probabilistischen Vorhersagen basieren. Diese Vorlage ist die erste ihrer Art zum Thema generative KI und wird richtungsweisend für die gesamte Europäische Union sein.
Die internationale Dimension zeigt, dass es sich um einen systemischen Konflikt handelt, der nicht durch einzelne nationale Urteile gelöst werden kann. KI-Modelle werden global trainiert, die Trainingsdaten stammen aus allen Teilen der Welt, und die Nutzung erfolgt grenzüberschreitend. Eine fragmentierte Rechtslage, in der jedes Land eigene Standards setzt, würde zu erheblichen Unsicherheiten führen. Zugleich besteht die Gefahr, dass die großen Plattformen regulatorische Arbitrage betreiben, indem sie ihre Aktivitäten in jene Rechtsräume verlagern, in denen die Durchsetzung von Urheberrechten am schwächsten ist. Die GEMA hat mit ihrer Klage bewusst in München geklagt, weil dort eine auf Urheberrecht spezialisierte Kammer existiert und die Wahrscheinlichkeit einer sachkundigen Entscheidung höher ist.
Zukunftsszenarien und systemische Weichenstellungen
Das Münchner Urteil wird nicht das letzte Wort in dieser Auseinandersetzung sein. Beide Seiten haben bereits angekündigt, dass sie mit einer Verweisung an den Europäischen Gerichtshof rechnen, falls das Verfahren in die Berufung geht. Erst eine Grundsatzentscheidung auf europäischer Ebene kann die zahlreichen offenen Rechtsfragen klären, die sich aus der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke durch KI ergeben. Zentral sind dabei Fragen wie: Fällt das Training von KI-Modellen unter die Text-und-Data-Mining-Schranke oder handelt es sich um eine lizenzpflichtige Nutzung? Ist die Ausgabe von Inhalten durch einen Chatbot eine eigenständige urheberrechtliche Handlung? Wie ist die Memorisierung von Daten technisch und rechtlich zu bewerten? Und welche Anforderungen sind an einen wirksamen Nutzungsvorbehalt zu stellen?
Die Antworten auf diese Fragen werden die Geschäftsmodelle der KI-Branche fundamental beeinflussen. Sollten die Gerichte zu dem Schluss kommen, dass Lizenzen erforderlich sind, müssten die Unternehmen entweder erhebliche Summen für den Erwerb von Nutzungsrechten aufbringen oder ihre Modelle auf Basis von lizenzierten oder synthetischen Daten trainieren. Beides würde die Kosten deutlich erhöhen und könnte die Marktstruktur verändern. Kleinere Anbieter, die nicht über die finanziellen Mittel großer Konzerne verfügen, könnten vom Markt verdrängt werden, was zu einer noch stärkeren Konzentration führen würde. Andererseits würde eine rechtssichere Lizenzierung auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, etwa für Verwertungsgesellschaften, Datenbankanbieter und Content-Broker, die zwischen Rechteinhabern und KI-Entwicklern vermitteln.
Ein alternatives Szenario besteht darin, dass die Politik regulatorische Lösungen findet, die einen Ausgleich zwischen Innovationsförderung und Urheberrechtsschutz schaffen. Die EU-KI-Verordnung sieht bereits Transparenzpflichten für KI-Anbieter vor, die offenlegen müssen, welche Daten sie zum Training verwendet haben. Ein nächster Schritt könnte eine gesetzliche Vergütungspflicht sein, bei der KI-Anbieter eine pauschale Abgabe zahlen, die dann nach einem festgelegten Schlüssel an die Rechteinhaber verteilt wird. Dieses Modell würde den bürokratischen Aufwand reduzieren und eine breite Nutzung von Trainingsdaten ermöglichen, ohne dass im Einzelfall Lizenzen verhandelt werden müssen. Die Höhe einer solchen Abgabe und die Verteilungsmechanismen wären jedoch politisch hochumstritten.
Ein drittes Szenario ist die Entstehung neuer kollektiver Verhandlungsstrukturen. Ähnlich wie Gewerkschaften für Arbeitnehmer könnten sich Zusammenschlüsse von Kreativen bilden, die gegenüber den Plattformen mit größerem Gewicht auftreten. Einige Initiativen in diese Richtung existieren bereits, etwa die Coalition for Content Provenance and Authenticity, die sich für die Kennzeichnung von Inhalten einsetzt, oder Projekte zur Entwicklung von Opt-out-Standards, die es Rechteinhabern erleichtern, ihre Werke vom Training auszuschließen. Die Durchsetzungsfähigkeit solcher Initiativen hängt jedoch von der Unterstützung durch Gesetzgebung und Rechtsprechung ab.
Die Neuvermessung des kreativen Kapitalismus
Das Urteil des Landgerichts München ist mehr als eine juristische Entscheidung über neun Liedtexte. Es markiert den Beginn einer notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung darüber, wem die Früchte der digitalen Transformation zustehen und nach welchen Prinzipien Wertschöpfung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz organisiert werden soll. Die Technologiekonzerne haben in den vergangenen Jahren eine Realität geschaffen, in der die kostenlose Aneignung kreativer Leistungen zur Grundlage gigantischer Geschäftsmodelle wurde. Diese Praxis ließ sich so lange aufrechterhalten, wie die rechtliche Lage unklar war und die betroffenen Kreativen über keine effektiven Gegenmachtinstrumente verfügten.
Das Münchner Urteil verändert diese Konstellation. Es stellt fest, dass die bestehende Rechtsordnung, die zum Schutz menschlicher Kreativität geschaffen wurde, auch im Zeitalter der KI Geltung beansprucht. Die Argumentation der Technologieunternehmen, wonach ihre Modelle nur lernen und keine Kopien erstellen, wird als Verschleierung der tatsächlichen ökonomischen Vorgänge durchschaut. Die Frage ist nicht, ob eine KI im technischen Sinne memorisiert, sondern ob die Nutzung fremder Werke zum Training und die anschließende Ausgabe dieser Werke eine Wertverschiebung zugunsten der Plattformen und zulasten der Urheber bewirkt. Die Antwort darauf ist offenkundig.
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieses Urteil den Beginn einer Neujustierung der Machtverhältnisse markiert oder ob es ein symbolischer Erfolg bleibt, der die faktische Entwicklung nicht aufhalten kann. Die Geschichte der Digitalisierung ist voll von Beispielen, in denen Gerichte Rechte feststellten, die dann praktisch nicht durchgesetzt wurden, weil die technologische und ökonomische Dynamik stärker war als das Recht. Entscheidend wird sein, ob die Politik den Mut aufbringt, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine faire Beteiligung der Kreativen sicherstellen, ohne Innovation zu ersticken. Das ist keine einfache Aufgabe, aber sie ist notwendig, wenn wir verhindern wollen, dass die kulturelle Produktion künftig allein den ökonomischen Imperativen einiger weniger Konzerne unterworfen wird.
In der langen historischen Perspektive steht das Münchner Urteil in einer Reihe mit anderen Auseinandersetzungen um die Aneignung des Gemeinsamen. Wie einst die Einhegung der Allmende im Übergang zur Marktwirtschaft oder die Privatisierung öffentlicher Güter im Neoliberalismus geht es auch hier um die Frage, was der Allgemeinheit gehört und was privatwirtschaftlich angeeignet werden darf. Die Kreativität der Menschheit, niedergelegt in Millionen von Werken, ist ein kollektives Gut. Die Frage, ob einige wenige Konzerne dieses Gut kostenlos in exklusive Geschäftsmodelle überführen dürfen, betrifft den Kern unserer Wirtschaftsordnung. Das Münchner Urteil ist ein Schritt in Richtung einer Antwort, die die Rechte der Schaffenden ernst nimmt. Ob dieser Schritt ausreicht, wird sich zeigen.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing
Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
