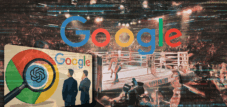Googles Werbemonopol vor Gericht: Das Ende des Werbe-Monopols? Warum Google jetzt die Zerschlagung droht – Bild: Xpert.Digital
20 Milliarden Dollar Schaden: Wie Verlage systematisch ausgebootet wurden
„Goldman Sachs und die Börse zugleich“: So manipulierte Google den Anzeigenmarkt
Im November 2025 blickt die gesamte digitale Wirtschaft nach Alexandria, Virginia. Dort, im Gerichtssaal von Bundesrichterin Leonie Brinkema, findet der entscheidende Akt in einem der bedeutendsten Wirtschaftsprozesse der modernen Geschichte statt. Es geht nicht mehr nur um Geldstrafen oder Ermahnungen – es geht um die Existenzfrage von Googles Werbemonopol. Nachdem die US-Justiz bereits festgestellt hat, dass der Technologiegigant illegale Monopole im Bereich der Werbe-Server und Anzeigenbörsen unterhält, steht nun die alles entscheidende Frage im Raum: Wie lässt sich ein Markt reparieren, der über ein Jahrzehnt lang systematisch verzerrt wurde?
Die Beweislast ist erdrückend. Mit einem Marktanteil von über 90 Prozent bei den Publisher-Adservern kontrolliert Google praktisch die Infrastruktur, auf der das freie Internet finanziert wird. Das Justizministerium zeichnet das Bild eines Konzerns, der sich wie ein Krake in alle Ebenen des Handels geschlichen hat: Google vertritt die Werbetreibenden, die Verlage und betreibt gleichzeitig den Marktplatz dazwischen – eine Machtkonzentration, die intern treffend damit verglichen wurde, als würde „Goldman Sachs gleichzeitig die New Yorker Börse besitzen“.
Doch während das Gericht über eine mögliche Zerschlagung des Werbeimperiums und die Zwangsveräußerung der “Cashcow” AdX berät, offenbart sich ein juristisches Dilemma: Die Zeit spielt gegen die Gerechtigkeit. Richterin Brinkema weiß, dass Google jedes Urteil durch jahrelange Berufungsprozesse verschleppen wird, während die geschädigten Verlage und der Wettbewerb weiter ausbluten. Dieser Artikel beleuchtet die tiefgreifenden Mechanismen der Marktmanipulation, die verzweifelte Suche der Justiz nach wirksamen Sanktionen und die Frage, ob das offene Internet, wie wir es kennen, durch dieses Urteil gerettet werden kann – oder ob die technologische Realität die Justiz längst überholt hat.
Wenn Richter den Datengiganten zerschlagen wollen – aber die Zeit gegen alle läuft
Die Vereinigten Staaten stehen am Scheideweg einer der bedeutendsten kartellrechtlichen Auseinandersetzungen der modernen Digitalwirtschaft. Im November 2025 verhandelt Bundesrichterin Leonie Brinkema in Alexandria, Virginia, über das Schicksal von Googles Werbetechnologiegeschäft. Die Justiz hat bereits entschieden, dass der Konzern zwei illegale Monopole unterhält. Nun geht es um die Frage, wie dieses Unrecht behoben werden kann, ohne dass Jahre verstreichen, während Google gegen jede Entscheidung Berufung einlegt. Das Justizministerium fordert eine radikale Zerschlagung des Werbeimperiums, während Google beteuert, dass rechtmäßig erworbene Monopolmacht das Fundament der amerikanischen Wirtschaft sei. Zwischen diesen Extrempositionen muss eine Richterin entscheiden, die offen zugibt, dass ihr die Zeit davonläuft. Denn während die Gerichte verhandeln, festigt sich Googles Dominanz weiter, und die geschädigten Verlage sowie Werbetreibenden zahlen täglich den Preis für einen verzerrten Markt.
Das Kartell im Kartellrecht
Die ökonomische Dimension des Falls übertrifft alle bisherigen Technologieprozesse. Google kontrolliert nach Feststellungen des Gerichts zwischen 91 und 93,5 Prozent des weltweiten Marktes für Publisher-Adserver im Zeitraum von 2018 bis 2022. Beim Werbeaustausch AdX liegt der Marktanteil bei etwa neunmal höher als der des nächstgrößeren Wettbewerbers. Diese Zahlen sind keine abstrakten Statistiken, sondern spiegeln eine systematische Umleitung von Werbegeldern wider, die eigentlich Verlagen und Inhaltsproduzenten zustehen würden. Das Justizministerium schätzt die jährlichen Schäden auf über 20 Milliarden US-Dollar. Google verlangt von Publishern eine Gebühr von 20 Prozent für die Nutzung von AdX, während konkurrierende Plattformen weniger als die Hälfte verlangen. Die Tatsache, dass Publisher trotz dieser Preisdifferenz nicht zu günstigeren Alternativen wechseln, ist für Ökonomen der eindeutigste Beweis für Monopolmacht.
Die Wurzeln dieser Dominanz reichen zurück in das Jahr 2008, als Google den Werbetechnologieanbieter DoubleClick für 3,1 Milliarden US-Dollar übernahm. Diese Akquisition, die damals gegen heftigen Widerstand von Microsoft durchgesetzt wurde, stellte sich im Nachhinein als strategischer Coup dar. DoubleClick hatte bereits einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil entwickelt, die sogenannte dynamische Zuweisung, die es der Plattform ermöglichte, in Echtzeit gegen direkt verkaufte Werbeflächen von Publishern zu konkurrieren. Google integrierte diese Technologie nahtlos in sein bestehendes Geschäftsmodell und begann systematisch, die drei zentralen Säulen der digitalen Werbeinfrastruktur zu kontrollieren: die Seite der Werbetreibenden, die Seite der Publisher und die dazwischenliegende Börse, an der Transaktionen abgewickelt werden.
Diese vertikale Integration wurde von Google selbst intern mit der Analogie beschrieben, Goldman Sachs würde gleichzeitig die New Yorker Börse besitzen. Der Interessenkonflikt ist offensichtlich. Google betreibt Werkzeuge, die Publisher nutzen, um Werbeflächen zu verkaufen, kontrolliert gleichzeitig die Börse, an der diese Transaktionen stattfinden, und verfügt über enorme Nachfrage von Werbetreibenden. In einem funktionierenden Markt würden unabhängige Akteure diese Rollen übernehmen und sich gegenseitig kontrollieren. Bei Google fallen alle Funktionen zusammen, was dem Konzern ermöglicht, auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette Gebühren zu erheben und gleichzeitig die Regeln des Marktes zu seinen Gunsten zu gestalten.
Die Mechanismen der Marktverzerrung
Das Gericht hat detailliert dokumentiert, wie Google seine Marktmacht missbrauchte. Eine der zentralen anticompetitiven Praktiken war die Kopplung von DoubleClick for Publishers (DFP), dem Adserver für Publisher, mit AdX, Googles Werbebörse. Publisher, die Zugang zu Echtzeitgeboten über AdX wollten, waren faktisch gezwungen, auch DFP zu nutzen. Diese technische und vertragliche Verknüpfung verhinderte, dass Wettbewerber auf dem Adserver-Markt Fuß fassen konnten, selbst wenn sie bessere oder günstigere Dienste anboten.
Zusätzlich implementierte Google eine Reihe von Mechanismen, die AdX systematisch bevorzugten. Die First-Look-Funktion gab AdX ein Vorkaufsrecht auf jede Werbeeinblendung, bevor konkurrierende Börsen überhaupt eine Chance hatten zu bieten. Last Look erlaubte es AdX, die Gebote konkurrierender Börsen einzusehen und nachträglich zu überbieten, selbst wenn das eigentliche Gebot niedriger war. Diese Praktiken waren nicht etwa Ergebnis überlegener Technologie oder besserer Dienstleistungen, sondern Ausdruck roher Marktmacht.
Als Publisher in den 2010er Jahren versuchten, diese Dominanz durch Header Bidding zu umgehen, eine Technologie, die es mehreren Börsen ermöglicht, gleichzeitig auf Werbeflächen zu bieten, reagierte Google nicht durch Teilnahme an fairer Konkurrenz, sondern durch Einführung neuer Mechanismen, die den Vorteil von AdX weiter zementierten. Die Unified Pricing Rule etwa verhinderte, dass Publisher höhere Mindestpreise für konkurrierende Börsen festlegten. Diese Maßnahme mag auf den ersten Blick marktneutral erscheinen, diente aber in Wirklichkeit dazu, die strukturellen Vorteile von AdX zu schützen.
Globale Werbeströme im digitalen Zeitalter
Um die Bedeutung dieser Marktverzerrungen zu verstehen, muss man die Größenordnung des globalen digitalen Werbemarktes berücksichtigen. Im Jahr 2024 beliefen sich die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung auf etwa 600 Milliarden US-Dollar. Für 2025 werden bereits 650 Milliarden prognostiziert, mit einem erwarteten Wachstum auf 1,48 Billionen US-Dollar bis 2034. Diese Zahlen entsprechen einem jährlichen Wachstum von etwa 9,5 Prozent. Nordamerika ist mit einem Anteil von über 37 Prozent der größte Einzelmarkt, gefolgt von Europa und Asien-Pazifik.
Google dominiert diesen Markt mit eindrucksvoller Effizienz. Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen Werbeeinnahmen von 74,18 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein die Suchewerbung brachte 56,57 Milliarden ein, während YouTube weitere 10,3 Milliarden beisteuerte. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Googles Werbegeschäft nicht nur absolut, sondern auch relativ zu anderen Technologiekonzernen eine herausragende Stellung einnimmt. Zum Vergleich: Meta, der zweitgrößte Akteur, kommt auf einen Marktanteil von etwa 18 Prozent, Amazon auf sieben Prozent. Google allein kontrolliert nach verschiedenen Schätzungen zwischen 39 und 40 Prozent des gesamten globalen digitalen Werbemarktes.
Diese Konzentration hat weitreichende Konsequenzen für die Funktionsweise digitaler Märkte. Die Werbetechnologie ist keine neutrale Infrastruktur, sondern ein aktiv gesteuertes Ökosystem, in dem jede Millisekunde, jeder Datenpunkt und jede Auktionsentscheidung von Algorithmen kontrolliert wird, die Google entwickelt und betreibt. Publisher berichten, dass sie trotz Kenntnis der ungünstigen Konditionen das Gefühl haben, keine Wahl zu haben, als Googles Dienste zu nutzen. Diese Abhängigkeit ist charakteristisch für Märkte mit Netzwerkeffekten, in denen der Wert einer Plattform mit der Anzahl ihrer Nutzer exponentiell steigt.
Der juristische Zangengriff
Die rechtliche Grundlage für das Vorgehen gegen Google bildet Section 2 des Sherman Antitrust Act von 1890, das fundamentale Wettbewerbsgesetz der Vereinigten Staaten. Dieser Paragraph verbietet Monopolisierung und den Versuch der Monopolisierung. Entscheidend ist dabei, dass nicht der Besitz von Monopolmacht an sich illegal ist, sondern der willentliche Erwerb oder die Aufrechterhaltung dieser Macht durch anticompetitive Mittel. Ein Unternehmen, das durch überlegene Produkte, geschäftliches Können oder historischen Zufall zur Dominanz gelangt, verstößt nicht gegen das Kartellrecht. Ein Unternehmen hingegen, das durch systematische Behinderung von Wettbewerbern und Manipulation von Märkten seine Position sichert, überschreitet die Grenze zur Illegalität.
Richterin Brinkema stellte in ihrer Entscheidung vom April 2025 fest, dass Google beide Elemente einer Monopolisierung erfüllt: erstens den Besitz von Monopolmacht in den Märkten für Publisher-Adserver und Werbebörsen, und zweitens die willentliche Aufrechterhaltung dieser Macht durch anticompetitives Verhalten. Besonders die Kopplung von DFP und AdX stufte das Gericht als Verstoß gegen das Kartellrecht ein. Diese Praxis zwang Kunden, zwei separate Produkte zusammen zu kaufen, obwohl sie möglicherweise nur eines davon gewollt hätten, und verhinderte, dass Wettbewerber auf Grundlage ihrer Leistungen konkurrieren konnten.
Die Feststellung einer illegalen Monopolstellung ist jedoch nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Ausgestaltung wirksamer Abhilfemaßnahmen. Das Justizministerium fordert eine strukturelle Trennung, konkret die Zwangsveräußerung von AdX und möglicherweise auch des Adservers Google Ad Manager. Die Argumentation ist, dass nur eine physische Trennung der Geschäftsbereiche verhindern kann, dass Google neue Wege findet, seine Dominanz aufrechtzuerhalten. Verhaltensbasierte Auflagen, so die Befürchtung, würden Google lediglich zwingen, seine Strategien anzupassen, ohne die grundlegenden Interessenkonflikte zu beseitigen.
Google verteidigt sich mit dem Argument, dass eine Zerschlagung technisch komplex, wirtschaftlich schädlich und rechtlich unverhältnismäßig wäre. Die Anwälte des Konzerns verweisen auf den Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs von 2004, der feststellte, dass rechtmäßig erworbene Monopolmacht das Fundament der amerikanischen Wirtschaft sei. Zudem argumentiert Google, dass eine erzwungene Aufteilung die Qualität der Dienstleistungen beeinträchtigen, Innovationen hemmen und letztlich Kunden schaden würde. Die Umstellung auf ein fragmentiertes System würde Publisher und Werbetreibende zwingen, komplexe neue Integrationen vorzunehmen, mit ungewissen Erfolgsaussichten.
Unsere USA-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten
Zwischen Politik und Justiz: Der globale Machtkampf um Googles Geschäftsmodell
Das Zeitproblem der Justiz
Richterin Brinkema brachte während der Schlussargumente im November 2025 eine Sorge zum Ausdruck, die den Kern des Dilemmas kartellrechtlicher Durchsetzung im digitalen Zeitalter offenbart: Die Zeit arbeitet gegen die Gerechtigkeit. Google wird mit Sicherheit gegen jede ungünstige Entscheidung Berufung einlegen, ein Prozess, der Jahre dauern kann. Während dieser Zeit befindet sich das Unternehmen in einer unmöglichen Lage, wie die Richterin anmerkte. Einerseits hat es bereits verloren und muss mit Strafen rechnen. Andererseits wird es seine Geschäfte weiterbetreiben, und jede Zerschlagungsanordnung steht unter dem Vorbehalt, dass sie während des Berufungsverfahrens möglicherweise nicht vollstreckbar ist.
Diese Situation ist paradox. Das Gericht hat festgestellt, dass Google illegale Monopole betreibt, die Publisher, Werbetreibenden und letztlich Verbrauchern schaden. Doch zwischen Urteilsverkündung und tatsächlicher Behebung des Schadens können Jahre vergehen. In dieser Zeit entstehen neue Klagen von Verlagen und Wettbewerbern, die Schadensersatz fordern und sich auf das Urteil stützen. Die Rechtslage von Google wird immer prekärer, während gleichzeitig die Aussicht auf schnelle Veränderungen schwindet.
Die Richterin erwägt daher, ob verhaltensbasierte Auflagen nicht der praktikablere Weg wären. Solche Maßnahmen könnten schneller implementiert werden und unterlägen nicht denselben rechtlichen Hürden wie eine strukturelle Trennung. Google könnte beispielsweise verpflichtet werden, Konkurrenzbörsen gleichberechtigten Zugang zu gewähren, Auktionsdaten transparent zu machen oder die Kopplung von DFP und AdX aufzuheben. Diese Lösungen würden nicht die gleiche grundsätzliche Transformation des Marktes bewirken wie eine Zerschlagung, könnten aber zumindest kurzfristig Wettbewerb ermöglichen.
Doch die Erfahrung mit verhaltensbasierten Auflagen in früheren Kartellverfahren ist ernüchternd. Microsoft wurde nach dem legendären Kartellverfahren der 1990er Jahre zu verschiedenen Verhaltensänderungen verpflichtet, ohne dass das Unternehmen zerschlagen wurde. Im Nachhinein urteilen viele Beobachter, dass diese Auflagen zwar kurzfristig Wirkung zeigten, langfristig aber die Dominanz von Microsoft in bestimmten Bereichen nicht gebrochen haben. Technologieunternehmen sind notorisch geschickt darin, formale Compliance mit dem Buchstaben von Gerichtsentscheidungen zu zeigen, während sie im Geist neue Wege finden, ihre Marktstellung zu festigen.
Die politische Dimension des Falles
Die kartellrechtliche Auseinandersetzung mit Google findet in einem politisch aufgeladenen Umfeld statt. Der Fall begann während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump, wurde unter Präsident Joe Biden vorangetrieben und steht nun, während Trumps Rückkehr ins Amt, vor der Entscheidung. Diese parteienübergreifende Kontinuität ist bemerkenswert und zeigt, dass die Skepsis gegenüber der Macht großer Technologiekonzerne beide politischen Lager vereint.
Allerdings unterscheiden sich die ideologischen Begründungen deutlich. Progressive Kritiker sehen in der Dominanz von Big Tech eine Bedrohung für wirtschaftliche Gerechtigkeit und demokratische Öffentlichkeit. Sie argumentieren, dass die Konzentration von Daten, Geld und Aufmerksamkeit in den Händen weniger Konzerne die Medienvielfalt gefährdet, kleinen Unternehmen schadet und die Verhandlungsmacht von Verbrauchern und Arbeitnehmern schwächt. Konservative Kritiker hingegen betonen nationale Sicherheit und amerikanische Wettbewerbsfähigkeit. Sie befürchten, dass regulatorischer Übereifer Innovation hemmt und den USA im globalen Technologiewettlauf schadet, insbesondere gegenüber China.
Diese Spannung wird in der Amtszeit von Gail Slater als stellvertretende Generalstaatsanwältin für Kartellrecht deutlich. Slater, die im März 2025 bestätigt wurde, vertritt einen als America First Antitrust bezeichneten Ansatz. Sie argumentiert, dass strenge Kartellrechtsdurchsetzung nicht im Widerspruch zu nationalem Interesse steht, sondern im Gegenteil notwendig ist, um Innovationen zu fördern. Ihre Argumentation lautet, dass historisch betrachtet nicht Monopole, sondern offene Märkte und intensiver Wettbewerb die Triebfeder amerikanischer technologischer Führerschaft waren. Die Halbleiterindustrie, das Internet und Smartphones seien nicht aus den Laboren dominanter Monopolisten entstanden, sondern aus wettbewerbsintensiven Ökosystemen, in denen viele Unternehmen um die besten Lösungen konkurrierten.
Gleichzeitig warnt Slater vor einer Übernahme des chinesischen Modells, in dem staatlich geförderte Champions die technologische Entwicklung vorantreiben. Ein solches System würde zwar kurzfristig Effizienzgewinne ermöglichen, langfristig aber Innovationen ersticken. Die Debatte um Google ist daher auch eine Debatte über das richtige Verhältnis von Markt und Staat, von Wettbewerb und nationaler Strategie, von Freiheit und Kontrolle in der digitalen Ökonomie.
Vergleich mit parallelen Verfahren
Google steht nicht allein vor kartellrechtlichen Herausforderungen. Die amerikanische Justiz hat in den letzten Jahren eine Reihe von Verfahren gegen große Technologiekonzerne eingeleitet, die zusammengenommen eine fundamentale Neuausrichtung der Wettbewerbspolitik signalisieren könnten. Meta, Amazon und Apple sehen sich jeweils mit Klagen konfrontiert, die ihre Geschäftsmodelle in Frage stellen.
Im Fall von Meta forderte die Federal Trade Commission die Rückabwicklung der Übernahmen von Instagram und WhatsApp. Die Argumentation war, dass Meta gezielt aufkommende Wettbewerber aufgekauft habe, um seine Dominanz im Bereich sozialer Netzwerke zu sichern. Im November 2025 wies ein Bundesrichter diese Klage jedoch ab. Das Gericht urteilte, dass die FTC nicht nachweisen konnte, dass Meta heute über Monopolmacht verfügt, ungeachtet der Frage, ob die Übernahmen zum Zeitpunkt ihrer Genehmigung problematisch waren. Diese Entscheidung wurde weithin als Rückschlag für aggressive Kartellrechtsdurchsetzung interpretiert.
Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung in einem parallelen Google-Verfahren, das sich auf die Suchmaschine konzentriert. Im August 2024 hatte ein anderer Bundesrichter festgestellt, dass Google durch exklusive Vereinbarungen mit Geräteherstellern und Browserbetreibern eine illegale Monopolstellung im Suchmarkt errichtet hatte. Das Unternehmen zahlte im Jahr 2021 allein 26 Milliarden US-Dollar an Apple, Mozilla und andere Partner, um als Standardsuchmaschine voreingestellt zu werden. Im September 2025 ordnete der Richter verschiedene Abhilfemaßnahmen an, lehnte aber eine Zerschlagung ab. Google wurde verpflichtet, bestimmte Suchdaten mit Wettbewerbern zu teilen und exklusive Verträge zu beenden. Die Anordnung, Chrome oder Android zu veräußern, die das Justizministerium gefordert hatte, wurde als überzogen zurückgewiesen.
Diese unterschiedlichen Ausgänge zeigen, dass kartellrechtliche Durchsetzung im Technologiebereich keine mechanische Anwendung fester Regeln ist, sondern eine komplexe Abwägung von Marktdefinitionen, Wettbewerbsanalysen und Verhältnismäßigkeitserwägungen. Jeder Fall hängt von spezifischen Fakten ab, und Richter haben erheblichen Ermessensspielraum bei der Festlegung angemessener Abhilfemaßnahmen. Die Tatsache, dass Google in einem Fall glimpflich davonkam, bedeutet nicht zwingend, dass dies auch im Werbetechnologie-Fall geschehen wird. Die Beweislage und die Marktstrukturen unterscheiden sich erheblich.
Die europäische Parallele
Während die amerikanischen Gerichte über Googles Schicksal verhandeln, hat die Europäische Union bereits entschieden. Im September 2025 verhängte die Europäische Kommission eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro gegen Google wegen Missbrauchs seiner dominanten Stellung im Werbetechnologiebereich. Die Kommission kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie das amerikanische Gericht: Google habe durch Self-Preferencing seine eigene Werbebörse AdX systematisch bevorzugt, zu Lasten von Wettbewerbern, Publishern und Werbetreibenden.
Die Entscheidung der Kommission ging jedoch über eine reine Geldstrafe hinaus. Google wurde aufgefordert, innerhalb von 60 Tagen einen Plan vorzulegen, wie es seine Interessenkonflikte beseitigen will. Falls die vorgeschlagenen Maßnahmen als unzureichend bewertet werden, behält sich die Kommission das Recht vor, strukturelle Abhilfemaßnahmen anzuordnen, die faktisch einer Zerschlagung gleichkommen könnten. Diese als Black-Box-Enforcement bezeichnete Strategie ist bemerkenswert: Die Behörde verzichtet darauf, selbst detaillierte technische Vorgaben zu machen, legt aber ein Ergebnis fest und droht mit drastischen Konsequenzen, falls dieses nicht erreicht wird.
Kritiker sehen darin eine problematische Verschiebung regulatorischer Macht. Einerseits gibt sie Unternehmen Flexibilität, kreative Lösungen zu entwickeln. Andererseits erzeugt sie Rechtsunsicherheit und könnte als verdeckter Zwang zur Selbstzerschlagung interpretiert werden. Wenn ein Unternehmen zwischen einer formalen Anordnung zur Veräußerung und einer informellen Erwartung, dass nur eine Veräußerung akzeptabel ist, wählen muss, ist die Grenze zwischen Freiwilligkeit und Zwang verschwommen.
Die transatlantische Konvergenz in der Beurteilung von Googles Verhalten ist bemerkenswert. Über Jahrzehnte hinweg haben die USA und die EU unterschiedliche Philosophien der Wettbewerbspolitik verfolgt. Die amerikanische Tradition betont Verbraucherwohlfahrt, gemessen primär an Preisen und Output. Die europäische Tradition legt stärkeres Gewicht auf die Struktur von Märkten und die Chancengleichheit von Wettbewerbern. Im Fall Google scheinen diese Ansätze jedoch zum gleichen Ergebnis zu führen: Das Geschäftsmodell des Konzerns schadet sowohl Verbrauchern als auch Wettbewerbern und ist daher kartellrechtlich inakzeptabel.
Diese Konvergenz könnte weitreichende Folgen haben. Sollten sowohl die USA als auch die EU zu dem Schluss kommen, dass nur strukturelle Trennungen die Probleme lösen können, würde Google unter massivem Druck stehen, global sein Geschäftsmodell zu überdenken. Der Konzern könnte sich zwar entscheiden, unterschiedliche Strukturen in verschiedenen Jurisdiktionen zu unterhalten, aber die operativen und strategischen Kosten einer solchen Fragmentierung wären enorm. Wahrscheinlicher ist, dass Google versuchen wird, eine Lösung zu finden, die beiden Seiten des Atlantiks gerecht wird, auch wenn das bedeutet, Geschäftsbereiche aufzugeben, die bisher als unverzichtbar galten.
Ökonomische Folgen der Zerschlagung
Die wirtschaftlichen Implikationen einer möglichen Zerschlagung von Googles Werbetechnologie-Geschäft sind schwer zu überschätzen. Das Unternehmen generiert jährlich über 200 Milliarden US-Dollar durch Werbung, wovon ein erheblicher Teil auf das Werbetechnologie-Segment entfäl, das nun zur Disposition steht. Eine Veräußerung von AdX und möglicherweise des Adservers würde nicht nur Googles Einnahmen reduzieren, sondern auch die Struktur des gesamten digitalen Werbemarktes verändern.
Publisher könnten von einer größeren Auswahl an Adservern und Werbebörsen profitieren, mit intensiverem Preiswettbewerb und möglicherweise höheren Einnahmen. Die These der Kläger ist, dass Google heute auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette Gebühren erhebt, die zusammengenommen die Kosten für Werbetreibende erhöhen und die Erlöse für Publisher senken. Wenn verschiedene Unternehmen diese Funktionen übernähmen und um Kunden konkurrierten, würden die Margen schrumpfen, und mehr Geld würde bei denjenigen ankommen, die tatsächlich Wert schaffen: den Inhaltsproduzenten und denjenigen, die Aufmerksamkeit monetarisieren.
Allerdings gibt es auch legitime Bedenken hinsichtlich der Übergangskosten. Das Werbetechnologie-Ökosystem ist komplex und hochgradig integriert. Googles Systeme verarbeiten laut eigenen Angaben 8,2 Millionen Anfragen pro Sekunde zur Platzierung von Werbung. Die technische Infrastruktur, die dies ermöglicht, ist über Jahre hinweg optimiert worden und funktioniert mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit. Eine erzwungene Aufspaltung würde diese Integration zerstören und erfordern, dass neue Schnittstellen definiert, Daten migriert und Prozesse neu konfiguriert werden.
Google argumentiert, dass dieser Übergang chaotisch wäre und zu Ausfällen, Datenschutzverletzungen und Qualitätseinbußen führen könnte. Publisher und Werbetreibende müssten neue Verträge aushandeln, neue Integrationen vornehmen und ihre Workflows anpassen. Die Unsicherheit über die Funktionsfähigkeit eines fragmentierten Systems könnte zu einem vorübergehenden Einbruch der Werbeeinnahmen führen, gerade für kleinere Publisher, die nicht über die Ressourcen verfügen, um schnell auf veränderte technische Anforderungen zu reagieren.
Experten, die im Rahmen des Verfahrens angehört wurden, kamen zu unterschiedlichen Einschätzungen der Machbarkeit. Technische Gutachter schätzten, dass eine Trennung von AdX und dem Adserver zwischen 18 und 24 Monaten in Anspruch nehmen würde. Das klingt nach einem überschaubaren Zeitraum, setzt aber voraus, dass Google kooperiert und aktiv dabei hilft, neue Schnittstellen zu entwickeln und Daten zu übertragen. Ob ein Unternehmen, das gerade zu einer Zerschlagung gezwungen wird, bereit ist, diesen Prozess konstruktiv zu unterstützen, ist eine offene Frage.
Aus makroökonomischer Perspektive könnte eine Zerschlagung Innovationen fördern. Die Geschichte des Kartellrechts bietet zahlreiche Beispiele, in denen die Aufspaltung dominanter Unternehmen zu einem Aufschwung von Wettbewerb und technologischem Fortschritt führte. Die Zerschlagung von AT&T in den 1980er Jahren ermöglichte den Aufstieg des modernen Telekommunikationsmarktes. Die kartellrechtlichen Maßnahmen gegen Microsoft in den 1990er Jahren öffneten Raum für neue Akteure im Softwarebereich und trugen möglicherweise zum Aufstieg des Internets als offener Plattform bei. Kritiker dieser Analogien wenden ein, dass die Umstände heute anders sind und dass die globale Konkurrenz, insbesondere aus China, es sich Amerika nicht leisten kann, seine erfolgreichsten Unternehmen zu schwächen.
🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung
Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital
Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Mehr dazu hier:
Google unter Druck: Kartellprozess als Wendepunkt für das offene Internet
Das Publisher-Dilemma
Im Zentrum der kartellrechtlichen Auseinandersetzung steht die Frage, wer die Kosten des digitalen Ökosystems trägt und wer die Gewinne einstreicht. Publisher, also diejenigen, die Inhalte produzieren und Publikum aufbauen, sollten theoretisch die Hauptnutznießer der Werbeeinnahmen sein. In der Praxis berichten jedoch viele Verlage, dass sie nur einen Bruchteil der Werbegelder erhalten, die Werbetreibende ausgeben. Die Differenz geht an Intermediäre, vor allem an Google.
Gannett, der größte Zeitungsverlag der USA, war einer der ersten Zeugen im Prozess. Vertreter des Unternehmens berichteten, dass sie das Gefühl hätten, keine Wahl zu haben, als Googles Dienste zu nutzen, obwohl sie wüssten, dass sie auf der Verliererseite des Deals stünden. Diese Aussage ist paradigmatisch für das Phänomen, das Ökonomen als Lock-in bezeichnen. Einmal in ein System integriert, sind die Kosten des Wechsels so hoch, dass selbst offensichtlich ungünstige Konditionen akzeptiert werden.
Die Entwicklung der Medienlandschaft in den letzten zwei Jahrzehnten ist eng mit dieser Dynamik verbunden. Lokale Zeitungen, Fachzeitschriften und unabhängige Online-Publikationen haben drastische Einnahmerückgänge erlebt, nicht weil ihre Inhalte weniger wertvoll geworden wären, sondern weil die Monetarisierung dieser Inhalte durch Werbung zunehmend von Plattformen kontrolliert wird, die selbst keine Inhalte produzieren. Google und Meta streichen zusammen einen Großteil der digitalen Werbeeinnahmen ein, während die Produzenten der Inhalte, die überhaupt erst Publikum und Aufmerksamkeit schaffen, mit schrumpfenden Budgets kämpfen.
Diese Umverteilung hat demokratiepolitische Implikationen. Lokaljournalismus, investigative Berichterstattung und Fachjournalismus sind teure Formen der Inhaltsproduktion, die sich nur refinanzieren lassen, wenn Verlage einen angemessenen Anteil an Werbeeinnahmen erhalten. Wenn stattdessen das Geld bei Technologieplattformen hängenbleibt, führt das zu einer Verarmung der öffentlichen Debatte. Weniger Journalisten, weniger Recherchen, weniger Vielfalt der Stimmen.
Header Bidding, die Technologie, die Ende der 2010er Jahre als Gegenmittel gegen Googles Dominanz entwickelt wurde, konnte diesen Trend nur teilweise umkehren. Die Grundidee war, dass Publisher mehreren Werbebörsen gleichzeitig erlauben, auf ihre Werbeflächen zu bieten, anstatt eine Börse zu bevorzugen. Das erhöhte den Wettbewerb und führte bei einigen Publishern zu Einnahmesteigerungen von 20 bis 70 Prozent. Allerdings reagierte Google auf Header Bidding mit Gegenmaßnahmen, die seine strukturellen Vorteile schützten, sodass die Technologie nie ihr volles Potenzial entfalten konnte.
Technologische Transformation durch KI
Eine Komplikation, die in den Schlussargumenten deutlich wurde, ist die Rolle künstlicher Intelligenz. Googles Anwälte argumentierten, dass sich die Technologielandschaft durch KI so rasant verändere, dass kartellrechtliche Eingriffe, die auf heutigen Marktstrukturen basieren, morgen schon obsolet sein könnten. KI-gestützte Chatbots wie ChatGPT von OpenAI verändern bereits jetzt die Art, wie Menschen Informationen suchen und konsumieren. Wenn Nutzer zunehmend Konversationsagenten statt traditioneller Suchmaschinen verwenden, könnte Googles Dominanz in der Suche erodieren, und mit ihr möglicherweise die Dominanz in der Werbung.
Das Justizministerium widersprach dieser Argumentation vehement. Die Regierungsvertreter argumentierten, dass KI nicht Googles Macht schwächen, sondern im Gegenteil verstärken wird. Google verfügt über mehr Daten, mehr Rechenressourcen und mehr Expertise in maschinellem Lernen als die meisten Wettbewerber. Wenn KI die Zukunft der Werbetechnologie ist, dann hat Google alle Voraussetzungen, um auch in dieser Zukunft zu dominieren. Die Algorithmen, die Auktionen steuern, Nutzerverhalten vorhersagen und Werbewirkung messen, werden durch KI immer leistungsfähiger. Doch diese Algorithmen sind undurchsichtig, schwer zu überwachen und noch schwerer zu regulieren.
Die Diskussion um KI zeigt eine grundsätzliche Spannung in der Kartellrechtsdurchsetzung. Auf der einen Seite soll Wettbewerbspolitik Innovationen fördern und nicht behindern. Zu strenge Eingriffe könnten Unternehmen davon abhalten, in neue Technologien zu investieren, aus Angst, dass erfolgreiche Innovationen später als anticompetitiv gebrandmarkt werden. Auf der anderen Seite ist es genau die Fähigkeit dominanter Plattformen, neue Technologien schneller und effektiver einzusetzen als Wettbewerber, die ihre Macht perpetuiert. Ohne Eingriffe könnte die technologische Entwicklung die Konzentration weiter verschärfen, anstatt sie aufzulösen.
Das Dilemma der Verhaltensauflagen
Neben der strukturellen Trennung steht die Option verhaltensbasierter Auflagen im Raum. Google hat angeboten, verschiedene Geschäftspraktiken zu ändern, um Wettbewerb zu ermöglichen. Dazu gehört, Wettbewerbern Zugang zu Echtzeitdaten über Auktionen zu gewähren, die Kopplung von DFP und AdX aufzuheben und Publisher mehr Kontrolle über die Bedingungen zu geben, unter denen sie Werbeflächen verkaufen.
Solche Maßnahmen klingen auf dem Papier vernünftig, werfen aber Fragen der Durchsetzbarkeit auf. Wie lässt sich überprüfen, dass Google tatsächlich allen Wettbewerbern gleichberechtigten Zugang gewährt? Wie kann sichergestellt werden, dass subtile Algorithmusänderungen nicht doch wieder zu Bevorzugungen führen? Die Komplexität der Werbetechnologie macht externe Kontrolle extrem schwierig. Eine Auktion, die in Millisekunden abläuft und Millionen von Parametern berücksichtigt, lässt sich nicht einfach nachvollziehen.
Das Gericht erwägt daher die Einrichtung eines technischen Komitees, das die Umsetzung von Auflagen überwachen soll. Dieses Komitee müsste aus Experten bestehen, die sowohl technisches Verständnis als auch Unabhängigkeit von den beteiligten Parteien mitbringen. Die Erfahrung mit ähnlichen Konstrukten in früheren Kartellverfahren ist gemischt. Manchmal funktioniert externe Aufsicht, manchmal wird sie zur bürokratischen Formalität ohne echte Wirkung.
Ein weiteres Problem ist die Dauer verhaltensbasierter Auflagen. Das Gericht hat im Suchmaschinenverfahren eine Laufzeit von sechs Jahren für die verhängten Maßnahmen festgelegt. Nach Ablauf dieser Frist würde Google theoretisch wieder frei sein, seine Geschäftspraktiken nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Sechs Jahre sind in der Technologiebranche eine lange Zeit, aber sie sind auch kurz genug, dass ein Unternehmen abwarten kann. Die Frage ist, ob in diesem Zeitraum ein wettbewerbsfähiges Ökosystem alternativer Anbieter entstehen kann, das robust genug ist, um nach Ablauf der Auflagen weiter zu bestehen.
Globale Wettbewerbsdynamiken
Die kartellrechtliche Auseinandersetzung mit Google findet nicht im Vakuum statt, sondern vor dem Hintergrund globaler Verschiebungen in der Technologiepolitik. China verfolgt eine Strategie der Förderung nationaler Champions, die in strategischen Sektoren dominieren sollen. Die Europäische Union setzt auf strenge Regulierung und versucht, durch den Digital Markets Act und den Digital Services Act neue Regeln für digitale Plattformen zu etablieren. Die USA schwanken zwischen diesen Polen: Einerseits gibt es Stimmen, die argumentieren, dass amerikanische Unternehmen Unterstützung brauchen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Andererseits gibt es die traditionelle Überzeugung, dass offener Wettbewerb langfristig die beste Industriepolitik ist.
Gail Slaters Argumentation ist, dass die USA einen dritten Weg gehen müssen: Weder sollten sie Monopole tolerieren noch sollten sie Unternehmen durch übermäßige Regulierung ersticken. Stattdessen soll Kartellrecht dafür sorgen, dass Märkte offen bleiben und neue Akteure eine faire Chance haben. Diese Philosophie klingt überzeugend, ist aber in der Umsetzung herausfordernd. Denn während Kartellverfahren Jahre dauern, bewegen sich Märkte in Monaten. Bis ein Urteil rechtskräftig ist, haben sich die technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen bereits wieder verschoben.
Die Diskussion um nationale Sicherheit kompliziert die Lage zusätzlich. Manche Beobachter argumentieren, dass Google, trotz seiner Dominanz, ein amerikanisches Unternehmen ist, das amerikanische Interessen besser vertritt als hypothetische chinesische oder europäische Wettbewerber. Eine Schwächung von Google könnte daher als strategischer Fehler interpretiert werden. Diese Argumentation ist jedoch gefährlich, denn sie verwechselt Unternehmensnationalität mit nationalem Interesse. Ein monopolistisches amerikanisches Unternehmen schadet amerikanischen Verlagen, Werbetreibenden und Konsumenten nicht weniger als ein monopolistisches ausländisches Unternehmen.
Alternativen zur Zerschlagung
Neben einer vollständigen Veräußerung gibt es auch Zwischenlösungen, die diskutiert werden. Eine Option wäre eine funktionale Trennung: Google würde AdX und den Adserver weiterhin besitzen, aber getrennte Geschäftseinheiten mit eigenen Managementstrukturen und strikten Verboten der Datenweitergabe zwischen den Einheiten etablieren. Diese Lösung würde die technische Integration erhalten, aber die Interessenkonflikte reduzieren.
Eine andere Option wäre die Mandatierung offener Schnittstellen. Google könnte verpflichtet werden, seine Adserver-Software und AdX-Plattform so zu gestalten, dass Wettbewerber auf gleicher Augenhöhe teilnehmen können. Das würde bedeuten, dass Publisher, die DFP nutzen, nicht mehr verpflichtet wären, auch AdX zu nutzen, und dass konkurrierende Werbebörsen die gleichen Informationen und die gleiche Reaktionszeit erhalten wie AdX. Die Implementierung solcher Maßnahmen ist technisch anspruchsvoll, aber nicht unmöglich.
Eine dritte Option wäre die Open-Source-Veröffentlichung kritischer Teile der Werbetechnologie. Wenn die Auktionslogik, die bestimmt, welche Anzeige ausgespielt wird, öffentlich einsehbar wäre, könnten unabhängige Experten überprüfen, ob sie fair funktioniert. Diese Transparenz würde Googles Möglichkeiten zur Manipulation einschränken. Allerdings würde sie auch Geschäftsgeheimnisse offenlegen, die Google als zentral für seine Wettbewerbsfähigkeit betrachtet.
Jede dieser Alternativen hat Vor- und Nachteile. Keine ist perfekt, und alle erfordern intensive Überwachung und Durchsetzung. Das Gericht muss abwägen, welche Kombination von Maßnahmen am ehesten geeignet ist, Wettbewerb wiederherzustellen, ohne unnötigen Schaden anzurichten.
Die Zukunft des offenen Internets
Im Kern geht es bei dem Google-Verfahren um die Frage, welche Art von Internet wir wollen. Das offene Internet, in dem unabhängige Verlage und Content-Creators ihr Publikum direkt erreichen und monetarisieren können, steht in Konkurrenz zu geschlossenen Ökosystemen, die von wenigen Plattformen dominiert werden. Meta, Google, Amazon und andere Tech-Giganten kontrollieren nach verschiedenen Schätzungen etwa 80 Prozent der digitalen Werbeausgaben. Der Rest entfällt auf das, was als offenes Internet bezeichnet wird.
Wenn Google gezwungen wird, seine Werbetechnologie zu zerschlagen oder zumindest zu entflechten, könnte das dem offenen Internet neuen Schwung verleihen. Kleinere Publisher hätten bessere Chancen, faire Preise für ihre Werbeflächen zu erzielen. Werbetreibende hätten mehr Transparenz und niedrigere Kosten. Innovation würde gefördert, weil neue Anbieter von Werbetechnologie eine realistische Chance hätten, Marktanteile zu gewinnen.
Skeptiker bezweifeln jedoch, dass kartellrechtliche Eingriffe diese Trendwende herbeiführen können. Die strukturellen Vorteile großer Plattformen, argumentieren sie, liegen nicht nur in anticompetitiven Praktiken, sondern in fundamentalen Netzwerkeffekten und Skalenvorteilen. Selbst wenn Google gezwungen wird, AdX zu verkaufen, wird der Käufer vermutlich ein anderes großes Technologieunternehmen sein, das ähnliche Anreize hat, den Markt zu dominieren. Eine echte Dezentralisierung würde mehr erfordern als Kartellverfahren gegen einzelne Unternehmen; sie würde eine grundlegende Neugestaltung der digitalen Infrastruktur erfordern.
Fazit ohne Schlussstrich
Das Verfahren gegen Google ist ein Testfall für die Frage, ob Kartellrecht im 21. Jahrhundert noch ein wirksames Werkzeug zur Kontrolle wirtschaftlicher Macht ist. Die Herausforderungen sind enorm: Technische Komplexität, rascher Wandel, globale Verflechtungen und politische Grabenkämpfe machen es schwer, klare Lösungen zu finden. Richterin Brinkema steht vor der Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen, die sowohl rechtlich haltbar als auch praktisch umsetzbar ist, die Schaden repariert ohne neue Schäden zu verursachen, und die schnell genug kommt, um relevant zu bleiben.
Die Entscheidung, die in den kommenden Monaten erwartet wird, wird weitreichende Konsequenzen haben. Nicht nur für Google, sondern für die gesamte digitale Wirtschaft. Sollte das Gericht eine strukturelle Trennung anordnen, würde das ein Signal senden, dass selbst die mächtigsten Technologiekonzerne nicht über dem Gesetz stehen. Sollte das Gericht sich für mildere Auflagen entscheiden, werden Kritiker das als Bestätigung interpretieren, dass Big Tech zu groß geworden ist, um effektiv kontrolliert zu werden.
In jedem Fall ist klar, dass die Zeit nicht stillsteht. Während Juristen über Marktdefinitionen debattieren und Experten technische Machbarkeitsstudien erstellen, verarbeitet Googles Infrastruktur weiterhin Millionen von Werbeanfragen pro Sekunde, erzielt Milliarden von Dollar an Einnahmen und festigt seine Position im digitalen Ökosystem. Die Gerechtigkeit mag langsam sein, aber die Wirtschaft wartet nicht. Das ist das Dilemma, das Richterin Brinkema so offen angesprochen hat: Zeit ist von essenzieller Bedeutung, und genau diese Zeit läuft davon.
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das amerikanische Rechtssystem in der Lage ist, den Herausforderungen der digitalen Ökonomie gerecht zu werden. Das Urteil über Google wird nicht das letzte Wort sein, sondern nur ein Kapitel in einer viel längeren Geschichte über die Beziehung zwischen Technologie, Märkten und Macht. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt.
Ihr globaler Marketing und Business Development Partner
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.
☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung
☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung
☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse
☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen
☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing
Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital
Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie
Mehr dazu hier:
Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:
- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends
- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen
- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie
- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten