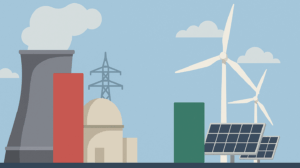Veröffentlicht am: 21. Mai 2025 / Update vom: 2. Juni 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Solarpark | Stromgestehungskosten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen: Bedeutung und Wirtschaftlichkeit mit Beispiel – Bild: Xpert.Digital
Solarenergie im Kostenvergleich: Photovoltaik punktet gegen konventionelle Energien
Photovoltaik-Freiflächenanlagen: Lohnt sich die Investition mehr denn je?
Die aktuellen Stromgestehungskosten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zwischen 4,1 und 6,9 Cent pro Kilowattstunde zeigen deutlich, wie wettbewerbsfähig Solarenergie im Vergleich zu konventionellen Energiequellen geworden ist. Diese Entwicklung hat weitreichende Bedeutung für die Energiewirtschaft und die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen.
Was sind Stromgestehungskosten?
Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) bezeichnen die durchschnittlichen Kosten, die bei der Erzeugung einer Kilowattstunde (kWh) Strom über die gesamte Lebensdauer einer Energieerzeugungsanlage entstehen. Diese Kennzahl ermöglicht einen direkten Kostenvergleich zwischen verschiedenen Energieerzeugungstechnologien.
Die Berechnung umfasst:
- Investitionskosten für Anschaffung und Installation
- Betriebs- und Wartungskosten
- Finanzierungskosten
- Eventuell anfallende Brennstoffkosten
- Rückbaukosten am Ende der Lebensdauer
Die Formel lautet vereinfacht: (Gegenwartswert der Gesamtkosten über die Lebensdauer) / (Gegenwartswert des gesamten im Laufe der Lebensdauer erzeugten Stroms).
Passend dazu:
Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Kostenvergleich
Mit Stromgestehungskosten von 4,1 bis 6,9 Cent pro Kilowattstunde sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen aktuell die kostengünstigste Form der Stromerzeugung in Deutschland. Zum Vergleich: Die Gestehungskosten anderer Energieträger liegen deutlich höher:
- Braunkohle: 15,1 bis 25,7 Cent/kWh
- Kernenergie: bis zu 49 Cent/kWh
Die Fraunhofer-Forscher prognostizieren sogar, dass diese Kosten bis 2045 weiter auf 3,1 bis 5,0 Cent pro Kilowattstunde sinken könnten.
Ab wann ist eine Photovoltaik-Freiflächenanlage wirtschaftlich?
Eine Photovoltaikanlage gilt als wirtschaftlich, wenn die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und die eingesparten Stromkosten die Investitions- und Betriebskosten übersteigen. Bei Freiflächenanlagen spielen mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle:
1. Flächengröße und Anlagendimensionierung
Die Wirtschaftlichkeit steigt mit der Größe der Anlage. Viele Projektierer werden erst bei Flächengrößen von mindestens vier bis fünf Hektar aktiv, da dann Skaleneffekte eintreten. Kleinere Projekte können jedoch auch rentabel sein, wenn der erzeugte Strom in unmittelbarer Nähe genutzt werden kann.
2. Vergütung und Vermarktung
Aktuell werden folgende Vergütungsmodelle angeboten:
- Anlagen unter 1.000 kWp: Feste EEG-Vergütung von 7,00 Cent pro kWh
- Anlagen über 1.000 kWp: Teilnahme an Ausschreibungsverfahren mit einem Höchstwert von 6,8 Cent pro kWh für 2025
Zunehmend werden Anlagen auch außerhalb der EEG-Förderung über Power-Purchase-Agreements (PPA) wirtschaftlich betrieben.
Passend dazu:
- Was sind Power Purchase Agreements (PPA)? – Wirtschaftlicher Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen ohne EEG-Förderung
3. Amortisationszeit
Die typische Amortisationszeit für Photovoltaikanlagen liegt zwischen 10 und 15 Jahren. Nach diesem Zeitpunkt ist die ursprüngliche Investition refinanziert, und die Anlage erwirtschaftet für den Rest ihrer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren Gewinn.
4. Netzparität
Die Netzparität bezeichnet den Punkt, an dem die Kosten für selbst erzeugten Solarstrom gleich oder niedriger sind als die Kosten für Strom aus dem öffentlichen Netz. Diese Schwelle wurde in Deutschland bereits 2012 erreicht, was die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen grundlegend verbessert hat.
Die besondere Wirtschaftlichkeit von Freiflächenanlagen
Freiflächenanlagen bieten im Vergleich zu Dachanlagen mehrere wirtschaftliche Vorteile:
- Geringere Investitionskosten: Die Installation auf freien Flächen ist oft einfacher und kostengünstiger als auf Dächern.
- Optimale Ausrichtung: Freiflächenanlagen können perfekt zur Sonne ausgerichtet werden, was zu höheren Erträgen führt.
- Skaleneffekte: Größere Anlagen profitieren von niedrigeren Kosten pro installiertem Kilowatt.
Kostenentwicklung
Die Stromgestehungskosten für Photovoltaik sind in den letzten Jahren drastisch gesunken – zwischen 2010 und 2020 um etwa 90%. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, wenngleich in gemäßigterem Tempo.
Zum Vergleich: Die aktuellen Strompreise für Endverbraucher liegen bei etwa 26,1 Cent/kWh für Neukunden und 34,7 Cent/kWh für Bestandskunden. Dies verdeutlicht die erhebliche Differenz zwischen Erzeugungskosten und Endkundenpreisen.
Wirtschaftlich und nachhaltig: Warum Solarparks auf Freiflächen überzeugen
Mit Stromgestehungskosten von 4,1 bis 6,9 Cent pro Kilowattstunde haben Photovoltaik-Freiflächenanlagen die Schwelle zur Wirtschaftlichkeit längst überschritten. Sie stellen nicht nur die kostengünstigste Form der Stromerzeugung dar, sondern bieten auch attraktive Investitionsmöglichkeiten mit überschaubaren Amortisationszeiten. Die Kombination aus niedrigen Erzeugungskosten, langfristig steigenden Marktpreisen für Strom und verschiedenen Vermarktungsoptionen macht Freiflächenanlagen zu einer wirtschaftlich sinnvollen Investition – sowohl für professionelle Projektierer als auch für Kommunen und landwirtschaftliche Betriebe mit entsprechenden Flächenressourcen.
Photovoltaik-Freiflächenanlagen: Leistungspotenzial Beispiel auf 4-5 Hektar
Für die Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist die Flächeneffizienz ein zentraler Parameter. Auf einer Fläche von 4 bis 5 Hektar können je nach technischer Konfiguration und Standortbedingungen durchschnittlich 3,6 bis 7 MW installierte Leistung realisiert werden. Diese Bandbreite ergibt sich aus folgenden Faktoren:
Flächenleistungsrelation
Moderne Freiflächenanlagen erreichen heute 0,9–1,4 MW pro Hektar. Dieser Wert hängt ab von:
- Modultechnologie: Hochleistungsmodule mit Wirkungsgraden über 22% reduzieren den Flächenbedarf.
- Aufständerungssystem: Ost-West-Ausrichtung oder Nachführsysteme erhöhen die Flächenausnutzung um bis zu 25%.
- Reihenabstände: Größere Abstände zwischen Modulreihen (zur Minimierung von Verschattung) reduzieren die Leistungsdichte, ermöglichen aber gleichzeitig Agri-PV-Nutzung.
Fläche und Leistung: Je nachdem, welche Technik und Einstellungen verwendet werden, kann man pro Hektar Land (das ist etwa so groß wie anderthalb Fußballfelder) zwischen 0,9 und 1,4 Megawatt Leistung durch Solarstrom erzeugen.
Was beeinflusst die Leistung pro Hektar:
- Solarpanel-Technologie: Effizientere Solarpanels brauchen weniger Platz.
- Anordnung der Solarmodule: Besondere Ausrichtungen oder Systeme, die der Sonne nachfolgen, sorgen dafür, dass mehr Strom erzeugt werden kann.
- Abstand zwischen den Modulreihen: Wenn die Solarpanels weiter auseinander stehen, wird weniger Strom pro Fläche erzeugt, aber man kann die Fläche eventuell noch anderweitig nutzen, z. B. für Landwirtschaft (Agri-PV).
Beispielrechnung:
- Wenn man 4 Hektar Fläche nutzt und davon ausgeht, dass man pro Hektar durchschnittlich 1,1 Megawatt erzeugt, ergibt das insgesamt 4,4 Megawatt.
- Wenn die Bedingungen optimal sind und man 1,4 Megawatt pro Hektar schafft, könnte man auf 5 Hektar Fläche 7 Megawatt erzeugen.
Für 4 Hektar bei Standardbedingungen:
- Leistung = Fläche (in ha) × Leistung pro Hektar (in MW/ha)
↪ Leistung = 4 ha x 1,1 MW/ha = 4,4 MW
Für 5 Hektar bei optimalen Bedingungen:
- Leistung = Fläche (in ha) × Leistung pro Hektar (in MW/ha)
↪ Leistung = 5 ha x 1,4 MW/ha = 7 MW
Kurz gesagt: Mehr Effizienz und bessere Technik = mehr Strom auf derselben Fläche. 4 Hektar Fläche können etwa 4,4 MW erzeugen – oder bei idealen Bedingungen sogar mehr.
Praktische Beispiele und Grenzen
- Eine typische 5-MW-Anlage benötigt etwa 4,5 Hektar bei Verwendung standardisierter Aufständerungen.
- In Nordrhein-Westfalen wurden 2023 Anlagen mit 1,35 MW/ha realisiert, indem bifaziale Module und optimierte Reihenabstände kombiniert wurden.
- Limitierend wirken oft Netzanschlusskapazitäten: Für eine 7-MW-Anlage ist ein 20-kV-Mittelspannungsanschluss erforderlich, dessen Verfügbarkeit vorab geprüft werden muss.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Investitionskosten liegen aktuell bei 600–900 €/kWp, was für eine 5-MW-Anlage 3–4,5 Mio.€ bedeutet. Bei einer Volllaststundenzahl von 950–1.100 h/Jahr in Deutschland ergibt sich ein Jahresertrag von:
5 MW x 1.050 h = 5.250 MWh
Bei einem Strompreis von 6,8 ct/kWh (EEG-Ausschreibungswert 2025) generiert dies jährliche Erlöse von 357.000€, was eine Amortisationszeit von 9–12 Jahren ermöglicht.
Zukunftspotenzial
Mit der Einführung von Tandem-PV-Modulen (Wirkungsgrad >30%) könnte die Leistungsdichte bis 2030 auf 2 MW/ha steigen, wodurch auf 5 Hektar bis zu 10 MW realisierbar würden.
Passend dazu:
Neuartige Photovoltaik-Lösung zur Kostensenkung (bis zu 30%) und Zeitersparnis (bis zu 40%)
Mehr dazu hier:
Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau
Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen
☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch
☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!
Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital
Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.