Veröffentlicht am: 2. Februar 2025 / Update vom: 2. Februar 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein
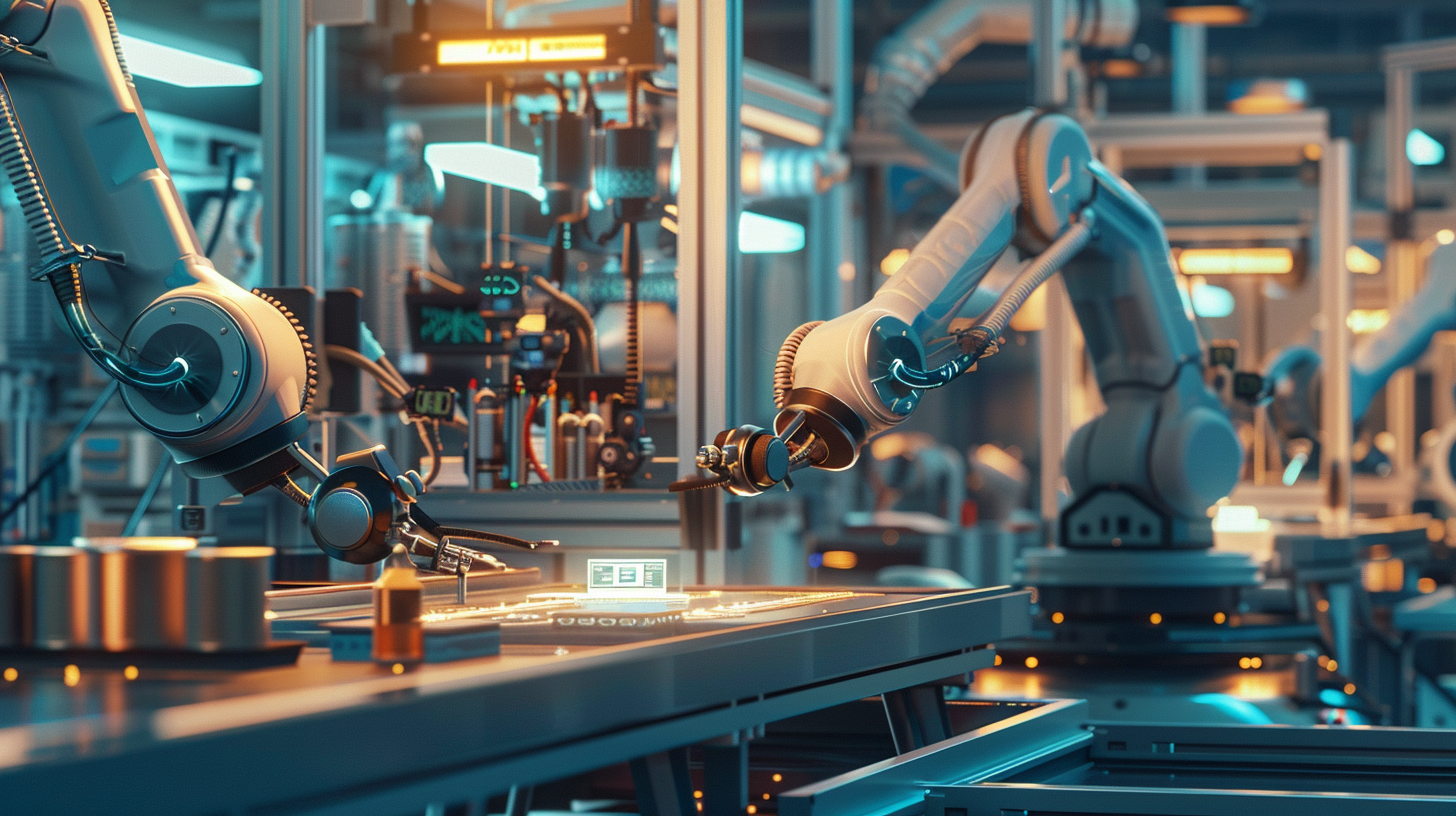
Von der Spitze ins Tal? Deutschlands Robotik muss jetzt umdenken – so geht es wieder bergauf – Bild: Xpert.Digital
Umsatzrückgang 2025: Herausforderungen und Lösungen für die Robotikindustrie
Wie Deutschlands Robotikbranche den globalen Wettbewerbsdruck meistern kann
Die Robotik- und Automationsbranche in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Bereits seit einiger Zeit ist erkennbar, dass ihre einstige Wettbewerbsfähigkeit schwindet und sich die Branche in einem Spannungsfeld aus steigenden Kosten, strikten regulatorischen Anforderungen und globalem Wettbewerbsdruck befindet. Zugleich sehen sich viele Unternehmen mit einer nachlassenden Nachfrage konfrontiert, die sich besonders stark auf traditionell wichtige Abnehmerbranchen wie die Automobilindustrie auswirkt. Wie aus Branchenschätzungen hervorgeht, ist für das Jahr 2025 mit einem weiteren Rückgang beim Gesamtumsatz in Höhe von minus neun Prozent zu rechnen. Dies würde einen Rückgang auf 13,8 Milliarden Euro bedeuten. Bereits im Vorjahr 2024 sank der Umsatz laut dieser Prognose um sechs Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Angesichts dieser Entwicklung fragen sich zahlreiche Branchenakteure, welche Ursachen diesen Rückgang bedingen, welche strukturellen Probleme zum Tragen kommen und welche Gegenmaßnahmen sich anbieten, um eine langfristige Sicherung der Robotik- und Automationskompetenzen in Deutschland zu gewährleisten.
„Die Robotik und Automation in Deutschland hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren: Für 2025 prognostiziert der Branchenverband einen Rückgang beim Gesamtumsatz von minus neun Prozent auf 13,8 Milliarden Euro“, lautet eine zentrale Einschätzung, die die Verunsicherung der Branche widerspiegelt. Das Jahr 2024 hatte bereits einen empfindlichen Umsatzrückgang von sechs Prozent mit 15,2 Milliarden Euro gebracht. Damit steht die deutsche Robotik- und Automationsindustrie vor einem Problem, das sich auf verschiedenen Ebenen manifestiert: einer rückläufigen Inlandsnachfrage, einem herausfordernden internationalen Umfeld und einem hohen Kostendruck innerhalb Deutschlands. Gleichzeitig gibt es jedoch erste Initiativen und Strategien, die in den kommenden Jahren für einen erneuten Aufschwung sorgen könnten – sofern sie konsequent umgesetzt und durch politische Rahmenbedingungen unterstützt werden.
1. Aktuelle Marktsituation
Die rückläufige Umsatzentwicklung im Bereich Robotik und Automation macht deutlich, wie fragil die konjunkturelle Lage vieler Unternehmen geworden ist. In den vergangenen Jahren war diese Branche nicht nur eine der innovativsten, sondern auch eine der am stärksten wachsenden in Deutschland. Viele Betriebe profitierten vom Aufschwung in der Automobilindustrie, vom zunehmenden Fokus auf Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung und von neuen Einsatzfeldern, zum Beispiel in der Medizintechnik. Heute jedoch zeigen sich erste Erosionserscheinungen, die in den veränderten globalen Gegebenheiten und in der Umstrukturierung einiger Schlüsselbranchen zu suchen sind.
„Die Branche kämpft mit strukturellen Problemen“ – so beschreibt es eine Zusammenfassung der jüngsten Entwicklung. Zu diesen Problemen zählen die übermäßige Abhängigkeit von der Automobilindustrie, hohe Kosten und Regulierung am Standort Deutschland sowie eine schwächelnde Nachfrage aus dem Ausland. Zwar konnte die Eurozone immerhin einen deutlichen Zuwachs bei den Auftragseingängen verzeichnen, doch die Exporte in Länder außerhalb der Eurozone fielen spürbar. Besonders gravierend wirkt sich die Nachfrageflaute im Inland aus, wo die Aufträge laut einigen Erhebungen um 16 Prozent zurückgegangen sind.
Die folgende, häufig diskutierte Entwicklung der Auftragslage für das Jahr 2024 verdeutlicht das Ausmaß des Rückgangs:
- Inlandsaufträge: -16 %
- Auslandsaufträge: -2 %
- Eurozone-Exporte: +44 %
- Nicht-Eurozone-Exporte: -13 %
Diese Zahlen weisen auf ein sehr heterogenes Bild hin. Auf der einen Seite existieren Märkte in Europa, die für einen Teil der Unternehmen weiterhin wachstumsstark sind. Auf der anderen Seite fallen entscheidende Auslandsmärkte, beispielsweise in Nordamerika oder Asien, zum Teil deutlich schwächer aus. Genau hier offenbart sich auch die Abhängigkeit von einzelnen Branchen und Regionen.
2. Hintergründe und Ursachen
Für viele Expertinnen und Experten liegt ein zentraler Faktor dieser negativen Tendenz in den strukturellen Problemen, mit denen sich das verarbeitende Gewerbe in Deutschland konfrontiert sieht. Dazu gehören neben steigenden Energiepreisen und Kosten für Personal auch ein immer dichter werdender Regulierungsrahmen. Unternehmen müssen zunehmend Zeit, Geld und personelle Ressourcen aufbringen, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, die zwar oftmals einer hohen Qualitäts- und Sicherheitsorientierung geschuldet sind, gleichzeitig jedoch die Agilität und Innovationsfähigkeit hemmen.
Die Branche zeigt sich zudem empfindlich für konjunkturelle Einbrüche und strukturelle Umbrüche: Die Automobilindustrie, bislang einer der wichtigsten Kundenbereiche, befindet sich in einer Phase der Transformation, bei der unter anderem der Umstieg auf Elektromobilität enorme Investitionen fordert. Zugleich wird bei vielen Herstellern gespart, und die bisher üppigen Budgets für klassische Automatisierungsprojekte in Deutschland geraten unter Druck. Dies macht sich insbesondere bei Robotik- und Automationsfirmen bemerkbar, die sich stark auf diesen Sektor spezialisiert haben.
Neben diesen Faktoren tragen auch unsichere geopolitische Rahmenbedingungen sowie der globale Technologiewettbewerb zu den aktuellen Problemen bei. Unternehmen aus Asien und Nordamerika profitieren nicht selten von staatlichen Subventionen oder von niedrigeren Produktionskosten, was ihnen in Ausschreibungen für Großprojekte einen deutlichen Preisvorteil verschaffen kann. Dies erschwert es deutschen Anbietern, ihre technologisch hochwertigen Produkte und Lösungen international erfolgreich zu positionieren, sofern sie nicht in Nischenmärkten oder Spezialanwendungen aktiv sind.
3. Rolle der Automobilindustrie
Die Bedeutung der Automobilbranche für die Robotik- und Automationsindustrie in Deutschland kann kaum überschätzt werden. „Übermäßige Abhängigkeit von der Automobilindustrie, die 2024 einen Inlandsauftragsrückgang von 16 % verzeichnete“, gilt laut Branchenkennern als ein wesentlicher Risikofaktor. Die Abhängigkeit liegt daran, dass ein erheblicher Teil der robotischen und automatisierten Produktionsanlagen speziell in der Fahrzeugherstellung eingesetzt wird – beispielsweise beim Schweißen von Karosserieteilen, beim Lackieren oder bei der Endmontage.
In Zeiten, in denen viele Automobilhersteller aber zunehmend unsichere Absatzprognosen haben und gleichzeitig riesige Summen in neue Antriebstechnologien, Batterietechnik oder Softwarelösungen investieren müssen, bleiben klassisch ausgerichtete Automatisierungslösungen oftmals auf der Strecke. Zwar könnten neue Produktionsverfahren und elektrisch betriebene Fahrzeugplattformen langfristig die Nachfrage nach hochspezialisierter Robotik ankurbeln, doch aktuell bewirkt die Umorientierung in der Automobilindustrie eher eine Investitionszurückhaltung bei traditionellen Projekten.
4. Internationale Herausforderungen
Der Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass deutsche Unternehmen im Bereich Robotik und Automation mit hohem Wettbewerbsdruck konfrontiert sind. In Ländern wie China, Japan oder den USA hat sich ein florierendes Innovationsumfeld etabliert, in dem staatliche Förderprogramme die Entwicklung neuer Technologien intensiv unterstützen. Dortige Firmen können außerdem häufig auf größere Risikobudgets zurückgreifen, da Risikokapitalgeber im internationalen Vergleich schneller bereit sind, in neue Produkte und Märkte zu investieren. Darüber hinaus schreiten dort Konzepte wie Smart Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) und datenbasierte Geschäftsmodelle zügiger voran, was zu einer breiteren Adoption hochautomatisierter Prozesse führt.
Während Deutschland in den vergangenen Jahren durch das Schlagwort „Industrie 4.0“ internationale Aufmerksamkeit erlangte, zeigt sich mittlerweile, dass eine erfolgreiche Umsetzung dieser Konzepte eine engere Verzahnung von Forschung, Wirtschaft und Politik erfordert als bisher. Zudem sind viele Unternehmen bis heute stark auf das klassische Maschinenbaugeschäft fokussiert und tun sich mit den neuen Geschäftsmodellen, die durch künstliche Intelligenz, Big Data oder Cloud Computing entstehen, schwer. Das mangelnde Tempo in der Digitalisierung könnte sich in Zukunft als weiterer Wettbewerbsnachteil erweisen.
5. Potenzial der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz
Trotz der momentanen Dämpfer steht außer Frage, dass Robotik und Automation auch in Zukunft eine tragende Rolle in der industriellen Wertschöpfung spielen werden. Denn die Automatisierung komplexer Prozesse, die Gewährleistung gleichbleibender Qualität und die Verbesserung der Effizienz bleiben wesentliche Ziele vieler Branchen – von der Metall- und Kunststoffverarbeitung über die Lebensmittelindustrie bis hin zu Logistik und E-Commerce.
Zudem eröffnet die fortschreitende Digitalisierung neue Möglichkeiten, Automatisierung und Robotik noch nahtloser in Produktionsabläufe einzubinden. Themen wie das digitale Abbild eines Produktionsstandorts („Digital Twin“), Cloud-Services für die vorausschauende Wartung („Predictive Maintenance“), kollaborative Robotik („Cobots“) oder die Integration von KI in Steuerungssoftware bieten Unternehmen Potenziale, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Gerade im Bereich der KI-gesteuerten Bildverarbeitung und Prozessoptimierung ist ein hoher Nutzen erkennbar: Roboter können durch Machine-Learning-Algorithmen flexibel an verschiedene Aufgaben angepasst werden und lernen, Fehlerbilder in Echtzeit zu erkennen. Solche Technologiefelder sind noch längst nicht ausgeschöpft und bergen ein erhebliches Wachstumspotenzial.
Ein weiterer Erfolgsfaktor könnte darin liegen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Statt einzelne Maschinen oder Roboter zu verkaufen, gehen immer mehr Anbieter dazu über, Automatisierung als Dienstleistung zu betreiben, wobei die Abrechnung nach Zeit oder pro produzierter Einheit erfolgt. Dies reduziert die Anfangsinvestitionen für Kunden und könnte den Marktzugang insbesondere in Branchen erleichtern, die bisher nur zögerlich in teure Automatisierungslösungen investieren wollten.
6. Diversifizierung und neue Märkte
„Die Verringerung der Abhängigkeit von der Automobilindustrie durch Ausweitung auf Wachstumsbereiche wie Laborautomation, Logistik oder erneuerbare Energien“ gilt als eine der vielversprechendsten Maßnahmen zur langfristigen Stärkung der deutschen Robotik- und Automationsbranche. Gerade in der Logistikbranche steigt die Nachfrage nach autonomen Transportsystemen, automatisierten Lagersystemen und intelligenten Sortierrobotern rasant. Auch im Bereich der Laborautomation, insbesondere in der Pharma- und Medizintechnik, kann robotergestützte Handhabung empfindlicher Proben zu Qualitätsgewinnen und Kosteneinsparungen führen. Darüber hinaus erfordern Boom-Sektoren wie erneuerbare Energien, Wasserstofftechnologien oder die Batteriezellenfertigung verstärkt automatisierte Prozesse, um in großen Stückzahlen effiziente und gleichbleibend hochwertige Produkte zu fertigen.
Insbesondere die Montage und Handhabung empfindlicher Bauteile, zum Beispiel in der Halbleiter- und Elektronikproduktion, birgt ein großes Potenzial. Der Bedarf an Mikrorobotiklösungen, die hochpräzise Manipulation ermöglichen, wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Deutsche Firmen könnten hier von ihrer Erfahrung in der Hochtechnologie profitieren, sofern sie die benötigten F&E-Aufwendungen tätigen und die richtigen Kooperationen eingehen.
7. Strategische Brancheninitiativen
„Unternehmen müssen Innovationen beschleunigen, höhere Agilität entwickeln und Kostensenkungspotenziale ausschöpfen“, so die Forderung eines Branchenvertreters. Dies lässt sich jedoch nur erreichen, wenn sich die Unternehmen nicht isoliert betrachten, sondern Netzwerke bilden und gemeinsam an Schlüsseltechnologien arbeiten. Konsortien und branchenübergreifende Kooperationen könnten beispielsweise in den Bereichen Brennstoffzellenproduktion, KI-Integration in der Produktion oder in datengetriebenen Plattformen für die Fertigungsindustrie entstehen.
Die Initiative, ein gemeinsames Datenökosystem für Fertigungsunternehmen zu etablieren, könnte den Austausch von Produktionsdaten erleichtern, was wiederum die Nutzung künstlicher Intelligenz vorantreibt. Ziel ist es, Produktionsprozesse in Echtzeit zu analysieren und Entscheidungen automatisch zu optimieren. Besonders Mittelständler, die meist nicht über große eigene Abteilungen für Datenanalyse verfügen, könnten davon profitieren. Eine solche Plattform, die unter dem Schlagwort „Manufacturing-X“ angedacht ist, würde standardisierte Schnittstellen, Datensicherheit und gemeinsame Spielregeln schaffen, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Unternehmen zu ermöglichen.
8. Politische Forderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
„Wir fordern den Abbau von Regulierungshemmnissen und die Schaffung wettbewerbsfähigerer Rahmenbedingungen.“ Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung der Politik, um einen günstigen Nährboden für Investitionen und Innovationen zu schaffen. Aus Sicht der Unternehmen stehen insbesondere folgende Punkte im Vordergrund:
Abbau regulatorischer Hürden
Einfachere Genehmigungsverfahren, flexiblere Arbeitszeitregelungen und ein Bürokratieabbau bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten könnten die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
Investitionsanreize für Anwender
Steuerliche Erleichterungen oder gezielte Förderprogramme für Unternehmen, die in Automatisierung und Robotik investieren, könnten die Marktnachfrage beleben und den Anschluss an internationale Entwicklungen sichern.
Günstigere Finanzierungskonditionen
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Start-ups ist der Zugang zu Kapital eine wesentliche Voraussetzung, um neue Produkte zu entwickeln oder weltweite Vertriebsstrukturen aufzubauen. Staatliche Bürgschaften, Risikokapitalfonds oder Innovationskredite könnten hier Abhilfe schaffen.
Industriepolitische Antworten auf globale Subventionen
Wettbewerber aus Asien und Nordamerika profitieren teils von weitreichender staatlicher Unterstützung. Damit deutsche Firmen ihre Technologieführerschaft behalten oder ausbauen können, wären entsprechende Programme notwendig, um innovative Entwicklungen hierzulande anzustoßen und den Markteintritt zu erleichtern.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Energie- und Klimapolitik. Damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, ist eine verlässliche, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung essenziell. Flankiert durch die Herausforderungen der Energiewende sehen sich Unternehmen derzeit nicht nur mit steigenden Energiepreisen konfrontiert, sondern auch mit der Notwendigkeit, ihre Prozesse klimafreundlich zu gestalten. Die Politik könnte durch klar definierte und realistisch umsetzbare Ziele, gepaart mit Förderungen für energieeffiziente Produktionsverfahren, dazu beitragen, dass Robotik- und Automationsunternehmen sich weiterentwickeln und international konkurrenzfähig bleiben.
9. Unternehmensseitige Reformen
Auch die Unternehmen selbst sind in der Pflicht, ihre Prozesse zu überdenken und neue Wege zu gehen. „Beschleunigung von Innovationszyklen durch agile Prozesse und Kostenoptimierung“ lautet eine häufig genannte Maxime in diesem Zusammenhang. Während in manchen Betrieben die Prozessabläufe noch stark hierarchisch und bürokratisch geprägt sind, können agile Methoden wie Scrum, Kanban oder Lean Development helfen, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Prototypen schneller zu testen.
Mit Blick auf die anhaltenden globalen Unsicherheiten kommt außerdem der Kostenkontrolle eine hohe Bedeutung zu. Deutsche Anbieter, die in der Regel höhere Löhne und Produktionskosten aufweisen als Konkurrenten aus Niedriglohnländern, können jedoch durch Spezialisierung und Qualitätsführerschaft punkten. Dieser Vorsprung sollte ausgebaut werden: Hochqualitative, zuverlässige und technologisch führende Lösungen können Kunden überzeugen, auch wenn diese etwas mehr kosten als preisgünstigere Produkte.
Ein zentrales Zukunftsfeld, das in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen dürfte, ist die Service-Robotik. Sie kommt bei Tätigkeiten wie der Gebäudereinigung, beim Transport in Krankenhäusern oder in der Gastronomie zum Einsatz. Ebenso sind Logistikroboter im E-Commerce-Umfeld ein starkes Wachstumsfeld. Hier könnten deutsche Unternehmen eine globale Technologieführerschaft anstreben, indem sie frühzeitig Standards setzen, Patente anmelden und ihre Entwicklungen konsequent am Bedarf der Kundschaft ausrichten.
10. Bildungs- und Forschungsförderung
Damit diese Schritte gelingen, muss eine solide Basis an Fachkräften und Forschungskapazitäten vorhanden sein. „Verdopplung der Studienplätze in Robotik und Automation bis 2028“ und „Einführung eines verpflichtenden Schulfachs Technik“ sind exemplarische Ideen, um das Interesse an technischen Berufen zu fördern und den talentierten Nachwuchs heranzuziehen. Bereits heute fehlen vielen Firmen Ingenieurinnen und Ingenieure, Programmiererinnen und Programmierer sowie Fachkräfte für das Bedienen und Warten automatisierter Anlagen.
Eine frühzeitige Sensibilisierung für Technik und Naturwissenschaften kann dazu beitragen, mehr junge Menschen für entsprechende Studiengänge zu begeistern. Zudem sollte die Spitzenforschung in Robotersicherheit, Mensch-Roboter-Kollaboration und künstlicher Intelligenz ausgebaut werden, damit Innovationen, die in Laboren entwickelt werden, möglichst schnell den Weg in die Praxis finden. Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen müssten hier eng mit Unternehmen kooperieren, um praxisorientierte Lösungen zu schaffen, die nicht nur auf dem Papier existieren, sondern reale Probleme in der Produktion lösen.
Im Bereich der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) geht es zum Beispiel um die Frage, wie Roboter sicher und unmittelbar mit Menschen zusammenarbeiten können, ohne dass schwere Schutzzäune oder komplexe Sicherheitskonzepte nötig werden. Hier steckt noch großes Entwicklungspotenzial, das in vielen Branchen zu einer Effizienzsteigerung führen könnte. Roboter könnten repetitive Aufgaben übernehmen und sich dynamisch an neue Prozesse anpassen, während Fachkräfte sich auf komplexere Arbeiten konzentrieren. Um solche Anwendungen unter realistischen Betriebsbedingungen zu erproben, ist eine enge Verzahnung von Forschung und industrieller Praxis unverzichtbar.
11. Globale Wettbewerbsfähigkeit und Exportförderung
Um die Einbrüche bei den Auslandsaufträgen auszugleichen, ist es wichtig, die Exportförderung zu verstärken. „Stärkung der Exportförderung, insbesondere für Nicht-Eurozonen-Märkte“, wird als notwendiger Schritt angesehen, um gegen den Nachfrageeinbruch vorzugehen. Da sich in vielen Schwellenländern und aufstrebenden Volkswirtschaften ein hoher Bedarf an Automatisierung abzeichnet, könnten deutsche Firmen hier langfristig neue Geschäftsfelder aufbauen. Dies setzt jedoch voraus, dass Vertriebsstrukturen professionell etabliert werden und gegebenenfalls lokale Partner ins Boot geholt werden, die den Marktzugang erleichtern.
Mit Blick auf den weltweiten Technologiewettbewerb stellt sich zudem die Frage, wie deutsche und europäische Unternehmen auf die massiven Subventionen in Asien oder Nordamerika reagieren sollen. Ohne eigene industriepolitische Initiativen könnte sich der Standortnachteil weiter verschärfen. Ein Ansatz besteht darin, strategische Investitionen in Schlüsseltechnologien zu fördern und auf europäischer Ebene gemeinsame Projekte anzustoßen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Europäischen Union würde die lokale Wertschöpfung erhöhen und eine gewisse Unabhängigkeit von anderen Weltregionen sichern.
12. Konkrete Maßnahmen für die Zukunft
„Die deutschen Robotik- und Automationsunternehmen müssen jetzt strukturelle Reformen und strategische Initiativen umsetzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen“, lautet das Fazit vieler Fachleute. Aus den diskutierten Herausforderungen und den Forderungen der Branche lassen sich verschiedene Handlungsfelder ableiten, die sowohl von den Unternehmen als auch von der Politik adressiert werden müssen:
- Konsortien für Schlüsseltechnologien bilden: Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmen sowie zwischen Industrie und Forschung können dabei helfen, Synergien zu nutzen und Innovationen schneller zur Marktreife zu bringen.
- Diversifizierung der Absatzmärkte: Die Abhängigkeit von der Automobilindustrie sollte reduziert werden, indem neue Branchen wie Laborautomation, Logistik, erneuerbare Energien oder Medizintechnik stärker in den Fokus rücken.
- Agile Innovationsprozesse: Schnellere Entwicklungszyklen und engere Einbindung potenzieller Kunden in den Entwicklungsprozess ermöglichen es, passgenaue Lösungen für unterschiedliche Branchen zu entwickeln.
- Politik für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen: Bürokratieabbau, Steuersenkungen für Forschung und Entwicklung sowie gezielte Exportförderungsprogramme könnten für einen Aufschwung sorgen. Gleichzeitig müssen Hürden bei Genehmigungsverfahren verringert werden.
- Bildungsoffensive: Die Verdopplung der Studienplätze, ein stärkeres Technologieangebot an Schulen und die intensive Unterstützung studentischer Innovationsprojekte helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
- Förderung von Start-ups und KMU: Günstigere Finanzierungsmöglichkeiten, spezifische Inkubatoren und Acceleratoren für Robotik und Automation sowie regionale Clusterbildungen stärken besonders kleinere und mittlere Akteure.
- Ausbau der Service-Robotik: Die Nachfrage nach flexiblen, kollaborativen und mobilen Robotern steigt. Wer hier frühzeitig eigene Lösungen anbieten kann, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.
- Internationale Standards setzen: In vielen Zukunftsfeldern fehlt es noch an klaren Normen und Schnittstellen. Deutsche Unternehmen könnten mit ihrer Technikkompetenz maßgeblich dazu beitragen, globale Standards zu gestalten und sich so als führende Anbieter zu etablieren.
- Langfristige Energie- und Klimastrategie: Planbarkeit und Stabilität in der Energieversorgung sind wesentlich, um Investitionen am Standort Deutschland attraktiv zu halten. Gleichzeitig erfordern anspruchsvolle Klimaziele innovative Konzepte, was wiederum Chancen für Automatisierungsanbieter bieten kann.
13. Roboter und KI: Die treibende Kraft hinter den Megatrends der Zukunft
Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen ist die grundsätzliche Wachstumsstory der Robotik und Automation intakt. Die Weltbevölkerung wächst, die Nachfrage nach immer individuelleren und qualitativ hochwertigen Produkten steigt, und neue Technologien wie künstliche Intelligenz, 5G-Kommunikation oder fortgeschrittene Sensorik eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig führen Megatrends wie die alternde Gesellschaft in vielen Industriestaaten dazu, dass Fachkräftemangel und demografische Verschiebungen die Automatisierung befördern.
„Trotz der aktuellen Herausforderungen ist davon auszugehen, dass langfristige Wachstumstrends intakt bleiben – vorausgesetzt, die Weichen werden jetzt richtig gestellt.“ Dieser Satz verdeutlicht, dass die deutsche Robotik- und Automationsbranche zwar unter Druck steht, gleichzeitig aber enorme Chancen hat, wenn sie flexibel reagiert und mutige Entscheidungen trifft.
Kurzfristig wird sich die Lage insbesondere durch das aktuelle Kostenumfeld in Deutschland und die schwankende Konjunktur in einigen Auslandsmärkten schwierig gestalten. Langfristig sind jedoch zahlreiche Treiber erkennbar, die für eine Erholung und ein erneutes Wachstum sprechen. Ob es gelingt, diese Potenziale auszuschöpfen, hängt maßgeblich von der Bereitschaft der Branchenakteure ab, die erforderlichen Veränderungen anzugehen.
Auf politischer Ebene bedarf es einer Stärkung der Innovationskraft und der Wettbewerbsvorteile. So könnten beschleunigte Planungsverfahren, stärkere steuerliche Anreize und eine beherzte Digitalisierungsstrategie für eine Aufbruchsstimmung sorgen. Gelingt es zudem, die Bildungslücke in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu schließen, steht einer langfristigen Fachkräftebasis nichts im Wege.
Ein größeres Bewusstsein für die Vorteile von Automatisierung könnte in der Bevölkerung geschaffen werden, indem die gesellschaftliche Bedeutung dieser Technologien hervorgehoben wird. Roboter und KI können in vielen Bereichen Arbeitsprozesse verbessern und Arbeitsplätze langfristig sichern, wenn sie klug eingesetzt und begleitet werden.
Ebenso sollte der Austausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft intensiviert werden, damit technologische Entwicklungen nicht nur im Labor oder an einzelnen Produktionsstandorten stattfinden, sondern zeitnah Anwendung finden, von der Öffentlichkeit akzeptiert werden und einen tatsächlichen Mehrwert schaffen.
14. Robotik 4.0: Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Zusammenarbeit sichern
Die deutsche Robotik- und Automationsbranche steht zweifellos am Scheideweg. Auf der einen Seite wirken die strukturellen Probleme, die sich in rückläufigen Auftragszahlen, Kostensteigerungen und einer nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit äußern. Auf der anderen Seite liegen große Chancen in der Diversifizierung und in innovativen Technologien wie der kollaborativen Robotik, der KI-basierten Produktion und dem neuen Feld der Servicerobotik. Ein wesentlicher Impuls könnte zudem von branchenübergreifenden Kooperationen ausgehen, bei denen Forschungsinstitutionen, etablierte Unternehmen und Start-ups gemeinsam Lösungen entwickeln.
Politische Rahmenbedingungen sind hierbei ein entscheidender Faktor. Deutschland und Europa sind in der Verpflichtung, wettbewerbsfähige Strukturen zu schaffen, die Forschung und Entwicklung zu fördern und den Weg für eine erfolgreiche Digitalisierung zu ebnen. Bürokratieabbau, steuerliche Erleichterungen und eine verlässliche Energieversorgung könnten deutliche Signale an Unternehmen und Investoren senden, ihre Zukunft in Deutschland zu gestalten.
Zugleich stehen die Unternehmen selbst in der Verantwortung, sich flexibel auf neue Märkte einzustellen, kollaborative Netzwerke zu bilden und ihre Produkte sowie Geschäftsmodelle an den Wandel anzupassen. Die Beschleunigung von Innovationszyklen und eine strengere Kostenkontrolle können dabei helfen, die traditionell hohe Qualität der deutschen Robotik- und Automationslösungen zu erhalten und sie weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sind gezielte Bildungsoffensiven unerlässlich, um den Nachwuchs zu sichern und für den Fachkräftemangel eine langfristige Lösung zu finden.
Letztlich wird sich der Erfolg der Branche daran messen, ob es gelingt, die Herausforderungen der kommenden Jahre in nachhaltiges Wachstum und technologische Führerschaft umzuwandeln. Robotik und Automation sind Schlüsseltechnologien, die nicht nur in der Industrie, sondern auch in zahlreichen Lebensbereichen Einzug halten. Von der Pflege- und Servicerobotik über autonome Fahrzeuge bis zu intelligenten Prozessen in der Landwirtschaft – der Bedarf an ausgereiften Automations- und Robotiklösungen wird weiter steigen. Dieser Trend lässt hoffen, dass sich die Branche nach der aktuellen Schwächephase neu positionieren und ihre Zukunft erfolgreich gestalten kann.
Wenn alle Akteure – Unternehmen, Verbände, Politik und Gesellschaft – an einem Strang ziehen und die notwendigen Reformen vorantreiben, stehen die Chancen gut, dass die deutsche Robotik- und Automationsbranche mittelfristig an alte Erfolge anknüpfen wird. Dann könnte aus dem jetzigen Umbruch eine Phase der Neubelebung und innovativen Dynamik hervorgehen, in der Deutschland wieder als Wegbereiter für zukunftsweisende Technologien gilt. Gleichzeitig würde diese Entwicklung vielen anderen Industriezweigen zugutekommen, die auf zuverlässige und effiziente Automationslösungen angewiesen sind. So gesehen ist der momentane Rückgang beim Umsatz nicht das Ende, sondern vielmehr ein Weckruf, der die Weichen für die Zukunft neu justieren könnte.
Passend dazu:

